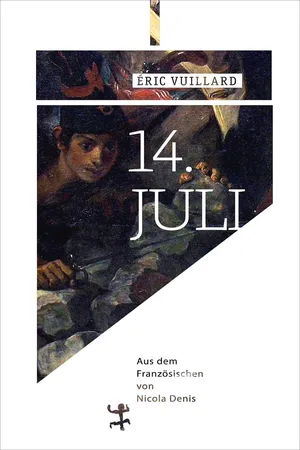
- 100 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
14. Juli
Über dieses Buch
Der Sommer 1789 ist herrlich warm und so schön, dass man die Hungersnot im vorangegangenen bitterkalten Winter leicht vergessen kann, zumindest in den Palästen. Im Volk aber wächst die Unzufriedenheit über die Willkür und Dekadenz der herrschenden Klassen, bis die drückende Hitze schließlich kaum mehr auszuhalten ist. Eines Nachts versammeln sich erste Gruppen in der Dunkelheit. Waffenarsenale werden gestürmt, Theaterrequisiten geplündert. Aus falschen Speeren werden echte Schlagstöcke. Die Kirchenglocken in Paris schlagen Alarm, doch zu spät: Am Morgen des 14. Juli hat sich die Menge bereits vor den Toren der Bastille versammelt - sie wird Europa für immer verändern. Éric Vuillard schildert die Geburtsstunde der französischen Revolution als bildreiches Panorama voller Miniaturen, die uns daran erinnern, dass Freiheit auch Gleichheit aller Menschen vor der Geschichte bedeutet.
»Eine Liebeserklärung an die menschliche Vorstellungskraft in einem überwältigenden Text. Ein Buch mit emotionaler Kraft, das zugleich auch das Elend unserer Zivilisation spiegelt.« - Le Monde des Livres
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
Die Sintflut
Es war eine Sintflut aus Menschen. Es musste etwas nach fünf Uhr sein, als die Menge die Bastille stürmte. Im inneren Hof haben die Invaliden und Schweizer Garden Aufstellung genommen. Die Taschen voller Nägel und Schrot, brüllen die Aufständischen: »Nieder mit den Waffen!« Ein Offizier weigert sich. Man stürzt sich auf ihn und entreißt ihm den Säbel. Jean-Baptiste Humbert läuft linker Hand zur Treppe und stürmt die Stufen empor. Die große Steinschraube verdreht ihm den Kopf. Es geht alles ganz schnell; Humbert nimmt Hunderte von Stufen, ohne jemandem zu begegnen, kraxelt und klettert, erklimmt den Turm und, oben angelangt, völlig außer Atem und auf dem Höhepunkt seiner Erregung, merkt er, dass er alleine ist. Er steht jetzt auf einem der Türme, schaut unten auf die Menge, die der Zitadelle die Luft abschnürt; Menschen überall, die ganze Stadt strömt zur Bastille. Paris begehrt Einlass. Erneut fallen ein paar Schüsse. Der Himmel ist düster. Und Humbert ist allein, allein auf der Spitze der Welt. Er sieht alles, er weiß alles, er ist der erste Mensch.
Doch der Traum endet, Humbert stößt auf einen hockenden Soldaten, der ihm den Rücken zukehrt. Der Schweizer hat ihn nicht gesehen, weiß vermutlich gar nicht, dass die Bastille erobert ist. Humbert nimmt ihn ins Visier. Seine Gewehrspitze weist auf das Rückgrat des Mannes. Er sieht sein Gesicht nicht. Es ist nur ein versteinerter Schatten, ein Wasserspeier.
Humbert ruft: »Nieder mit den Waffen!« Entgeistert schnellt der Kerl herum. Er hat ein hübsches Frätzchen. Sofort legt er seine Waffe nieder und versichert unter Tränen, dass er dem Dritten Stand angehöre, dass er ihn bis zum letzten Blutstropfen verteidigen werde und dass er nicht geschossen habe. Humbert hebt sein Gewehr auf, macht einen Schritt vor und setzt dem Mann sein Bajonett auf den Bauch. Ganz weich ist so ein Wanst, und ganz rundlich, voller Gedärme und Eingeweide, daraus ließe sich Kuttelwurst für ein ganzes Regiment machen. Voller Wölbungen und Ausbuchtungen, voller Höhlen und Gase, voller Röhren, Beutel, Schöße und Magengruben. Aber Humbert ist kein Hitzkopf. Er liebt seinen Nächsten, er ist nicht grausam. Er nimmt dem Soldaten seine Patronentasche ab und kümmert sich dann schnell um die Kanone, um sie von der Lafette zu stoßen und außer Gefecht zu setzen. Alles geschieht in wenigen Augenblicken unter einem schweren Wolkenbaldachin. Der Schweizer rührt sich nicht mehr. Humbert verliert ihn nicht aus den Augen. Doch gerade als er sich über die Kanone beugt, das Auge auf ihr dunkles Fleisch geheftet, zerreißt, von einem anderen Turm aus kommend, eine kleine, schwarz umhüllte Kugel die Luft und durchschlägt ihm den Nacken. Seine untere Gesichtshälfte krampft sich zusammen, er wirkt winzig klein und plötzlich so verletzlich; sein Hals wird hochrot, und etwas ungeheuer Mächtiges bremst ihn, stößt ihn vorwärts, schnappt nach ihm. Er stürzt. Sein Kopf schlägt auf den Stein, schwarzer Schlaf, ein Faden reißt, sein Schmerz verkriecht sich tief in ihm, feucht und warm. Etwas später erwacht er auf den Treppenstufen. Der Schweizer rüttelt ihn an den Schultern, seine Wunde blutet stark; er hat ihn hierher getragen. Mit schweißglitzernden Gesichtern sehen die beiden Männer einander an. Der Soldat zerreißt sein Hemd, um die Wunde zu verbinden.
Man rannte in sämtliche Richtungen. Jeder nahm den kürzesten Weg zur Wahrheit. Rossignol kletterte auf einen anderen Turm. Beim Aufstieg sah er eine verschlossene Zelle und öffnete die Riegel: ein hübscher, aber leichenblasser junger Mann. Was für ein Glück, ihn an die Luft zu setzen! Rossignol nimmt wieder die Treppe, außer sich vor Freude. Oben angelangt, stößt er auf einen Bäcker, Morin. Zusammen mit seinen Brüdern war er gerade dabei, die Kanonen umzudrehen. Sie erledigten das wie jede andere Arbeit, mit hochgekrempelten Ärmeln. Der eine hatte vielleicht eine Kippe im Mund. Der andere spuckte ins Leere. Das Ding ist schwer, lässt sich aber trotzdem irgendwie weiter zerren. Auf der Liste der Sieger steht tatsächlich ein Morin, Bäcker, mehr ist nicht bekannt. Kaum ist er auf dem Gipfel des Turms erschienen, verschmilzt er schon mit dem Himmel. Unter ihm auf der Liste steht ein anderer Morin, Schuhmacher. Vielleicht einer seiner Brüder. Er war dreißig Jahre alt. Er kam aus Énoque, einem Dorf, dessen vermutlich falsch verstandener oder vielleicht auch nur falsch geschriebener Name uns von breiten Strömen oder guten Patriarchen träumen lässt. Doch auch er wird jenseits seines winzigen Lebenslaufs vom Dunkel verschluckt.
Und jetzt stelle ich mir Delorme vor, den Schwarzen, mitten in der Menge, er stürmt die Bastille. Auch er rennt, verirrt sich in den Gängen, dringt in die Gefängnisse ein. Der Qualm der Karren, die immer noch brennen, steigt hoch bis zu den Türmen. Aus den spärlichen Fenstern des Gebäudes schnellen Köpfe wie Springteufel aus ihrer Schachtel. Unten versammeln sich Männer aus sämtlichen Vorstädten. Die Sonne kommt wieder hervor. Die Gesichter brennen, die Kleider sind verdreckt. Man kennt sich nicht mehr. Es ist zu schön. In den Gärten ächzen die Büsche unter ihrem staubigen Mantel. Der Wind peitscht die Bäume. Gott, wie schön sie ist, die Welt von oben betrachtet! Wind kommt auf. Der Himmel fällt. Im Hof liegen Leichen. Wie schön ein Gesicht doch ist! So viel schöner als die Seite eines Buchs, allenthalben flammen Gefühle auf und erlöschen wieder. Aber die Toten sind traurig, beängstigend. Achtundneunzig Tote und unzählige Verletzte liegen auf improvisierten Tragen, auf den Tischen der umliegenden Kneipen oder auf den Steinbänken der Kirchen. Nur ein paar Namen sind überliefert, kleine Fragmente fossilen Lebens: Begart, Boutillon, Cochet, Foulon, Quentin, Grivallet, Poirier, David, Falaise, Rousseau, Gouri, Ézard, Desnous, Courança, Blanchard, Levasseur, Sagault, Bertrand. Essaras, Aufrère, Renaud, Gomy, Dusson und Provost.
Die Todesfälle von Flesselles, Vorsteher der Kaufmannschaft, der im Hôtel de Ville thronte, und von de Launay, Kommandeur der Bastille, die das Volk noch am selben Abend lynchte, sind indes umfassend dokumentiert. Zum Tod des Kommandanten gibt es das Verhör des Kochs François Desnot. Zu dem von Flesselles die schriftliche Aussage des Totengräbers der Église Saint-Roch und einen Gerichtsbeschluss. Zu seinem Pech hat die Zeit noch weitere Beweisstücke aufbewahrt. Eine Erklärung des Direktors der Waffenfabrik in Charleville offenbart uns das Angebot von zwölftausend Gewehren, das er ihm am 13. Juli gegen vier Uhr nachmittags unterbreitet hatte, auf das der Bürgermeister von Paris allerdings nicht eingegangen war. Dabei verlangte das Volk am 14. den ganzen Tag lang nach Waffen, während der gute Vorsteher der Kaufmannschaft sie am laufenden Band versprach und bedauerte, keine zu haben. Dadurch verzögerte sich die Eroberung der Festung erheblich und forderte zahlreiche Tote.
Damit das Maß aber wirklich voll wird, nehmen wir noch diesen Brief von der Maison du Roi, der am 11. Dezember 1789 der Marquise de Launay in Anbetracht des von ihr am 14. Juli erlittenen Unglückes und Verlustes die Auszahlung einer Rente von dreitausend Pfund zusichert. Im Falle Flesselles’ existiert außerdem ein Siegelungsprotokoll für sein Stadtpalais in der Rue Bergère und für sein Schloss im Marais, was uns einen kleinen Eindruck von dem vermittelt, was er verlor, als er seinen Geist aushauchte. Und zur äußersten Beklemmung derer, die nicht das Glück haben, in Gnaden zu stehen, wäre da noch die Entscheidung des Königs, die am 6. März 1792 der Witwe des Vorstehers der Kaufmannschaft eine Gratifikation von viertausend Pfund zubilligen sollte, in Anbetracht ihrer traurigen Stellung.

Acht Monate später, am 23. März 1790, gegen acht Uhr morgens, verlässt Marie Bliard die Rue des Noyers bei der Place Maubert; es ist kalt, sie hat sich ein Tuch um die Schultern gelegt. Sie geht an Saint-Séverin vorbei und über den Pont Saint-Michel, spricht dann in der Amtsstube des Kommissars Duchauffour, Rue Saint-Louis, in der Nähe des Gerichts vor. Gewiss haben sich die Kommissariate seither verändert, doch eine gewisse Familienähnlichkeit bewahren sich die Institutionen, eine Lebensart und Folklore. Man hieß sie auf einer schäbigen Bank warten. Die Zeit wurde ihr lang. Über dem Empfangstresen bröckelte der Gips, eine Ordonnanz döste auf ihrem Stuhl.
Endlich rief man nach ihr, sie war an der Reihe. Man führte sie in ein kleines Büro, wo ein dicker Kerl sie aufforderte, Platz zu nehmen. Er trug ein zerschlissenes, schmuddeliges und löchriges Amtskleid aus schwarzem Serge. Das war der Schreiber. Er bat sie, Namen, Vornamen und Stand anzugeben, dann fragte er sie nach dem Zweck ihres Besuchs. Sie begann, in ihrer Klatschweibersprache, die Geschichte ungeordnet, sprich nach ihrer eigenen Ordnung zu erzählen. Sie erzählte ihr Leben und kam dann auf jenen Dienstag, den 14. Juli, zu sprechen, denn der Herr wurde ungeduldig. Sie berichtete von ihrem Gefährten, François Rousseau, Laternenanzünder. Er war ein guter Mann, sie konnte sich nicht beklagen. Er hatte sich morgens, am Tag des Sturms auf die Bastille, in den Faubourg Saint-Antoine aufgemacht. Da schiebt der Schreiber seine Augengläser hoch und unterbricht sie. Er will wissen, was ihr Mann dort bei der Bastille gewollt habe; hatte er vorgehabt, sich den Aufständischen anzuschließen? Ein Schatten gleitet am Fenster vorüber. Marie Bliard weiß nicht recht, was sie antworten soll; plötzlich fühlt sie sich unwohl in der Amtsstube des Kommissars. Sie stammelt. Ihr Mann habe eine Besorgung im Faubourg erledigen müssen, man habe ihr gesagt, dass er im Hof der Festung gewesen sei, vielleicht mitgerissen von der Menge, oder um zu schauen, was vor sich ging; seitdem hat sie ihn nicht mehr gesehen.
Der Schreiber öffnet eine Mappe. Stille. Er blättert durch eine Akte. Marie Bliard rührt sich nicht, als gälte es, unbeweglich zu bleiben, keinen Laut zu machen, keine Bewegung, sich totzustellen, während der Herr ihre Eingeweide inspiziert. Immer wieder schiebt er seine Brille hoch und runter, dann hebt er die Nase und fragt in einem kühlen und gedehnten Tonfall, weshalb sie jetzt erst komme. Sie weiß es nicht; sie habe unlängst erfahren, dass es vielleicht eine Rente gebe. Seit dem Verschwinden ihres Mannes sei das Leben nicht einfach, eine Unterstützung wäre willkommen.
Die Angelegenheit wird keinen müden Groschen einbringen, der Schreiber hat folglich keine Zeit zu verlieren. Er lässt sie einen Moment alleine. Sie legt ihre geschlossenen Fäuste auf die Knie, sie rührt sich nicht mehr. Im Hof bellt ein Hund. Sie hört, wie sich Türen öffnen und schließen. Dann kommt der Schreiber zurück; er hält ein Blatt Papier in der Hand, sie bemerkt, dass seine Fingernägel voller Tinte sind. Er erklärt, es handele sich um ein Protokoll aus dem vergangenen Jahr; gegen neun Uhr abends, am 14. Juli, hätten drei Individuen zwei Leichen zum Châtelet gebracht. Auch sie hätten behauptet, just als die Zugbrücke nachgab, von der Menge in die Cour du Gouvernement gedrängt worden zu sein. Dort hätten sie zwei Tote gesehen und sie zuerst zum Hôtel de Ville, dann zum Châtelet gebracht.
Die drei Individuen heißen Jacques Collinet, Hutmacher, wohnhaft Rue Saint-Nicolas, Giles Droix, Hutmacher, wohnhaft Rues de Filles-Dieu, und Jean Varenne, Papierdrucker aus der Petite rue de Reuilly. Der Schreiber schaut über seine Brille; kannte Ihr Mann sie? Sie hat keine Ahnung. Der Schreiber fährt fort: Die erste Leiche, die sie im Châtelet ablieferten, ist ein kleiner kahlköpfiger Mann mit einer wollenen grauen Hose, klobigen Schuhen, einem grobem Stoffhemd, einer olivgrünen Tuchjacke und einer weißen Baumwollweste. Er hatte eine breite Wunde in der Seite, der Daumen der rechten Hand war abgerissen. Die Beschreibung war trocken und technisch, und dennoch ahnte Marie Bliard eine Silhouette, die unter den dunklen Gewölben des Châtelet lag, einen kleinen toten Körper, dem diese Meldung letztendlich so etwas wie ein heimliches Leben verlieh. Der Schreiber zwirbelte seinen Schnurrbart und sagte, der Mann sei identifiziert worden und heiße Falaise. Dann kam er auf die andere Leiche zu sprechen. Marie Bliards Herz begann zu klopfen. Männlichen Geschlechts, ungefähr fünfundvierzig Jahre alt. Bekleidet mit gerippten grauen Wollstrümpfen, einer weißen Hose. Und da hörte sie nichts mehr, das Inventar versank in der Stille, in einem erbärmlichen Summen. Es war, als würde ihr gesamtes vergangenes Leben heruntergebetet, die zwanzig Jahre, die sie mit ihrem Mann verbracht hatte, ihr armseliges Leben in der Rue des Noyers, die Arbeit, das kleine, früh verstorbene Kind, die Probleme, die winzigen Glücksmomente, die Spaziergänge in Les Porcherons – all das wurde gerade mit monotoner Stimme portioniert, als wollte man es ihr auf diese Weise entziehen. Sie erinnerte sich an die Strümpfe, die sie gestrickt, und an die Hose, um die sie auf den Misères am Seine-Ufer gefeilscht hatte, an die Schuhe, die notdürftig mit alten Schnüren zusammengehalten wurden, an die graue Wolljacke, das beim Trödler aufgestöberte Baumwolltaschentuch und an den Hauptschlüssel, den François immer in der Tasche trug. Je länger der Schreiber sein Gedicht rezitierte – weiße Tuchweste, Hut mit Band, grobes Stoffhemd –, desto stärker entfernte sich François Rousseaus wirklicher Körper, ging in etwas anderem auf. Es war nicht einmal mehr eine Leiche oder ein Name, er wurde zu einem Objekt, ein paar Zeilen in einem Verzeichnis, etwas, das man einordnen und erfassen wollte, um es aus der Welt zu schaffen. Sie schaute aus dem Fenster und sah nichts, nichts, nur die Mauer gegenüber und die Ordonnanz, die hinten im Hof rauchte. Und dann kam der Schreiber ohne Unterbrechung von den Kleidern auf die Verletzungen, als gehörte das zu derselben Aufstellung, als bestünde kein Unterschied zwischen einem alten Taschentuch und einer tödlichen Wunde, zwischen einer Weste, die man zu den Lumpen wirft, und einem leblosen Körper, der auf einer schwankenden Bahre in das Leichenschauhaus im Châtelet befördert wird.
Die Kugeln waren ihm quer durch den Hals gegangen. Mehr gab das Protokoll nicht zur Auskunft. Plötzlich sah sie das Blut auf der Wunde. Sie meint es sehen, meint es spüren zu können. Ihr Kragen schnürte ihr allmählich den Hals ab, und sie rückte ihre Haube zurecht, die ihr in die Stirn schnitt. Sie nestelte an einem Zipfel ihrer Schürze. Der Schreiber hatte nach seiner Feder gegriffen und sie in die Tinte getaucht. Er machte sich nicht die Mühe, ein neues Blatt zu verschwenden, sondern begann, am Rand des ersten Protokolls eine schmale Spalte auszufüllen. Blitzschnell brachte er merkwürdige Schlangenlinien zu Papier. Sie hörte seinen Fingernagel auf dem Papier knirschen. Es war ein kleiner rundlicher Mann mit aschgrauem Haar. Seine Tinte war tiefschwarz, und wie fein war seine Schrift! Sobald er das Datum und vor uns, dem Königlichen Rat abgeschrieben hatte, kritzelte er etwas, strich drei Wörter durch und wirkte verstimmt. Er setzte neu an: ist erschienen Marie Jeanne Bliard, Witwe von François Rousseau, Laternenanzünder, wohnhaft in Paris, Rue des Noyers Nr. 17. Und plötzlich gefror alles. Ihr eigener Name, der von François, sein Beruf als Laternenanzünder, ihre möblierte Wohnung waren mit einem Federstrich ihrer Eingeweide entleert und beraubt worden. Nur noch die Wörter waren übrig: Witwe, Laternenanzünder, wohnhaft. Die Maschine ratterte weiter, welche zur Auskunft gegeben hat, dass am 14. Juli, Tag des Sturms auf die Bastille, und während der Schreiber ihre Worte übertrug, wurden sie von einer obskuren Sprache gepackt, zerhackt, zersägt und von allem Leben gesäubert. Es war nicht mehr François, der getötet worden war; es war jemand anders, den sie nicht kannte. Und nun kam der schicksalhafte Moment, die Wörter des Schreibers gingen langsam die kalten Treppenstufen hinunter, man hörte seine kurzen knappen Schritte auf den Steinplatten. Dann blieb er stehen, holte Luft, hob das Leichentuch an und leierte beim Schreiben jede einzelne Silbe herunter: das zwei-te In-di-vi-du-um, dessen Lei-che; in diesem Moment blieb Marie Bliard das Herz stehen; es kam ihr vor, als wäre der Raum unermesslich groß und im nächsten Moment winzig klein, als läge das Wort Leiche dort auf dem Tisch, zwischen den Papieren. Sie spürte einen tiefen Kummer in sich aufsteigen; sie dachte an das kleine Mädchen, das sie miteinander gehabt hatten und das ebenfalls tot war; und sie fühlte sich auf einmal unendlich einsam, so einsam wie Marie Jeanne Bliard, Witwe von François Rousseau, Laternenanzünder, wohnhaft in Paris, Rue des Noyers Nr. 17, sie fühlte sich so einsam wie der leblose Körper eines Laternenanzünders im Leichenschauhaus des Châtelet, und es war ihr, als befände sich nun alles, was sie geliebt hatte, in diesem Protokoll und würde für immer dort bleiben, in ein paar trockenen Zeilen, auf die Schnelle hingeworfen von einem Polizeikommissar. Sie schauderte. Ihre Lippen wurden steif. Sie hob den Kopf und starrte angestrengt auf den Mann, der ihr gegenübersaß. Er sah sie nicht. Er schrieb.
Regen aus Papier
Es wird dunkel. Zahllose Mengen klettern auf die Türme der Bastille. Man bleibt stumm, sprachlos. Der Himmel bedrückt uns nicht mehr. Canivet sitzt rittlings auf der Brüstung, schweigend im Angesicht der Leere. Der Junge will die Seine sehen, den schwarzen Strom. Er versucht, einzelne Bauwerke zu erkennen, zeigt mit dem Finger auf Saint-Eustache, Saint-Gervais; ist das da Sainte-Geneviève?, fragt er. Die Höhe berauscht und betäubt. Alles liegt dort vor ihm, das Gewirr aus Straßen, Krümmungen, dunklen, in den Fels gegrabenen Adern. Er sieht alles, aber erkennt nichts, wie Moses auf seinem Berg. Rinnsale laufen über sein Gesicht. Paare beugen sich herab, ein paar junge Leute suchen den Nervenkitzel und rangeln ein bisschen. Man liebt sich, küsst sich auf den Mund. Die Frauen lösen ihr Haar. Und hier, die Lichter der Courtille! Und da, die von der Butte aux Cailles! Aber im Grunde bewundern sie nicht die Bauwerke, sind es nicht die Prachtbauten, nach denen sie in der Dunkelheit gierig Ausschau halten; sie sind kaum zu erahnen, eine Kuppel, ein Glockenturm, eine Turmspitze; nein, was sie entdecken, was sich ihnen auf einmal darbietet, sind die verschachtelten Dächer, die unregelmäßigen Fassaden, ein Gespinst undurchdringlicher Gassen, ein Wald aus Schornsteinen und Dachgauben, ihre Stadt; diese Stadt ist es, die sie entgeistert betrachten, jene Stadt, die sie mit eigenen Händen erbaut haben. Und man lacht, noch und nöcher, feuert ein paar Schüsse in die Luft; jeder berichtet, was er gesehen hat, ständig wiederholt man die gleichen Begebenheiten, kurze Augenblicke des Heldentums oder der Panik. Tausende von Berichten knistern, kreisen und erblühen. Als Rossignol endlich abwärts will, kann er nicht, denn die Woge drängt unaufhörlich nach oben, die Leute streben immer weiter empor, als hätte sich auf dem Gipfel der Festung ganz Paris verabredet.
Und dann plündert man alles. Unverzüglich beginnt die Zerstörung der Bastille. Man wälzt die Steine in die Leere; oben wird an den Türmen gesägt und genagt. Binnen weniger Stunden ist alles ramponiert. Die Möbel werden über Bord geworfen, die Kleider zerrissen, die Spiegel zertrümmert, alles wird zerstört und geplündert. Wie gut es tut, abzureißen und zu verwüsten! Niemand denkt an morgen. Man will alles umkippen, wegwerfen, verwüsten, zunichte machen, zu Boden schmeißen! Und das ist ein Vergnügen, ein unerhörtes Vergnügen. Man kann die Miete nicht zahlen, zum Henker! Hier haben wir einen aufgeschlitzten Sessel, einen einbeinigen Tisch, einen einäugigen Spiegel, einen einarmigen Kerzenleuchter und einen Nachttopf voller Kot. Man hat nicht genug Zaster zum Futtern, zum Henker! Man tanzt barfuß, schnallt den Gürtel enger, es wird geknutscht und gepichelt. Feseleaux spielt in einer Zelle Karten; Lefebvre schleimt andächtig in einen Rotzlappen, den er sich vom Kommandanten geborgt hat; Chorier pinkelt aus dem Fenster; Navet ist mit Anproben beschäftigt, schlüpft in diverse Jacken, nimmt sich ein paar Hüte, stolziert vor dem Spiegel auf und ab, bewundert sich; Leroux veranstal...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Inhalt
- Die Folie Titon
- Die Tombe-Issoire
- Die Schulden
- Zu den Waffen greifen
- Schlaflosigkeit
- Zitadelle
- Paris
- Die Menge
- Ein Vertreter des Volkes
- Das Arsenal
- Die Zugbrücke
- Die Krankheit der Abordnung
- Ein Taschentuch
- Eine Leiche
- Ein Brett über dem Abgrund
- Die Seiltänzer
- Die Sintflut
- Regen aus Papier
- Impressum
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu 14. Juli von Éric Vuillard, Nicola Denis im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Literatur Allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.