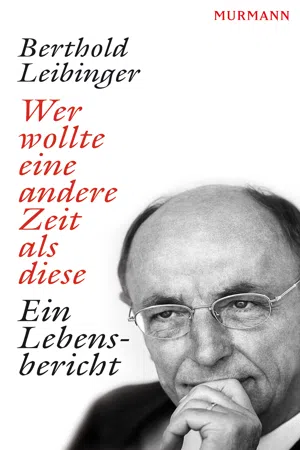Kammern und Verbände
Im Sommer 1984 erhielt ich einen folgenschweren Telefonanruf. Roland Klett, Gesellschafter des bekannten Schulbuchverlags in Stuttgart, zugleich Präsident der Industrie- und Handelskammer, wollte mich sprechen. Wir waren in unserem Klosterser Domizil, Klett mit seiner Familie in einem Klosterser Hotel. Er kam und bat mich, für sein Amt im kommenden Jahr zu kandidieren. Er sei ernsthaft und leider unheilbar erkrankt und müsse sich zurückziehen. Das Angebot war ehrenhaft, auch verlockend. Denn Einfluss auf die Stellung und das Ansehen der Wirtschaft zu haben und ihre Position im Dialog mit der Landesregierung mitbestimmen zu können reizte mich. Immer war ich der Überzeugung gewesen, dass Wirtschaften ein sinnvolles, ja kulturformendes Vorhaben sei, das dem Menschen zum Nutzen und Glück dienen könne. Just solches könne man als Kammerpräsident überzeugend vermitteln, meinte Roland Klett, und ich sei die geeignete Persönlichkeit dafür. Die Erfolge meines Unternehmens lieferten in den Augen von Klett und dem Kammerpräsidium die Legitimation. Die Zahlen waren in der Tat gut. In den vergangenen zehn Jahren war der Umsatz bei TRUMPF von 37 Millionen D-Mark auf über 100 Millionen D-Mark gestiegen. Das Umsatzwachstum war fast immer zweistellig, die Umsatzrendite auch. Ich war Mehrheitsgesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung. Wir hatten eine Reihe von Auslandstöchtern gegründet, unser weltweites Geschäft florierte. So gesehen stimmte das Konzept.
Aber meine Bindung an TRUMPF war enger denn je. Jeder Tag dort machte mir Freude. Ich besprach mich mit meiner Frau – die zögerlich zustimmte. Außerdem mit meinen Geschäftsführern, die keine großen Bedenken hatten, und mit meinem Betriebsratsvorsitzenden Horst Warthon, der fürchtete, dass zu viel meiner Kraft für die Firma verloren gehen könnte.
Dazu kamen ganz persönliche Bedenken. Roland Klett war ein glänzend aussehender, groß gewachsener Mann, ein vorzüglicher Redner, ein Meister der Sprache, begabt mit einem legendären Mutterwitz. Konnte ich ihm wirklich nachfolgen wollen? Ich wagte es und fasste den Vorsatz, nie den Versuch zu unternehmen, Roland Klett zu imitieren. Meine Stärken waren Ernsthaftigkeit und die Erfolge als Unternehmer. Ich hatte mich auch immer bemüht, ein Vorbild für meine Mitarbeiter zu sein. Überdies war ich bereit, für meine Überzeugungen, wie unsere Wirtschaft funktionieren solle, zu kämpfen.
Es gab eine wunderbare Amtsübergabe. Roland Klett hielt eine fulminante Rede, die er mit einem rednerischen Coup einleitete. Er habe, so sagte er, während er in seinem Manuskript kramte, tatsächlich die Liste mit den zu begrüßenden Ehrengästen vergessen und sage deshalb schlicht: »Meine verehrten Damen, meine Herren«. Ich sprach über meine liberalen Grundüberzeugungen zur Wirtschaftsordnung, über das Verhältnis von Staat und Wirtschaft – stark geprägt von Friedrich August von Hayek und Alexander Rüstow.
Verabschiedung des Amtsvorgängers Roland Klett als
Präsident der IHK Stuttgart am 17. April 1986.Der Leiter der Wirtschaftsredaktion der Stuttgarter Zeitung bat mich zu diesem Thema um ein Interview. Das nahm ich zum Anlass, meine Überzeugung zu äußern: Der Staat solle sich aus direkten Vorgaben für das wirtschaftliche Tun heraushalten, insbesondere im technischen Bereich. Es sei eine Vermessenheit, aus politischer Sicht technisch-wissenschaftliche Entwicklungen auszuwählen und die einen als besonders zukunfts- und förderungswürdig zu bezeichnen, andere aber zu verwerfen. Die Wirtschaft werde von vielen betrieben, die vielerorts ihr eigenes Geld einsetzten. Einzelne würden dabei durchaus Fehler machen, aber die Summe der Irrtümer sei kalkulierbar kleiner als bei einsamen Entscheidungen mächtiger Staatslenker. Der Staat solle gute Bedingungen für gutes Wirtschaften schaffen. Damit habe er genug zu tun.
Das Interview trug mir eine Einladung von Lothar Späth, dem damaligen Ministerpräsidenten, in sein Privathaus ein. Meine Frau war mit eingeladen, dazu ein Stuttgarter Freund mit seiner Frau. Späth, der sich für die Wirtschaft wirklich in der Verantwortung sah, von »seinen« Mittelständlern sprach und durchaus interventionistische Gedanken hatte, sah in dem Interview fast eine Kriegserklärung. Wir stritten den ganzen Abend – er offensiv, ich defensiv –, und meine Frau und ich fuhren missvergnügt nach Hause. »Dass du dir das antust«, meinte Doris.
Mit Lothar Späth kam ich später gut zurecht. Oft gab es konstruktive Gespräche mit ihm. Ich habe ihn auf etlichen Auslandsreisen begleitet und bewunderte seinen Einsatz und sein Werben für unser Land. Quirlig und ideenreich, produzierte er manchmal mehr Gedanken, als seine Umgebung in der Kürze der Zeit aufnehmen konnte. Manches geriet darüber in Vergessenheit. Dass er manchmal zu viel erwartet hat, wohl auch von mir, hat er später selbst gesagt. Aber sein Einsatz und seine Begeisterung, das Land voranzubringen, waren ansteckend. Immer war er bereit, Vorschläge, die ihm einleuchteten, aufzunehmen und sie pragmatisch umzusetzen. So bemühten wir uns gemeinsam, das neu zu gründende Institut für Lasertechnik der Fraunhofer-Gesellschaft nach Stuttgart zu holen – vergeblich, es ging nach Aachen. Dann initiierten wir eben einen Lehrstuhl für Lasertechnik an der Universität Stuttgart und gewannen einen Wissenschaftler als Ordinarius, Professor Helmut Hügel, der unser Laserprojekt mit der DFVLR begleitet hatte.
Es folgten Reisen nach Japan – mit der Geburtsstunde des ersten »Deutschen Hauses« in Fernost bei einem nächtlichen Gespräch, als wir mit dem Auto von Tokio nach Yokohama fuhren und ich Lothar Späth meine Idee vortrug, in Asien Sammelpunkte für die deutsche Wirtschaft zu errichten. Nach China, nach Singapur, aber auch nach Russland, Österreich und Italien reiste ich in Späths Delegation mit. Für mein Unternehmen blieb trotzdem genügend Zeit. Erfahrungen und Erkenntnisse aus meinen Auslandsbesuchen flossen in unser Tun ein. Die Gründungen der TRUMPF Vertriebstöchter in Fernost, in Korea, in China und in Singapur folgten diesen Reisen. Sie wären vielleicht auch ohne diese Reisen erfolgt, aber der Einsatz für das Gemeinwohl ist auch immer mit eigenem Gewinn verbunden.
In meine Amtszeit als IHK-Präsident fielen die Hundert-Jahr-Jubiläen von Daimler und Bosch. Ich wurde bei beiden Gelegenheiten gebeten zu sprechen. Von Bosch wurde ich vier Monate vor der Festveranstaltung angesprochen. Reihenfolge und Redezeit (sechs Minuten) waren exakt geplant. Inhaltlich hatte ich freie Hand, allerdings entstand darüber ein Disput mit meinem Hauptgeschäftsführer bei der Kammer. Denn dieser legte mir dringend nahe, auf die damals anstehende Spendenaffäre (CDU-Förderung durch die Wirtschaft), in die der Bosch-Chef Hans Ludwig Merkle verwickelt war, einzugehen. Dies wollte ich bei dem festlichen Anlass nicht tun.
Von Daimler erhielt ich einen Anruf, als ich schon beim Aufbruch zur morgendlichen Festveranstaltung im Neuen Schloss in Stuttgart war, mit der Bitte, eine kleine Rede bei der Übergabe der Goldenen Kammerplakette zu halten. Ich notierte ein paar Stichworte im Auto und sprach dann mit einigem Herzklopfen vor der Elite der deutschen Wirtschaft. Als ich nach der Rede wieder an meinen Platz zurückging – ich saß zwischen Hans L. Merkle und Hermann Josef Abs –, gratulierte man mir zu meinen Worten, vor allem, weil sie so spontan geklungen hätten. Spontan waren sie ja auch.
In der Kammer gab es interne Probleme: Meinen Vorgängern war es gelungen, die Kammern der angrenzenden Landkreise mit der Stuttgarter Kammer organisatorisch zusammenzufügen. Dadurch waren die Traditionen dieser Kammern und der Lokalstolz in höchstem Maße betroffen. Keineswegs warf man sich Stuttgart in die Arme, man behielt eine regionale Identität mit je einem eigenen Präsidenten, einer eigenen Vollversammlung, und man führte die Tradition eigener Veranstaltungen, Ausflüge und Empfänge mit Lust fort. Man sah die Vorteile der großen Kammer durchaus. Die Gesamtkammer war nach München die zweitgrößte deutsche Industrie- und Handelskammer, aber man wollte weiterhin sein eigenes Süppchen kochen. Schon gar nicht wollten die Bezirkskammern in Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg und Waiblingen unter dem Namen Stuttgart firmieren. Man wählte deshalb für die große Kammer die Bezeichnung »Industrie- und Handelskammer Mittlerer Neckar«.
Mir gefiel das überhaupt nicht. Warum nicht Stuttgart? Profitierten doch alle von der Kraft und dem Ruf dieser Stadt. Die Münchner Kammer firmierte ja auch nicht als Kammer Untere Isar. Hannover versteckte sich nicht hinter der Leine, und Pforzheim verzichtete auf den Hinweis, dass es an der oberen Würm liegt. Ich wollte die Industrie- und Handelskammer Stuttgart, aber besonders Esslingen und sein Präsident kämpften entschlossen gegen mein geschichtsvergessenes Ansinnen. Schließlich war Esslingen im frühen Mittelalter die wesentlich bedeutendere Stadt gewesen. Man erwog in der ehemaligen Freien Reichsstadt sogar eine Klage gegen die Stuttgarter Kammer. Der »Bürgerkrieg« konnte durch den Einfluss nüchtern denkender Esslinger schließlich vermieden werden. Einer meiner Helfer dort, Dr. Günter Baumann, wurde etliche Jahre später Präsident der großen Kammer. »IHK Region Stuttgart« hieß die Kompromissformel, auf die wir uns schließlich einigen konnten.
Hans-Peter Stihl, mein unmittelbarer Nachfolger in der Stuttgarter Kammer und langjähriger Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHT später DIHK), nahm den Begriff »Region Stuttgart« schließlich auf und entwickelte die Region Stuttgart zu einer politischen Institution auch für Fragen, die weit über Wirtschaftsinteressen hinausgehen.
Der VDMA und die Wiedervereinigung
Die Laseraufträge aus der DDR ließen auf sich warten. Planwirtschaft braucht Zeit. Lediglich das Kombinat »Fortschritt« bestellte zwei Laser. Wir verkauften aber unsere Serienmaschinen weiterhin gut.
Von der IHK Region Stuttgart wurde ich für weitere vier Jahre gewählt. Ungetrübte Freude war dies nicht. Nicht alles in der Kammer lief so, wie ich mir dies vorstellte. Das Verhältnis zu einigen Kammern blieb schwierig, auch die Zusammenarbeit mit meinem intelligenten, aber eigenwilligen Hauptgeschäftsführer Peter Kistner war nicht immer einfach. Dies konnte auch der konziliante und kunstsinnige stellvertretende Hauptgeschäftsführer Rainer Wilhelm in den vielen Beziehungen, die die Kammer hatte, nicht ganz ausgleichen.
Der Stuttgarter Präsident war auch ex officio Vorsitzender der Landesvereinigung aller Kammern in Baden-Württemberg. Diese Zusammenarbeit machte mir durchaus Freude. Es entstanden freundschaftliche Beziehungen zu den Präsidenten und den Geschäftsführern in Heilbronn, Heidenheim, Villingen-Schwenningen und in etlichen anderen Standorten. Aber meine Auftritte dort kosteten viel Zeit.
Alle wichtigen Reden verfasste ich selbst. Das habe ich mein ganzes Leben so gehalten. Plötzlich hatte ich doch zunehmend das Gefühl, in meiner Firma zu fehlen.
Im späten Frühjahr 1989 kam Bernhard Kapp, Kollege und Freund, Vorsitzender des VDW und im engeren Vorstand des VDMA, mit der Frage, ob ich nicht bereit wäre, Präsident des VDMA zu werden. Zweimal hatte man mich schon in früheren Jahren gefragt. Beide Male hatte ich aus Zeitgründen abgelehnt. Der VDMA, 98 Jahre alt, suchte für sein Hundert-Jahr-Jubiläum einen »passenden« Präsidenten. Er sollte möglichst ein Eigentümerunternehmer sein, mit einem erfolgreichen Unternehmen im Hintergrund. Reden sollte er auch können. Der VDMA sprach für mehr als 3000 Mitgliedsfirmen – meist mittelständischer Art mit insgesamt mehr als einer Million Beschäftigten – und vertrat die größte deutsche Industriebranche (nach Zahl der Beschäftigten) mit über 200 Milliarden D-Mark Umsatz.
Für einen leidenschaftlichen Maschinenbauer wie mich war diese Präsidentschaft die Krönung der beruflichen Laufbahn. Ich überlegte ernsthaft und lud den Präsidenten zu uns nach Hause ein. Dr. Frank Paetzold, Chef unseres guten Kunden Schlafhorst, kam zu einem Abendessen zusammen mit Dr. Justus Fürstenau, dem Hauptgeschäftsführer, in unser Privathaus. Die Herren waren ebenso sympathisch wie eloquent. Sie überzeugten sogar meine Frau, dass ich in diesem Fall nicht Nein sagen könne. Die Herren versicherten überdies, es werde eine ruhige und schöne Amtszeit werden. Dem Maschinenbau gehe es gut, größere politische Veränderungen seien nicht zu erwarten, lediglich eine weitere Stufe der Öffnung des EU-Binnenmarktes sei geplant. Und dann das Jubiläum zum hundertjährigen Bestehen 1992. Aber da werde man mir entsprechend helfen. Ich sagte zu, und wir vereinbarten, die Sache geheim zu halten. Noch war ich Präsident der IHK Region Stuttgart, und ein Doppelamt kam nicht in Frage. Ich wollte aber die Kammer weiterhin ordentlich führen und die Nachfolge klären, bevor ich meinen Rücktritt kundtat. Im September eröffnete ich dann dem sichtlich überraschten Präsidium der Kammer, dass ich zurücktreten wolle. Ich ließ mich aber überzeugen, das Amt noch sechs Monate weiterzuführen.
Ende Oktober 1989 erfolgte die Wahl zum VDMA-Präsidenten bei der glänzenden Mitgliederversammlung in München. Mit mir wurde ein neuer Hauptgeschäftsführer, Dr. Jürgen Zechlin, gewählt. Mit ihm verband mich von Anfang an eine kongeniale Partnerschaft. Hannelore Kohl warb im Damenprogramm für ihre Stiftung. Das Metier des Maschinenbaus ist durch ernsthafte Männer gekennzeichnet. Dem Damenprogramm kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Beim Abendessen fragte ich sie, ob ihr Mann wisse, was für eine gute Botschafterin sie für ihn sei? Da sei sie sich nicht sicher, meinte sie. Ich glaube, er wusste es aber doch.
Zwei Wochen später, am 9. November 1989, war ich bei der Verwaltungsratssitzung unserer schweizerischen Tochtergesellschaft in Baar. Am folgenden Morgen um sechs Uhr erhielt ich einen Anruf im Hotel von meinem Geschäftsführerkollegen Fetzer: »Schalten Sie doch den Fernseher ein. In der Nacht ist die Berliner Mauer gefallen!« Die Bilder der jubelnden Menschen waren überwältigend. »Dies ist ein historischer Tag«, sagte ich unseren Schweizern beim Frühstück, »noch vor sechs Monaten, beim Honecker-Besuch in Leipzig, konnte ich mir so etwas nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellen.« Ich war tief bewegt. Unsere Schweizer nahmen das Ganze mit der landesüblichen Gelassenheit auf. Für sie war es ein wichtiges Ereignis im Ausland. Freundliche Distanz neben meiner nationalen Aufgewühltheit.
Als neuer VDMA-Präsident 1990.Die VDMA-Präsidentschaft, die so gemächlich auf das Jubiläum zum Hundertsten zuführen sollte, war zwei Wochen nach meiner Wahl plötzlich eine dramatische Angelegenheit. Ich war noch nicht im Amt, als der erste Irak-Krieg begann. Die Iraki drohten, mit Raketen Israel zu beschießen. Deutsche Maschinenbauer wurden beschuldigt, Komponenten – zum Beispiel Flüssigkeitspumpen – an die Iraki geliefert und sie damit in die Lage versetzt zu haben, Mittelstreckenrake...