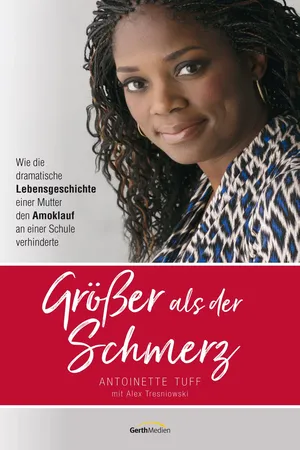Kapitel 1
Ich war mittlerweile ziemlich geübt darin, es so aussehen zu lassen, als hätte ich nicht geweint. Ich wusste, wie ich mich ziemlich schnell zusammenreißen konnte. Von meiner Scheidung hatte beispielsweise keiner meiner Mitarbeiter etwas mitbekommen, weil ich solche Probleme für mich behielt. Ich wusste also, wie ich so tun konnte, als sei alles in Ordnung: ein paar tiefe Atemzüge, ein paar letzte Seufzer und ich war wieder gefasst.
Nach dem verheerenden Anruf, den ich über mein Handy bekommen hatte, hörte ich das Telefon auf meinem Schreibtisch klingeln. Ich wusste, es war die Empfangsdame, die sich wunderte, wo ich blieb. Zehn Minuten war ich bereits zu spät. Ich sagte ihr, dass ich in einer Minute da sei. Ich wischte jegliche Beweise aus meinem Gesicht, die verrieten, wie ich mich fühlte, und machte mich auf den Weg zur Rezeption.
Doch eine der jungen Lehrerinnen, Belinda, fing mich direkt hinter der Bürotür ab.
„Frau Tuff, haben Sie eine Minute?“, fragte sie. „Ich könnte ein wenig Hilfe bei meinen verschiedenen Versicherungsformularen gebrauchen.“
„Klar“, sagte ich. „Ich muss nur die Rezeption besetzen. Kommen Sie mit.“
An der Rezeption unterhielt sich die Empfangsdame gerade mit einer Mutter. Belinda und ich beteiligten uns kurz am Gespräch. Nach ein paar Minuten ging die Empfangsdame zum Mittagessen. Die Mutter verabschiedete sich und ging ebenfalls.
In dem Raum befindet sich ein Schreibtisch, eine Theke, ein paar Stühle, ein Unterschriftenblatt und ein Monitor, auf dem die Empfangsdame sehen kann, wer vor der Tür steht und den Haupteingang öffnen kann, der nur ein paar Schritte von der Rezeption entfernt ist. Es ist ein kleiner, ganz gewöhnlicher Raum, der quasi als Schleuse dient. Von hier aus gelangt man zu jedem Raum der Schule, wohin man eigentlich möchte.
Ich setzte mich hinter den Schreibtisch, Belinda breitete ihre Papiere aus, und wir kümmerten uns um ihre Versicherung. Das gehört zu meinen vielen Aufgaben an der Schule. Meine offizielle Arbeitsplatzbeschreibung lautet Buchhalterin, doch in Wirklichkeit mache ich viel mehr, als Rechnungen zu bezahlen und Buch zu führen. Alles, was mit Dokumenten oder Formularen zu tun hat, landet für gewöhnlich auf meinem Tisch.
Belinda brauchte Hilfe dabei, ihre Sozialleistungen zu verstehen. Sie war noch nicht lange Lehrerin und gerade erst Mutter geworden. Ihr blieben noch dreißig Tage, um sich und ihr Neugeborenes in unserem Versicherungsprogramm zu registrieren, wofür sie meine Hilfe benötigte. Belinda war eine Freundin von mir, und ich hatte ihr dabei geholfen, die Anstellung an meiner Schule zu bekommen. Während wir ihre Papiere durchgingen, saß sie hinter der Empfangstheke, und ich stand neben ihr, und wir unterhielten uns ein wenig über ihren kleinen Sohn. Ich half ihr dann dabei, den richtigen Versorgungsplan für ihre Familie zu wählen. Zu diesem Zeitpunkt war alles ganz ruhig. Die meisten Schüler waren beim Mittagessen.
So gegen 12:45 Uhr, etwa fünf Minuten nachdem ich die Empfangsdame abgelöst hatte, ging die Tür der Rezeption auf.
Ich blickte auf und sah einen ganz in Schwarz gekleideten Mann vor mir: schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Schuhe. Er sah jung aus und irgendwie verärgert. Sein Mund war grimmig verkniffen und seine Augenbrauen waren hochgezogen. Er trug kurz geschnittenes braunes Haar und seine Nase sah aus, als sei sie irgendwann mal gebrochen worden. In seinen Händen hielt er ein schweres, langes schwarzes Gewehr – eine Hand lag am Lauf, die andere am Abzug. Das Gewehr war an einem Gurt befestigt, den er über seine Schulter gelegt hatte. Ich nahm all das ohne ein Gefühl der Angst wahr, denn mein erster Gedanke war: Ist das ein Scherz? Irgendein Junge, der mit einer Gewehrattrappe einen Streich spielt? Oder ist die Waffe echt und er will mir nur einen Schrecken einjagen? Dass die Situation dramatisch gefährlich war, fiel mir nicht sofort auf. Vermutlich gelang es mir nicht, das Szenario so schnell zu verarbeiten, wie ich es gerade vor mir sah.
Was alles veränderte, waren seine Augen. Sie sahen gestört, getrieben und unzurechnungsfähig aus. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Augen lügen nicht. Hätte sich jemand an diesem Tag ganz genau meine Augen angeschaut, wäre ihm klar geworden, dass ich geweint hatte. Und die Augen dieses Mannes offenbarten mir die Wahrheit darüber, was hier gerade geschah. Seine Augen waren weit aufgerissen und schienen irgendwie zu brennen. Dieser Mann meinte es nicht nur ernst, er meinte es todernst. Und plötzlich spürte ich das schreckliche Zusammensacken in meinem Magen, das nur entsetzliche Angst auslösen kann. Ich wusste, noch bevor er ein Wort sagte, dass ich in Schwierigkeiten war.
„Das ist kein Scherz!“, schrie er. „Ich will, dass Sie verstehen, dass das hier kein Scherz ist. Ich bin hier und das ist echt. Wir werden heute alle sterben.“
Er richtete seine Waffe auf Belinda und mich, während er diese Worte sagte, und machte mit dem Maschinengewehr deutlich, dass er nun die Kontrolle hatte. Die Waffe war alles, was er dazu brauchte, doch sein Schreien und Gefuchtel ließen meine Angst noch größer werden. Ich sah kurz zu Belinda rüber, sie drehte sich um und sah mich an. Ich sah Furcht und Panik in ihrem Gesicht. Und ich bin sicher, sie sah das Gleiche in meinem. Keiner von uns wagte, ein Wort zu sagen. Wir wandten uns wieder, still und geschockt, dem bewaffneten Mann zu.
„Hören Sie mir zu“, sagte er. „Ich will, dass Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Das hier ist kein Scherz. Das passiert wirklich.“ Er ging einen Schritt auf uns zu und sah Belinda direkt an. „Sie“, sagte er, „gehen Sie, und sagen Sie allen im Gebäude, dass ich hier bin. Sagen Sie ihnen, dass das kein Scherz ist und dass das tatsächlich passiert.“
Belinda sah mich an, so als wollte sie sagen: „Soll ich wirklich gehen?“ Ich sah ihr an, dass sie mich nicht allein zurücklassen wollte.
„Geh nur“, sagte ich laut. „Tu, was er sagt. Los, geh!“
Ich weiß nicht, warum der bewaffnete Mann Belinda wegschickte und nicht mich. Vermutlich werde ich das wohl nie erfahren.
Belinda wartete kurz und versuchte, sich zu beruhigen. Wenn sie genauso erschrocken panisch war wie ich, müssen sich ihre Beine wie Gummi angefühlt haben. Dann drehte sie sich auf dem Absatz um und schritt schnell aus dem Büro hinaus, durch eine Tür, die zum Lehrerzimmer führte. Es war Mittagszeit, deshalb hielten sich viele Lehrer darin auf, und durch die Wand konnte ich Belinda brüllen hören: „Eindringlingsalarm!“ Man hatte uns beigebracht, dieses Codewort zu verwenden, wenn wir ausdrücken wollten, dass es sich um ein echtes Sicherheitsproblem handelt.
Gleich im Anschluss, nachdem sie es ausgesprochen hatte, konnte ich Tische auf den Bodenfliesen rücken hören und Schritte huschen und den ganzen Tumult, der entsteht, wenn sich ein Raum leert. Dass der Bewaffnete das auch hören konnte, war klar. Ich sah ihn an und erkannte, dass das Geräusch ihn noch mehr aufregte. Er ging mit schnellen Schritten umher, so als könnte er seine Energie nicht unter Kontrolle halten, als wollte er schreien oder aus der Haut fahren. Stattdessen hob er sein Gewehr auf Augenhöhe und bewegte sich auf die Seitentür zu.
Die Seitentür ist die Tür, die zu den Klassenzimmern führt, in denen die Kinder sind.
„Was haben Sie vor?“, fragte ich. Es war das erste Mal, dass ich ihn direkt ansprach.
„Dieser ganze Krach!“, antwortete er. „Sagen Sie ihnen, sie sollen aufhören, sich zu bewegen!“
„Die tun ja nur, was Sie ihnen gesagt haben“, sagte ich. „Nur keine Sorge.“
Aber der Bewaffnete hörte nicht zu. Der Tumult verunsicherte ihn. Er öffnete die Seitentür und zielte mit seinem Gewehr den Gang entlang. Nur ein paar Schritte entfernt waren zwei Türen, die zum Medien-Zimmer führten, in dem Schüler Unterricht hatten, und weiter hinten ging es zu den Klassenzimmern für Zweit- und Drittklässler, und dahinter lagen die Klassenzimmer für Technik und Musik sowie die Mensa. Wahrscheinlich befanden sich auf dieser Etage allein zweihundertfünfzig Kinder. In den Klassenzimmern über und unter uns ungefähr weitere sechshundert. Wenn auch nur eines dieser Kinder gerade jetzt den Gang betrat, würde es unmittelbar in das Blickfeld des Bewaffneten geraten.
An dem Schützen vorbei sah ich plötzlich ein mir bekanntes Gesicht im Gang: Russ, ein Mitarbeiter der Schule. Auch er hatte die Rufe „Eindringlingsalarm“ gehört, während er auf dem Weg Richtung Medien-Zimmer war. Er war dabei, sich in Sicherheit zu bringen.
Der Bewaffnete erblickte Russ und legte sein Gewehr an. Er zielte auf ihn. Die Zeit schien still zu stehen. Er wird Russ töten, dachte ich, und anschließend die Kinder.
***
Gott sagt uns, dass wir die Kinder beschützen sollen, die Unschuldigen unter uns, weil Kinder Gottes besonderer Segen für die Welt sind. „Hütet euch davor, hochmütig auf die herabzusehen, die euch klein und unbedeutend erscheinen“, heißt es in Matthäus 18,10. „Denn ich sage euch: Ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel.“ Und in Markus 9,42 lesen wir: „Wer einem Kind etwas antut, für den wäre es noch das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden.“
Doch in der heutigen Zeit bleibt nicht jedem Kind Leid erspart, nicht jedes Kind wird beschützt. Wir machen unsere Kinder morgens für die Schule fertig und versuchen, nicht an den Terror und die Gefahren zu denken, in die sie geraten könnten. Wir versuchen, uns nicht das Monster vorzustellen, das aus der Dunkelheit tritt und bei helllichtem Tag das Leben eines Kindes zerstört. Aber wir wissen, dass es solche Monster gibt. Wir wissen, dass überall Gefahren lauern. Dann und wann sind Kinder in dieser gefährlichen Welt auf sich allein gestellt. Und manchmal fällt es ihnen auch zu, sich selbst zu verteidigen.
Mein Vater verließ meine Mutter, als ich zwei Jahre alt war. In den nächsten acht Jahren sollte ich ihn nicht einmal mehr zu Gesicht bekommen. Ich wusste nichts über ihn – wie er war, warum er uns verließ, wohin er gegangen war. Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass zu jedem Weihnachtsfest für mich per Post ein Päckchen kam. Ich öffnete das Geschenk von meinem Vater, lief schnell zu meiner Mutter, zeigte ihr die Puppe, das Spielzeug oder was sonst zu zeigen war, und sie sagte jedes Jahr: „Dein Papa denkt immer an dich. Du weißt ja, dein Papa liebt dich.“
Erst viele Jahre später erfuhr ich die ganze Wahrheit. Denn an einem Weihnachtsfest traf nur ein einziges Päckchen ein, das nicht nur an mich, sondern auch an meine beiden älteren Brüder Timmy und John adressiert war. Bis dahin hatte immer jeder von uns sein eigenes Päckchen bekommen. Dieses Mal war da aber nur eins. Wir öffneten es gemeinsam und darin befand sich ein Radio. Es war ein einfaches Radio, weder ein sonderlich gutes noch ein schlechtes, doch es waren keine drei Geschenksendungen, eine für einen jeden von uns, so wie wir das für gewöhnlich erwartet hatten.
„Was sollen wir damit anfangen?“, fragte mein Bruder Timmy meine Mutter.
„Freut euch einfach darüber“, sagte sie.
Ich meine, es war letztlich John, der zwei Jahre älter ist als ich, der schließlich herausbekam, dass es nicht mein Vater war, der uns die ganzen Jahre über diese Geschenke geschickt hatte. In Wirklichkeit war es unsere Mutter gewesen. Jedes Jahr kaufte sie drei Geschenke, packte sie in je eine Schachtel, trug sie zur Post, schrieb Vaters Namen in das Feld für die Absenderadresse und schickte sie an unser Haus in Alexandria, Virginia. Wenn wir schlau genug gewesen wären, uns die Poststempel anzusehen, hätten wir gesehen, dass die Spielzeuge ihre Reise am selben Ort begannen und beendeten. Doch wir waren nicht so schlau. Wir waren einfach nur froh darüber, überhaupt Geschenke von unserem lang verschollenen Vater zu bekommen. Wir waren froh, dass er noch an uns dachte. Selbst nachdem John unsere Mutter mit dem Schwindel konfrontiert hatte, weigerte sie sich weiterhin, die ganze Geschichte auszupacken.
„Darum müsst ihr euch keine Gedanken mach...