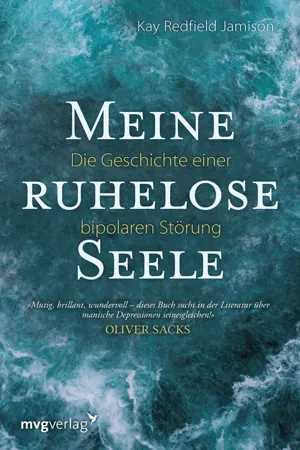
This is a test
- 208 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Angaben zum Buch
Buchvorschau
Inhaltsverzeichnis
Quellenangaben
Über dieses Buch
Dr. Jamison ist eine der führenden Experten auf dem Fachgebiet der bipolaren Störung – und kennt diese aus eigener Erfahrung. Zu Beginn ihrer Karriere als akademische Medizinerin erkannte sie, dass sie selbst die gleichen rauschhaften Höhenflüge und depressiven Tiefen durchlebte wie viele ihrer Patienten. Diese Krankheit trieb sie mal in den ruinösen Kaufrausch, mal in gewalttätige Phasen und schließlich in einen Selbstmordversuch. In diesem Buch beschreibt Jamison die bipolare Störung aus zwei Sichtweisen – der der Heilerin und der Geheilten. Meine ruhelose Seele besticht durch Offenheit, Ehrlichkeit und Weisheit. Ein kraftvolles Buch mit dem Potenzial, Leben zu retten und zu verändern.
Häufig gestellte Fragen
Gehe einfach zum Kontobereich in den Einstellungen und klicke auf „Abo kündigen“ – ganz einfach. Nachdem du gekündigt hast, bleibt deine Mitgliedschaft für den verbleibenden Abozeitraum, den du bereits bezahlt hast, aktiv. Mehr Informationen hier.
Derzeit stehen all unsere auf Mobilgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Mit beiden Aboplänen erhältst du vollen Zugang zur Bibliothek und allen Funktionen von Perlego. Die einzigen Unterschiede bestehen im Preis und dem Abozeitraum: Mit dem Jahresabo sparst du auf 12 Monate gerechnet im Vergleich zum Monatsabo rund 30 %.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja, du hast Zugang zu Meine ruhelose Seele von Kay Redfield Jamison im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychologie & Angewandte Psychologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
TEIL II
Kein schöner Wahn
Fluchten der Seele
Diese Spielart des Wahnsinns hat mit ganz bestimmten Qualen, ganz bestimmten Hochstimmungen, Einsamkeits- und Angstgefühlen zu tun. Im Zustand der Euphorie fühlt man sich fantastisch. Ideen und Wahrnehmungen tauchen so schnell und häufig auf wie Sternschnuppen, und man verfolgt sie, bis man auf noch bessere, glänzendere stößt. Man verliert seine Scheu, hat plötzlich im richtigen Augenblick die richtigen Worte und Gesten parat, lebt in der Überzeugung, andere in seinen Bann ziehen zu können. Uninteressante Menschen kommen einem interessant vor. Überall herrscht Sinnlichkeit; das Verlangen, zu verführen und verführt zu werden, ist unwiderstehlich. Gefühle von Leichtigkeit, Intensität, Kraft, Wohlbefinden, finanzieller Allmacht und Euphorie durchdringen einen bis ins Mark. Aber an irgendeinem Punkt schlägt alles um. Die schnellen Ideen sind plötzlich zu schnell – und es sind viel zu viele; eine überwältigende Verwirrung verdrängt die Hellsicht. Das Erinnerungsvermögen schwindet. Der heitere, entzückte Gesichtsausdruck der Freunde verwandelt sich in Angst und Besorgnis. Während einem zuvor alles entgegenkam, geht einem nun alles gegen den Strich: Man ist reizbar, wütend, verängstigt, unbeherrscht und in den dunkelsten Verliesen der Seele gefangen. In Verliesen, von deren Existenz man vorher nichts ahnte. Und das hört niemals auf, denn der Wahnsinn schafft sich seine eigene Realität.
Es geht weiter und weiter, und schließlich erinnern sich nur noch andere an dein Verhalten – dein absonderliches, ekstatisches, kopfloses Verhalten –, denn die Manie ist wenigstens darin gnädig, dass sie die Erinnerungen teilweise auslöscht. Und was kommt danach, nach den Medikamenten, nach dem Psychiater, nach der Hoffnungslosigkeit, der Depression, der Überdosis? All diese unglaublichen Gefühle, die man einordnen muss. Wer ist zu höflich, um über was zu reden? Wer weiß was? Was habe ich getan? Warum? Und die quälendste Frage von allen: Wann passiert es wieder? Dann gibt es auch die bitteren Mahnzeichen: die Medikamente, die man nehmen muss, die man verflucht, vergisst, nimmt, verflucht, vergisst und doch immer nehmen muss. Gesperrte Kreditkarten, geplatzte Schecks, die beglichen werden müssen, Erklärungen am Arbeitsplatz, Entschuldigungen, lückenhafte Erinnerungen (Was habe ich wirklich getan?), angeschlagene oder zerbrochene Freundschaften, eine gescheiterte Ehe. Und immer wieder die Frage: Wann passiert es wieder? Welche meiner Gefühle sind real? Welches ist mein eigentliches Ich? Das wilde, impulsive, chaotische, energiegeladene und verrückte? Oder das scheue, zurückgezogene, verzweifelte, selbstmordgefährdete, zum Scheitern verurteilte und erschöpfte? Vermutlich ein bisschen von beiden und hoffentlich viel von einem anderen, einem dritten. Virginia Woolf hat es bei ihren Talfahrten und Höhenflügen auf den Punkt gebracht: »Inwieweit beziehen unsere Gefühle ihre Farbe von unserem Sturzflug in den Abgrund? Ich meine, worin besteht die Realität jedes Gefühls?«
Es war nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht wäre und festgestellt hätte: Ich bin verrückt. Wenn das Leben so einfach wäre. Nein, mir wurde ganz allmählich klar, dass mein Leben und mein Geist sich in einem immer größeren Tempo bewegten, bis schließlich beides im Lauf meines ersten Sommers an der Fakultät vollkommen außer Kontrolle geriet. Aber die Steigerung vom schnellen Denken zum Chaos vollzog sich langsam und war verführerisch schön. Am Anfang erschien alles vollkommen normal. Ich begann meine Lehrtätigkeit und klinische Arbeit im Juli 1974 in der Psychiatrie, und zwar auf einer der Erwachsenenstationen. Meine Aufgabe bestand darin, Assistenzärzte der Psychiatrie und Praktikanten der klinischen Psychologie in Bereichen wie diagnostische Verfahren, psychologische Tests, Psychotherapie und – aufgrund meiner Erfahrungen in der Psychopharmakologie – in einigen Fragen der Erprobung und Anwendung von Medikamenten zu betreuen. Ich fungierte außerdem als Bindeglied zwischen den Abteilungen Psychiatrie und Anästhesiologie, wo ich beratend tätig war, Seminare hielt und Forschungsarbeiten zu den psychologischen und medizinischen Aspekten des Schmerzes initiierte. Meine eigene Forschung bestand in erster Linie in der Ausarbeitung einiger Untersuchungen über Psychopharmaka, die ich bereits während meines Studiums begonnen hatte. Ich hatte kein besonderes Interesse daran, mich klinisch oder wissenschaftlich mit seelischen Störungen in Form von Stimmungsschwankungen zu befassen, und da ich schon über ein Jahr lang keine ernsthaften Stimmungsumschwünge mehr durchgemacht hatte, war ich der Meinung, ich hätte dieses Problem ein für alle Mal hinter mir. Wenn man sich über einen so langen Zeitraum normal fühlt, dann macht man sich natürlich Hoffnungen – die allerdings in fast allen Fällen enttäuscht werden.
Ich stürzte mich mit großer Begeisterung und Energie in meine neue Arbeit. Ich genoss es zu unterrichten, und obwohl es mir anfänglich merkwürdig vorkam, andere in ihrer klinischen Arbeit anzuleiten und zu überwachen, machte mir auch das Spaß. Der Übergang von der Praktikantin zum Mitglied des Lehrkörpers fiel mir leichter, als ich mir vorgestellt hatte. Natürlich wurde mir dieser Schritt auch durch ein erhöhtes Gehalt versüßt. Die relative Freiheit, die ich hatte, um meine eigenen wissenschaftlichen Interessen zu verfolgen, wirkte stimulierend auf mich. Ich arbeitete sehr viel und schlief – wie mir im Rückblick bewusst geworden ist – sehr wenig. Wenig Schlaf ist sowohl ein Symptom als auch eine Ursache der Manie, aber das wusste ich damals noch nicht, und hätte ich es gewusst, hätte es auch keinen Unterschied gemacht. Der Sommer hatte mir schon immer längere Nächte und beschwingtere Stimmungen als gewöhnlich beschert, aber diesmal führte er mich in weit höhere, viel gefährlichere und psychotischere Regionen als jemals zuvor. Die Sommerzeit, der Schlafmangel, der riesige Berg Arbeit und eine höchst anfällige Erbanlage trieben mich schließlich über die Grenze, über das mir vertraute Maß an Überschwang hinaus – geradewegs hinein in den Wahnsinn.
Jedes Jahr gab der Dekan zur Begrüßung der neuen Fakultätsmitarbeiter der UCLA ein Gartenfest. Zufällig war der Arzt, der später mein Psychiater werden sollte, auch auf der Party – er hatte gerade seine Stelle an der angegliederten medizinischen Fakultät angetreten. Unser Zusammentreffen erwies sich als interessantes Beispiel für den Unterschied zwischen der Selbstwahrnehmung und den nüchternen Beobachtungen eines erfahrenen Klinikers, der sich bei einem offiziellen Anlass plötzlich einer quirligen ehemaligen Assistentin gegenübersieht, die er im Jahr zuvor als Supervisor betreut hatte. Nach meiner eigenen Erinnerung war ich damals vielleicht etwas aufgedreht, aber in erster Linie unterhielt ich mich mit vielen Leuten, wobei ich mir unwiderstehlich vorkam, von einem Häppchen-Tablett zum nächsten schwirrte und ein Glas nach dem anderen leerte. Ich plauderte eine ganze Weile mit dem Dekan; der hatte natürlich keine Ahnung, wer ich war, aber er war entweder außerordentlich höflich, dass er sich so lange mit mir unterhielt, oder aber er machte seinem Ruf, eine besondere Schwäche für junge Frauen zu haben, alle Ehre. Was auch immer der Grund gewesen sein mag – ich war der festen Überzeugung, dass er mich einfach unwiderstehlich fand.
Ich hatte auch ein längeres und recht merkwürdiges Gespräch mit dem Leiter meiner Abteilung – aber ich fand es ganz bezaubernd. Er war selbst ziemlich mitteilsam und hatte eine Menge Fantasie, die sich nicht immer in den üblichen Bahnen der akademischen Medizin bewegte. Wegen einer ziemlich unwahrscheinlichen Geschichte war er in psychopharmakologischen Kreisen berüchtigt: Er soll einmal aus Versehen einen ausgeliehenen Zirkuselefanten mit LSD getötet haben. Und so diskutierten wir ausführlich über Elefanten und Schliefer als Forschungsobjekte. Schliefer sind kleine in Afrika lebende Tiere, die zwar keinerlei Ähnlichkeit mit Elefanten aufweisen, aber aufgrund ihrer Gebissstruktur für deren engste noch lebende Verwandte gehalten werden. Die einzelnen Argumente und die dieser seltsamen und äußerst angeregten Unterhaltung zugrunde liegenden gemeinsamen Interessen sind mir nicht mehr gegenwärtig, aber ich kann mich erinnern, dass ich es mir sofort und mit großem Vergnügen zur Aufgabe machte, sämtliche jemals über Schliefer geschriebene Artikel – es waren Hunderte – aufzuspüren. Außerdem erbot ich mich, Untersuchungen über Tierverhalten im Zoo von Los Angeles durchzuführen und einen Kurs in Ethologie und noch einen anderen in Pharmakologie und Ethologie zu halten.
In meiner Erinnerung an das Gartenfest verlebte ich einen herrlichen, spritzigen, bezaubernden Abend, an dem ich mich sehr selbstsicher fühlte. Als ich mich später mit meinem Psychiater darüber unterhielt, stellte sich heraus, dass er alles ganz anders in Erinnerung hatte. Er sagte, ich sei ziemlich aufreizend gekleidet gewesen, ganz im Gegensatz zu der konservativen Aufmachung, in der er mich während des gesamten vorangegangenen Jahres erlebt habe. Ich sei viel stärker geschminkt gewesen als gewöhnlich und ihm exaltiert und zu redselig vorgekommen. Er wisse noch, dass er damals schon bei sich gedacht habe: Kay wirkt irgendwie manisch. Ich hingegen hatte mich für besonders brillant gehalten.
Mein Geist hatte allmählich Mühe, mit sich selbst Schritt zu halten, denn die Gedanken folgten einander so schnell, dass sie sich auf alle mögliche Weise durchkreuzten. Auf den Verkehrsstraßen meines Gehirns gab es einen neuronalen Stau, und je mehr ich versuchte, meine Gedanken zu bremsen, umso mehr wurde mir bewusst, dass ich dazu nicht in der Lage war. Meine Anfälle von Begeisterung überschlugen sich ebenfalls, obwohl das, was ich tat, durchaus eine gewisse Logik hatte. Einmal geriet ich beispielsweise in einen Fotokopiertaumel: Ich machte jeweils dreißig bis vierzig Kopien von einem Gedicht von Edna St. Vincent Millay, von einem Artikel über Religion und Psychosen aus dem American Journal of Psychiatry und einem Aufsatz mit dem Titel »Why I Do Not Attend Case Conferences« [Warum ich nicht an Sitzungen teilnehme], der aus der Feder eines prominenten Psychologen stammte und die Gründe durchleuchtete, aus denen schlecht geleitete Diskussionsrunden die reinste Zeitverschwendung sind. Alle drei Artikel schienen mir ganz plötzlich eine tiefere Bedeutung zu haben und von größtem Interesse für das klinische Personal meiner Station zu sein. Also drückte ich sie jedem, der mir über den Weg lief, in die Hand.
Was mir heute daran interessant erscheint, ist nicht die Tatsache, dass ich so typisch manisch gehandelt habe, sondern eher die, dass es in diesen ersten Tagen meines beginnenden Wahnsinns eine Voraussicht und einen Sinn gab. Die Stationskonferenzen waren tatsächlich eine reine Zeitverschwendung, auch wenn der Stationschef alles andere als glücklich darüber war, dass ich diese Feststellung allen mitteilte (noch weniger beglückte ihn die Tatsache, dass ich den Artikel an das gesamte Personal verteilte). Das Millay-Gedicht, Renaissance, hatte ich schon als junges Mädchen gelesen, und als meine Stimmung immer ekstatischer wurde und mein Geist immer gehetzter, erinnerte ich mich plötzlich glasklar an dieses Gedicht und stöberte es auf. Ich stand zwar erst am Beginn meiner Reise in den Wahnsinn, aber das Gedicht beschrieb den kompletten Zyklus, den ich später durchmachen sollte: Es begann mit der normalen Wahrnehmung der Welt: »All I could see from where I stood / Was three long mountains and a wood«, durchlief anschließend ekstatische und visionäre Stadien bis hin zur absoluten Hoffnungslosigkeit, um schließlich wieder in die normale Welt einzutreten, jedoch auf einer höheren Bewusstseinsstufe. Mit neunzehn Jahren hat Millay dieses Gedicht geschrieben, aber danach noch zahlreiche Zusammenbrüche und Krankenhausaufenthalte erlebt, was ich damals allerdings nicht wusste. Irgendwie war mir trotz meines seltsamen Zustands klar, dass das Gedicht eine Bedeutung für mich hatte; ich verstand es Wort für Wort. Ich verteilte es an die Assistenzärzte und Praktikanten als eine literarische Beschreibung des psychotischen Prozesses und der wichtigen Möglichkeiten einer darauffolgenden Erneuerung. Die Assistenzärzte schienen sehr positiv auf die Artikel zu reagieren, ohne die interne Unruhe wahrzunehmen, die sie zu dieser Lektüre drängte; sie freuten sich, auch mal etwas anderes als die medizinischen Fachbücher zu lesen.
Während dieser Phase fieberhafter Arbeitswut zerbrach meine Ehe. Ich trennte mich von meinem Mann angeblich deshalb, weil ich Kinder wollte und er nicht – was natürlich ein wichtiger Punkt war –, aber in Wirklichkeit war die Sache sehr viel komplizierter. Ich wurde von einer zunehmenden Rastlosigkeit geplagt, war reizbar und gierig nach Abwechslung und Aufregung. Und ganz plötzlich begann ich, gegen die Eigenschaften zu rebellieren, die ich zuvor so sehr an ihm geliebt hatte: gegen seine Güte, seine Festigkeit, seine Wärme und Liebe. Ich wollte plötzlich ein neues Leben. Ich mietete eine hypermoderne Wohnung in Santa Monica, obgleich ich moderne Architektur verabscheute; ich kaufte moderne finnische Möbel, obwohl ich gemütliche, altmodische Dinge liebte. Alles, was ich kaufte, war cool, modern, eckig und wirkte, so vermute ich, irgendwie beruhigend auf meinen zunehmend chaotischen Gemütszustand und meine überreizten Sinne. Aber immerhin hatte ich eine überwältigende – wenngleich auch überwältigend teure – Aussicht auf das Meer. Die Verschwendung horrender Summen, die man gar nicht hat – oder, wie es bei den offiziellen Diagnosekriterien heißt, »die Tätigung hemmungsloser Großeinkäufe« –, ist ein Merkmal der Manie.
Wenn ich in Hochstimmung bin, könnte ich mich nie um Geld sorgen, selbst wenn ich es wollte. Also tue ich es nicht. Irgendwoher wird das Geld schon kommen; ich habe ein Recht darauf; Gott wird dafür sorgen. Kreditkarten sind verheerend und Schecks noch schlimmer. Unglücklicherweise ist die Manie – insbesondere für Manische – eine natürliche Erweiterung der Wirtschaft. Und mit einer Kreditkarte oder einem Bankkonto kann man eine ganze Menge erreichen. Ich kaufte zwölf Erste-Hilfe-Sets gegen Schlangenbisse in der Überzeugung, dass das notwendig und wichtig sei. Ich kaufte Edelsteine, elegante und absolut überflüssige Möbelstücke, innerhalb einer Stunde drei Uhren (wobei ich mich eher in Richtung Rolex als Timex orientierte) sowie Unmengen von aufreizenden Kleidungsstücken, die überhaupt nicht zu mir passten. Während eines Kaufrauschs in London gab ich mehrere Hundert Pfund für Bücher aus, deren Titel oder Cover mir irgendwie ansprechend erschienen: naturwissenschaftliche Bücher über Maulwürfe, zwanzig verschiedene Penguin-Books (weil ich den Gedanken lustig fand, eine Pinguin-Kolonie zu gründen). Ich glaube mich zu erinnern, dass ich einmal sogar eine Bluse gestohlen habe, weil ich es nicht abwarten konnte, bis ich an der Kasse endlich an der Reihe war. Vielleicht habe ich es mir aber auch nur vorgestellt, ich weiß es nicht mehr; auf alle Fälle war ich völlig verwirrt. Ich schätze, dass ich während meiner beiden heftigsten manischen Phasen weit mehr als dreißigtausend Dollar ausgegeben habe, und Gott allein weiß, wie viel mehr noch während meiner zahlreichen gemäßigteren manischen Anfälle.
Aber wenn man dann wieder unter Lithium steht, sich in demselben Tempo bewegt wie alle anderen Menschen auf unserem Planeten und feststellen muss, dass man nichts mehr auf dem Konto hat, ist die Bestürzung groß: Manie ist kein Luxus, den man sich so einfach leisten kann. Diese Krankheit bedeutet ein finanzielles Fiasko, und die Kosten für Medikamente, Blutuntersuchungen und Psychotherapie kommen noch erschwerend hinzu. Aber diese Ausgaben kann man wenigstens steuerlich absetzen, während die Unsummen, die man in einer manischen Phase unter die Leute bringt, in der Steuererklärung weder als krankheitsbedingte Sonderausgaben noch als Geschäftsverluste aufgeführt werden können. Und so hat man in den depressiven Phasen, die der Manie unweigerlich folgen, noch mehr Grund zur Niedergeschlagenheit.
Dass mein Bruder in Havard seinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften gemacht hatte, bereitete ihn in keiner Weise auf das Tohuwabohu vor, das er eines Tages in meiner Wohnung vor sich sah: stapelweise Kreditkartenabrechnungen, Berge von rosafarbenen Kontoauszügen meiner Bank (schon die Farbe verriet, dass sich das Konto im Minus befand) und die Durchschläge der Kassenbons aus den Geschäften, durch die ich zuvor in meinem Kaufrausch gewirbelt war. Auf einem gesonderten, noch unheilvolleren Stapel befanden sich die Mahnbriefe der Inkasso-Agenturen. Das sichtbare Chaos, das sich einem beim Betreten des Zimmers bot, spiegelte sozusagen die totale Verwirrung wider, die ein paar Wochen zuvor in meinem manischen Hirn geherrscht hatte. Jetzt, unter Medikamenten stehend und wieder auf dem Boden der Tatsachen, wühlte ich mich durch die Hinterlassenschaft meiner Verantwortungslosigkeit. Es war wie eine archäologische Grabung durch frühere Zeitalter meiner Seele. Da fand sich beispielsweise eine Rechnung von einem Tierpräparator aus The Plains, Virginia, für einen ausgestopften Fuchs, den ich aus irgendwelchen Gründen glaubte unbedingt haben zu müssen. Mein ganzes Leben hatte ich Tiere geliebt und wollte ja auch Tierärztin werden: Wie konnte ich bloß ein totes Tier kaufen? Füchse hatte ich geliebt und bewundert, solange ich denken kann. Ich mochte sie, weil sie so flink und klug und schön waren: Wie hatte ich nur so direkt zum Tod eines solchen Tieres beitragen können? Ich war entsetzt über diesen grässlichen Kauf, angewidert von mir selbst und konnte mir nicht vorstellen, was ich damals mit dem Fuchs vorgehabt hatte.
Um auf andere Gedanken zu kommen, fing ich an, mir meinen Weg durch die Kreditkartenabrechnungen zu bahnen. Ziemlich weit oben auf dem Stapel stieß ich auf die Quittung von der Apotheke, in der ich die Erste-Hilfe-Sets gegen Schlangenbisse gekauft hatte. Der Apotheker, der kurz zuvor mein erstes Lithiumrezept entgegengenommen hatte, lächelte nur wissend, als ich zwölf Schlangenbiss-Sets und diverse andere unsinnige Dinge kaufte. Ich glaubte zu wissen, was er in diesem Augenblick dachte, und in meiner überschwänglichen Stimmung nahm ich seinen Anflug von Humor wohlwollend zur Kenntnis. Er schien sich jedoch – im Gegensatz zu mir – der lebensbedrohenden Gefahr durch die Klapperschlangen im San Fernando Valley in keiner Weise bewusst zu sein. Gott hatte mich, und offenbar nur mich, dazu auserwählt, die Welt vor der wilden Vermehrung der Killerschlangen im Land der Verheißung zu bewahren.
So oder ähnlich waren meine verworrenen, wahnhaften Gedanken. Im Rahmen meiner beschränkten Möglichkeiten tat ich alles in meiner Macht Stehende, um mich und die mir Nahestehen...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort zur Neuauflage
- Prolog
- TEIL I
- TEIL II
- TEIL III
- TEIL IV