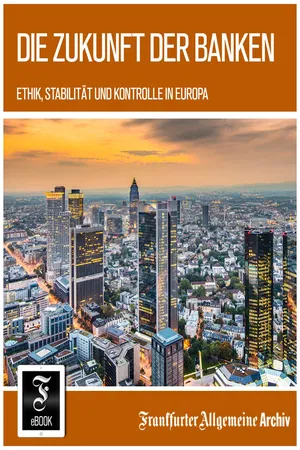Die erste Säule der europäischen Bankenunion steht
Weil die Abgeordneten mehr mitreden wollten, haben die EU-Parlamentarier die Entscheidung über eine europäische Bankenaufsicht in der Europäischen Zentralbank lange verzögert. Jetzt ist der Weg für das Vorhaben aber frei.
Von Werner Mussler
Die erste Säule der geplanten europäischen Bankenunion steht endgültig. Neun Monate nach der Entscheidung der EU-Finanzminister und sechs Monate nach deren vorläufiger Einigung mit dem Europaparlament billigte das Parlament in Straßburg endgültig das Gesetz über die Schaffung einer gemeinsamen Aufsicht über vermutlich 130 Großbanken des Euroraums unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB). Damit ist das Regelwerk deutlich später fertig geworden, als es die Vorgabe der EU-Staats- und Regierungschefs vom Juni 2012 ursprünglich vorsah. Diese hatten den Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bis Ende 2012 vorgesehen. Die Finanzminister hielten sich an diesen Zeitplan – sie erzielten unter großem Zeitdruck im Dezember einen Kompromiss.
Dass sich die Parlamentsabstimmung nun so lange hinzog, lag nicht am Inhalt des Regelwerks. Dieser hat sich seit den Ministerbeschlüssen kaum verändert: Die EZB übernimmt die direkte Aufsicht über Banken mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro. Unter ihre Aufsicht sollen daneben Banken fallen, deren Bilanzsumme ein Fünftel der Wirtschaftsleistung ihres Heimatlandes erreicht. Ferner sollen unabhängig von diesen Schwellenwerten die drei jeweils größten Institute jedes Teilnehmerlandes unter die neue europäische Aufsicht fallen. Die EZB erhält so die Zuständigkeit für etwa 130 Banken. Für die übrigen Institute sollen die nationalen Aufsichtsbehörden zuständig bleiben. Innerhalb der EZB soll die Aufsichtskompetenz so weit wie möglich von dem für die Geldpolitik zuständigen EZB-Rat getrennt werden. Das Aufsichtsgremium entscheidet mit einfacher Mehrheit. Die Entscheidungen des Aufsichtsgremiums sollen unmittelbar gültig sein, wenn der EZB-Rat keinen Einspruch erhebt.
Die Abgeordneten verzögerten die Abstimmung über das Gesetz immer wieder, weil sie bei der Bestellung des Spitzenpersonals der neuen Aufsichtsbehörde mitreden und über dessen Tun genau informiert sein wollten. Der Streit mit der EZB vor allem über deren Auskunftspflichten gegenüber dem Parlament zog sich über Monate hin. Während die Zentralbank auf die Vertraulichkeit der Beratungen über einzelne Banken beharrte und außerdem ihre Unabhängigkeit gefährdet sah, beharrten die Abgeordneten darauf, dass die EZB als Aufsichtsbehörde – anders als in der Geldpolitik – dem Parlament gegenüber informations- und rechenschaftspflichtig ist.
Der Streit wurde mit einem Kompromiss gelöst, wie in der Mittwochsausgabe gemeldet. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Parlaments soll künftig nicht wie ursprünglich gefordert Einsicht in die Sitzungsprotokolle des Aufsichtsgremiums (»Supervisory Board«) in der EZB erhalten, dafür aber eine »umfassende und aussagekräftige Aufzeichnung« über dessen Verhandlungen zugestellt bekommen. Die Diskussionen und Beschlüsse des Aufsichtsgremiums sollen so nachvollzogen werden können. Sollte der EZB-Rat sich gegen eine Entscheidung des Supervisory Board stellen, muss der EZB-Chef dem Vorsitzenden des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Parlaments die Gründe dafür darlegen. Die Informationen müssen vertraulich behandelt werden. Schon früher hatte das Parlament durchgesetzt, dass der Ausschuss EZB-Vorschläge für die Besetzung des Chefaufseher-Postens und dessen Stellvertreter ablehnen kann.
Die Parlamentarier feiern den Kompromiss als Erfolg. Der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold hob hervor, dass die Kontrollrechte des Europaparlaments weiterreichten als jene des Bundestags gegenüber der deutschen Aufsichtsbehörde Bafin. Der SPD-Abgeordnete Peter Simon sagte, die Kompetenzverlagerung in der Aufsicht auf die europäische Ebene müsse mit zusätzlicher demokratischer Kontrolle einhergehen.
Nach der Parlamentsabstimmung kann die EZB damit beginnen, das neue Aufsichtsgremium aufzubauen. Nach dem jetzigen Zeitplan soll es Ende 2014 seine Arbeit aufnehmen. Wegen der umfangreichen Vorbereitungen gilt auch dieser Zeitplan noch als sehr ehrgeizig.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.09.2013
»Kein Banker darf sagen, im Notfall rettet mich der Staat«
Der Präsident des französischen Sparkassenkonzerns BPCE, François Pérol, plädiert für die europäische Bankenunion, in der auch französische Banken deutsche retten müssten und umgekehrt. Mehr Eigenkapital für die Banken hält er nicht für nötig, sonst käme die gesamte Volkswirtschaft zum Stillstand, weil Banken keine Kredite mehr vergeben könnten.
Von Christian Schubert
Der französische Bankmanager François Pérol, Präsident des Sparkassenkonzerns BPCE, tritt gewöhnlich ruhig auf und formuliert abgeklärt. Bei zwei Europathemen aber gerät er verbal in Wallung: Die europäische Finanztransaktionssteuer sei wie eine »Mautgebühr in der Wüste«, denn sie bringe rein gar nichts und werde die betroffenen Finanzplätze rasch austrocknen, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Die europäische Bankenunion dagegen sei eine »Schicksalsgemeinschaft«, der sich auch die Sparkassen nicht entziehen dürften. Als Präsident der Europäischen Sparkassenvereinigung hat Pérol in dieser Frage schon manche Debatte mit den deutschen Sparkassen ausgefochten.
Pérol hat die Finanzkrise aus ganz verschiedenen Blickwinkeln erlebt und bekämpft. Zwischen Mai 2007 und März 2009 war er als Vize-Generalsekretär des Elysée-Palastes Chefberater von Präsident Nicolas Sarkozy und bereitete im Oktober 2008 zusammen mit seinem Gegenüber auf deutscher Seite, Jens Weidmann, Staatsgarantien für die Banken vor. Keine sechs Monate später saß er als neuer Chef des BPCE-Konzerns, den er vom Elysée-Palast aus mit geschmiedet hatte, auf der Empfängerseite der staatlichen Bankenhilfe. Pérol sieht daran nichts Anrüchiges. Sein Seitenwechsel hat jedoch zu politischen Protesten der damaligen Opposition und einiger Gewerkschafter geführt. Heute sitzt Pérol fest im Sattel an der Spitze des Bankenkonzerns BPCE, der auf dem französischen Markt die Nummer zwei hinter dem Crédit Agricole ist. Neben dem klassischen Filialgeschäft ist BPCE mit der Tochtergesellschaft Natixis im Investmentbanking für Großkunden unterwegs sowie in der Vermögensverwaltung, wo die Gruppe global auf Rang dreizehn rangiert.
Pérol bedauert nach eigenen Worten nichts von den Beschlüssen als früherer Bankenretter. »Wir waren damals mit dem Stillstand des Blutkreislaufs konfrontiert, der unmittelbar das Gehirn des weltweiten Finanzköpers bedrohte. Es herrschte Lebensgefahr«, erinnert er sich. Daher mussten die Regierungen einspringen. Dabei betont Pérol, dass die BPCE so wie die anderen französischen Banken die Staatskredite samt Zinsen pünktlich zurückzahlten. »Das war ein gutes Geschäft für den französischen Staat.« Aber künftig seien solche »Unfälle« dringendst zu vermeiden. »Kein Bankmanager darf sich sagen: im Notfall rettet mich der Staat.« Das gelte auch für die 28 systemrelevanten Banken der Welt, die gemäß der Bewertung des Fachgremiums Financial Stability Board das globale Finanzsystem gefährden, wenn sie zusammenbrechen würden. Die BPCE gehört mit ihrer Bilanzsumme von 1147 Milliarden Euro zu diesen 28 Banken. »Wir sehen diesen Status in keiner Weise als Schutz«, betont Pérol. Die Bank würde aber natürlich die speziellen Pflichten für die systemrelevanten Finanzunternehmen wie höhere Eigenkapitalanforderungen und schärfere Aufsicht respektieren.
Um künftige Krisen zu vermeiden oder besser in den Griff zu bekommen, sei indes die Bankenunion einschließlich eines europäischen Abwicklungsfonds unverzichtbar, zu welchem Zeitpunkt auch immer sie komme. Die geplante europaweit einheitliche Aufsicht ergebe Sinn, denn in einem gemeinsamen Währungsraum müssten die Banken den gleichen Bedingungen unterliegen. Das gelte auch für die Abwicklung oder Schließung einer Bank. Richtig sei es, im Zuge einer notfalls erforderlichen Abwicklung zuerst die Aktionäre zur Kasse zu bitten und dann die Gläubiger. Die Kunden mit Spareinlagen wie Privatleute sowie kleine und mittelständische Unternehmer seien dagegen vor Einlagenverlust von einem durch die Banken finanzierten Abwicklungsfonds zu schützen. »Dieser Fonds soll nur als letzte Instanz eingreifen.« In Amerika habe sich im Prinzip das gleiche System bewährt: Unter Aufsicht der staatlichen Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) werden dort erst Aktionäre und Gläubiger herangezogen, und am Ende versuchen die Behörden die Übernahme einer gestrauchelten Bank durch einen anderen Anbieter zu organisieren, berichtet Pérol. Findet sich niemand, dann müsse eine Bank auch geschlossen werden können. Pérol verlangt diese Regel ausdrücklich auch für europäische Banken.
Wie aber sieht es mit grenzüberschreitenden Zahlungen innerhalb eines künftigen europäischen Abwicklungsfonds aus? Sollen französische Banken künftig auch für Pleiten in anderen Ländern zahlen? Pérol gibt sich hier ganz als guter Europäer. Die Banken im Euroraum stünden heute alle in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Vor allem die außereuropäischen Investoren würden die Finanzhäuser des Euroraumes oft in einen Topf werfen. Wenn es irgendwo im Euroraum schieflaufe, stiegen etwa gleich die Finanzierungskosten für alle Banken in der europäischen Währungszone – und umgekehrt. »Geht es etwa den spanischen Banken besser, dann wirkt dies positiv auf die Wahrnehmung der Investoren von meiner Bank, selbst wenn wir in Spanien gar nicht vertreten sind«, sagt Pérol und verteidigt damit eine Ansicht, die viele deutsche Sparkassen nicht teilen. »Ob man das will oder nicht, wir sitzen im gleichen Boot. Ich möchte, dass das Boot so solide wie möglich ist«, meint Pérol. Und er fügt hinzu, dass es nicht allein auf strenge Regeln ankomme. »Man braucht auch eine strenge Überwachung der Banken.«
Sollte die Bankenunion in der gewünschten Form kommen, wären die richtigen Lehren aus der Finanzkrise gezogen, meint der BPCE-Chef. Das Gegenteil gelte freilich für die Finanztransaktionssteuer, wie sie die EU-Kommission vorgeschlagen habe. »Ich stelle fest, dass hier der elementarste Pragmatismus fehlt«, erbost sich Pérol. Denn wie könne man an den Erfolg einer europäischen Finanztransaktionssteuer glauben, wenn nur elf Länder des Euroraumes sie einführen wollen, darunter kein einziger führender Finanzplatz wie London, New York oder Tokio. »Es steht schon fest, was dann passieren wird: Das Volumen der Finanztransaktionen in den besteuerten Ländern wird sinken, und die betroffenen Geschäftstätigkeiten ziehen weg. Die Folge ist, dass die Steuereinnahmen insgesamt sinken, denn Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, die spezielle Gehaltssteuer für Banken in Frankreich und die Steuer auf systemrelevante Banken werden weniger einbringen«. Laut eigenen Berechnungen müsste alleine die BPCE im Jahr 6 Milliarden Euro zahlen, wenn das von der EU-Kommission geforderte Steuerkonzept Wirklichkeit werde. »Das ist das Zwölf- bis Fünfzehnfache unseres jährlichen Nettogewinns in den betroffenen Geschäftsfeldern. Das können wir natürlich nicht zahlen, daher müssten wir es an unsere Kunden weitergeben.« Auch die Aktienemittenten hätten Grund alarmiert zu sein. Wenn es weniger Transaktionen mit Aktien gäbe, würde der ganze Wertpapierhandel damit weniger attraktiv. »In Frankreich sind die Volumina durch die 2011 eingeführte Steuer auf Aktientransaktionen um 20 Prozent gesunken.« Schweden wolle aus gutem Grunde nicht bei der europäischen Finanztransaktionssteuer mitmachen, erinnert Pérol. In den neunziger Jahren machten die Schweden mit ihrer nationalen Finanztransaktionssteuer so schlechte Erfahrungen, dass sie diese bald wieder abschafften. Die Londoner City freue sich dagegen jetzt schon.
Unverständlich sei auch, dass die Befürworter der Steuer Staatsanleihen davon befreien wollen. Gleichzeitig rufe die Europäische Zentralbank die Banken dazu auf, künftig weniger Staatsanleihen zu halten. Dabei setze die unter Basel III geforderte Liquiditätsreserve große Anreize zum Kauf von Staatsanleihen. Das sei der falsche Weg. »Es ist nicht die Aufgabe einer Bank, ein großes Portfolio von Staatsanleihen zu halten. Unsere Aufgabe ist es, die Wirtschaft zu finanzieren.« Pérol ist im Übrigen auch der Ansicht, dass die Staatsanleihen nicht mehr mit Nullrisiko in den Bilanzen bewertet werden sollten, denn die Euro-Krise habe gezeigt, dass die Realität eine andere sei.
Könnten all die Vorschriften nicht überflüssig werden, wenn man von den Banken einfach ein viel höheres Eigenkapital verlangen würde? Pérol bestreitet das. »Bei 20 Prozent Eigenkapital etwa käme die ganze Volkswirtschaft zum Stillstand, weil die Banken keine Kredite mehr geben könnten.« Ihre Rolle könne nicht mit Industrieunternehmen verglichen werden. Die Banken hätten kurzfristige Einlagen in mittel- und langfristige Kredite umzuwandeln. Für die Absicherung der damit verbundenen Risiken brauche man nicht mehr Eigenkapital als heute, also etwa 3 bis 4 Prozent. Die Sicherungsdecke der europäischen Häuser läge im Übrigen auf ähnlichem Niveau wie in den Vereinigten Staaten. Die gelegentlich genannten Zahlenunterschiede gingen ...