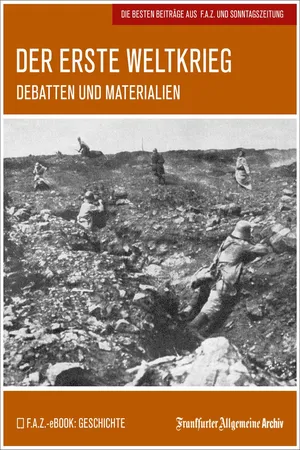Greuellegenden: Die abgeschnittenen Hände
Als 1914 der Krieg beginnt, forscht André Gide einer der zahllosen Greuellegenden über die Deutschen nach. Viertausend französische Kinder sollten verstümmelt worden sein. Gide stößt auf eine Kette von Dementis. Jede Legende über die andere Seite enthält das Versprechen über den Sieg der eigenen.
Von Henning Ritter
Am Tag der Mobilmachung, dem 2. August 1914, schildert André Gide in seinem Tagebuch die Stimmung in der Stadt Paris: »Die Luft ist voll scheußlicher Angst. Paris hat etwas Unwirkliches, die Straßen sind frei von Fahrzeugen, voll von seltsamem Volk, das zugleich aufs höchste gespannt und ruhig ist; Leute mit Koffern warten an der Straße, vor den Kneipen grölen ein paar Schreihälse die Marseillaise. Manchmal fährt ein mit Gepäckstücken beladenes Auto vorbei.« Gide berichtet, wie er sich hinter der École Militaire verlaufen habe, der Anblick der Stadt sei so merkwürdig, dass er sich nicht mehr auskenne. Verstörend ist auch, dass man in der französischen Hauptstadt so gut wie ohne Nachrichten in den Tag hinein lebt.
Auch Péguy hat die Atmosphäre jener seltsamen Tage beschrieben. Er wundert sich über die, die sich über die veränderten Verhältnisse wundern: »Es gibt merkwürdige Leute«, sagt er zu Paul Laurens, »sie wundern sich, Menschen und Dinge nicht mehr am gewohnten Platz zu finden. Sie bilden sich ein, sie könnten den Kriegszustand einfach auf den Friedenszustand draufsetzen; und dann wundern sie sich, dass das nicht zusammenpasst, dass das nicht in die kleinen Löcher hineingeht.«
Schon am 5. August, am Tag nach der deutschen Kriegserklärung und der darauf folgenden englischen Kriegserklärung an Deutschland, wagt sich der Gedanke an die deutsche Niederlage weiter hervor. Man wehre sich, bemerkt Gide, mit aller Kraft gegen diesen Gedanken wegen der Unwahrscheinlichkeit eines Sieges. Aber man könne gegen diese Phantasie nicht ankommen, könne sich nicht überzeugen, dass es nicht sein kann. Gides Gedanken gehen über den Krieg, der noch gar nicht richtig begonnen hat, hinaus zu einer Nachkriegsordnung, die jeder offenbar genau vor Augen hat: »Man sieht den Beginn einer neuen Ära vor sich: die Vereinigten Staaten von Europa, durch einen Vertrag verbunden, der ihre Rüstung beschränkt; Deutschland verkleinert oder aufgelöst; Triest den Italienern zurückgegeben; Schleswig an Dänemark; und vor allem das Elsaß an Frankreich« (6. August 1914). Alle sprächen »von einer solchen Revision der Landkarte wie von der Fortsetzung eines Feuilletons«.
Die Berichte über die in Belgien vorrückenden deutschen Truppen enthalten auch Komisches. Man lacht über die »Bluffs«, die die Deutschen sich erlauben. An den Festungskommandanten von Lüttich sollen sie einen Brief geschrieben haben: Wenn er sich nicht ergebe, seien sie zu ihrem großen Bedauern leider gezwungen, einen der deutschen Zeppeline Sprengstoff abwerfen zu lassen. Man versucht, mit Wunderwaffen zu imponieren.
Gide macht Dienst beim Roten Kreuz. Möglicherweise hört er dort die vielen, oft phantastischen Berichte, die er in seinem Tagebuch verzeichnet. In Spanien zum Beispiel gehe das Gerücht von Poincarés Ermordung, in Paris herrsche die Kommune, Frankreich sei von der deutschen Armee überfallen worden. War die letzte Nachricht noch am wenigsten von der Realität entfernt, so ist das Gerücht über die Pariser Kommune ein Beispiel für die Geschichten, die sich aus der Erinnerung an den Krieg von 1870/71 speisen. So gibt es auf deutscher Seite die Angst vor »Franc-tireurs«, die damals eine spektakuläre Rolle spielten. Zur Unwirklichkeit der Lage trägt auf der anderen Seite bei, dass das Land, wie Gide sich von einer Autofahrerin erzählen lässt, einen nachgerade festlichen Eindruck mache.
Man ist entschlossen, den Deutschen mit allen Mitteln entgegenzutreten, falls sie in Frankreich einfielen. Ein Bekannter Gides prahlt, dass er alles, was ihm an Deutschen begegnen werde, Frauen und Kinder genauso wie Soldaten, erschießen werde. Am nächsten Tag zeigt er sich schockiert von seinen eigenen Reden. Aber andererseits, meint er, könne man von nichts anderem reden als vom Krieg. Gide fühlt ein Unbehagen bei diesen Geständnissen.
Auch das Zeitunglesen verändert sich. Man kauft täglich wenigstens ein Dutzend verschiedener Zeitungen. Nicht, dass man Verschiedenes darin läse. Es ist geradezu der Sinn dieses Überflusses an Zeitungen, in jeder von ihnen dieselbe Nachricht wieder zu lesen, da man hofft, wie Gide bemerkt, durch das Wiederlesen etwas Neues zu erfahren. Das Neue erscheint im Übrigen in den Zeitungen zuerst immer verschlüsselt, erst am nächsten Tag werden diese Nachrichten erklärt.
Während man in den ersten Tagen ganz ohne Nachrichten gewesen war, sind es bald darauf zu viele. Sie dringen sogar aus dem Ausland nach Paris vor, es heißt da, dass Paris, dass der Louvre brenne. Auch solche falschen Nachrichten tragen, wie Gide bemerkt, dazu bei, dass die Psychologie des Ernstfalls Gestalt annimmt. Man ist nicht nur erschöpft von der Nachrichtenfülle, sondern fast mehr noch von dem, was die öffentliche Meinung einem zuträgt. Das Leiden daran scheint sogar größer als das am Krieg: »Wäre nicht die öffentliche Meinung, würde ich – ich fühle es – noch in feindlichem Feuer eine Ode des Horaz genießen können.« Im Feuer Horaz lesen, auch das gehört zur »Psychologie des Patrioten«, die sich allmählich entwickelt.
Wer so etwas tut, hat den Sieg nicht verdient
In den Tagen um den 20. August trifft sich Gide mit Professoren, Philosophen, die zusammenkommen, um nachzudenken über die Lage, in die der Kriegszustand die beschäftigungslosen jungen Leute zwischen zwölf und achtzehn gebracht habe. Es sind Gelehrte, die sich auf einmal in Psychologen und Sozialarbeiter verwandeln möchten, eine neue Berufsgruppe, die im Krieg zum ersten Mal weithin sichtbar wird und offenbar auch auf die konservativen Professoren Eindruck macht. Gide malt das Engagement weiter aus: Jemand habe angeregt, ein paar kleine Fabrikanten, Schreiner, Schuhmacher, Schlosser dazu zu bringen, die Ausbildung von zwei, drei oder vier gutwilligen jungen Burschen zu übernehmen. Sie sollten »mit sportlichen Übungen beschäftigt werden, die sie ermüden, mit militärischer Grundausbildung, Fußball, Marschieren auf der Radrennbahn, die der Leiter der Zeitschrift ,L‘Auto‘ freundlicherweise zur Verfügung stellen will.« Man beginnt, herumzutelefonieren, um die Sache voranzubringen, Anrufe über Anrufe. Offenbar sollen die arbeitslosen jungen Männer ruhiggestellt werden.
Gide steht solchen Plänen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Sie gehören für ihn zu der unerfreulichen Betriebsamkeit, alles und jedes zu organisieren, worin sich in seinen Augen eine umfassende Militarisierung des Geistes abzeichnet. Das Verhältnis von Geist und Militär macht sonderbare Veränderungen durch: »Wer keine Uniform trägt, mobilisiert den Geist, während diejenigen, die Uniform tragen und also mobilisiert sind, zu größerer Freiheit des Denkens berechtigt sind.« Überhaupt habe das Denken der Front alle erfasst, denn jeder steht, wo er auch ist, auf seinem Posten, muss also nicht unbedingt an der Front sein, um auf seinem Posten zu sein.
Der Ernst durchdringt alles. Eine Begegnung Gides mit Jean Cocteau geht schief, weil dieser kein Verhältnis dazu findet. Cocteau scheint, trotz seiner außerordentlichen Freundlichkeit, seiner lebhaften Gedanken und Einfälle, seiner Gefühle und einer außerordentlich lebhaften Sprechweise, zu keinerlei Ernst fähig; er wirkt deplaziert wie ein »in Hunger- und Trauerzeiten ausgestellter Luxusartikel«.
August 1914. Noch versprechen sich fast alle ein erhebendes Erlebnis vom Krieg. Die Wirklichkeit löschte innerhalb kürzester Zeit mit Vehemenz den patriotischen Rausch aus. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-25684-0004.
Über die Deutschen, die auf französischen Boden vordringen, sagt Gide, sie wollten offenbar den Krieg durch Verletzung der Spielregeln »für ewige Zeiten diskreditieren«. So läuft das Gerücht um, sie töteten auf dem Schlachtfeld ihre eigenen Verwundeten. Und auch bei Evakuierungen, heißt es, töteten sie ihre eigenen Verwundeten, ließen aber die der Franzosen am Leben. »Erklär das, wer kann«, schreibt Gide. Das unterschiedliche Verhalten der Deutschen und der Franzosen scheint ihn lange beschäftigt zu haben. Mitte Oktober hat er eine Erklärung von erstaunlicher Einfachheit gefunden: »Es scheint mir auch, als habe das Massaker nicht dieselbe Bedeutung für ein Volk, dessen Bevölkerungszahl abnimmt, wie für eines mit Geburtenreichtum. Der Deutsche, der ein Dorf zur Ader lässt, weiß, dass er es neu bevölkern kann: Übervölkerung führt zu Massakern; man muss sich Raum schaffen« (16. Oktober 1914).
Am 25. und 26. August kommen erstmals Flüchtlinge aus den verwüsteten Dörfern nach Paris. Auch Kinder sind darunter, sie werden in der Rue Vaneau untergebracht. Es heißt, einigen dieser Kinder seien die Hände abgeschnitten. Andere Kinder hätten ausgestochene Augen, wieder andere schreckliche Wunden. Madame Edwards, die Gide davon berichtet, will es mit eigenen Augen gesehen haben. Gide beschränkt sich in seinem Tagebuch (26. August 1914) auf die nüchterne Feststellung: »Der Sachverhalt hat nie aufgeklärt werden können.« Offenbar ist dies ein späterer Eintrag, denn eine Zeitlang hat sich Gide intensiv bemüht, dahinterzukommen, was es mit den »abgeschnittenen Händen« auf sich hatte.
Im November taucht im Foyer franco-belge ein Amerikaner auf, der eine bedeutende Summe Geldes für die französisch-belgische Verständigung anbietet, falls man ihm ein von den Deutschen verstümmeltes Kind zeigen könnte. Es hatte unlängst einen empörten Zeitungsartikel gegeben, in dem von viertausend Kindern die Rede war, denen die Deutschen die rechte Hand abgeschnitten hätten. Diese Greuelpropaganda habe Romain Rolland empört und viele Schweizer mit ihm. Gide beginnt nun, nach der Aufforderung des Amerikaners, selber Nachforschungen anzustellen. Madame Edwards hatte ja behauptet, eine ganze Schar solcher Kinder gesehen zu haben. Als Gide sie jetzt befragt, erklärt sie, die Kinder nicht selbst gesehen zu haben, sie seien vom »Cirque de Paris« gekommen. Doch sie könne Fotografien beschaffen, sagt sie. Am nächsten Tag bringt sie zwar nicht die Fotografien, kündigt aber an, dass Cocteau sie vorbeibringen werde. Als der am nächsten Tag kommt, hat auch er sie nicht, verspricht sie aber für den nächsten Tag. Alle Versprechen, Beweise zu liefern, bleiben uneingelöst, alle weiteren Nachforschungen vergeblich. Man sucht schließlich eine Dame vom Roten Kreuz auf, die solche Kinder gepflegt haben soll. Gide trifft sie nicht an und zieht unverrichteter Dinge wieder ab. Auch ein Hinweis seines Freundes Ghéon, dass zwei Verstümmelte, der eine fünfzehn, der andere siebzehn Jahre alt, im Orsay-Krankenhaus in Behandlung seien, stellt sich als gegenstandslos heraus. Ghéon ist verzweifelt darüber, dass man vergeblich nach Beweisen gesucht habe. Die enorme Prämie, die der Amerikaner für den französisch-belgischen Verein ausgesetzt hatte, zog nur ein einziges Ergebnis nach sich: Alle Nachforschungen führen zu Dementis. »Nicht eine von diesen Behauptungen«, schreibt Gide am 15. November 1914, »konnte bewiesen werden.«
Ein Jahr später berichtet er in seinem Tagebuch noch einmal von einem drei- oder vierjährigen Jungen, der an Stelle der rechten Hand nur einen Stummel hat. Seine Mutter versichert aber, dass es sich um einen Geburtsfehler handele. Madame Théâtre, so heißt die Mutter des Jungen, die im französisch-belgischen Foyer mitarbeitet, für das auch Gide tätig ist, erzählt das folgende Erlebnis, das sie mit ihrem Kind in Reims hatte. Als die Deutschen die Stadt eingenommen hatten, mischten sich deutsche Soldaten und Offiziere unter die Bevölkerung, ein großes Durcheinander. In einem Metzgerladen kommt Madame Théâtre hinter einen deutschen Unteroffizier zu stehen. Sie trägt ihr Kind auf dem Arm. Der Unteroffizier wird vor ihr bedient. Er erhält zwei Sous Wechselgeld, die er dem Jungen geben will. Als dieser nach dem Geschenk greift, werden seine zwei Armstummel in einem weißen Verband sichtbar. Madame Théâtre erzählt: »Und da habe ich gesehen, wie der Offizier die Farbe wechselte, wie seine Züge sich verkrampften, seine Lippen bebten. Er sah mich an, ich merkte, dass er sprechen wollte, aber nichts sagen konnte. Aber ich verstand seine Frage auch ohne Worte. Sicher dachte er: Es ist also wahr, was man uns nachsagt? So etwas haben die Unseren getan? . . . Und auch ich fand keine Worte, um ihm zu sagen: Nein, es ist nicht das, was Sie glauben. Ich schüttelte bloß den Kopf, wie jemand, der nein sagen will. Sie müssen aber wissen, dass ich seit ein paar Tagen keine Nachricht mehr von meinem Mann hatte und ihn für tot hielt, so dass mein Gesicht so traurig war, dass er sich wohl getäuscht hat. Er ging hastig aus dem Laden, die Hand vor Augen und von Schluchzen geschüttelt.« So schildert Madame Théâtre die leibhaftige Begegnung mit einer Greuellegende.
Eine ganze Generation sollte kriegsuntauglich werden
Nach dem Sinn der Legende von den abgeschnittenen Kinderhänden hat Gide in seinem Tagebuch freilich nicht gefragt. Dabei dürfte die Antwort mit der von ihm formulierten Erklärung der Massaker engstens zusammenhängen. Mitten während seiner Nachforschungen nach den abgeschnittenen Kinderhänden kommt Gide auf diese Erklärung noch einmal zurück: »Man kann von einem geburtenreichen Volk nicht erwarten, dass es dieselbe Achtung vor dem Menschenleben, ja vor dem Individuum empfinde wie eine Rasse, die im Schwinden begriffen ist.« Das würde für viele der Greuel zutreffen, die im Weltkrieg begangen oder phantasiert wurden. Was wollte das Abschneiden der Hände sagen? Die naheliegende und wahrscheinlich zutreffende Antwort dürfte sein: die französischen Kinder sollten, herangewachsen, nie Soldaten werden können. Eine ganze Generation – so mochten diejenigen denken, die die Legende verbreiteten und von ihr umgetrieben waren – sollte kriegsuntauglich gemacht werden, indem man den Kindern die Hände abschnitt.
Die kriegerischen, vom Krieg überzeugten Deutschen hätten also unterschwellig einer »pazifistischen« Phantasie nachgegeben und ein Zeichen gesetzt, dessen brutale Botschaft lautete: Nie wieder Krieg! Viele der Greuellegenden des Ersten Weltkrieges sind von solcher Ambivalenz, indem sie an der Grausamkeit des Krieges dessen Sinnlosigkeit demonstrieren. Und noch eine andere Beschwörung liegt in den Erzählungen der Franzosen über deutsche Kriegsverbrechen: Wer so etwas tat, hatte den Sieg nicht verdient. Jede Legende über die andere Seite enthielt so das Versprechen des Siegs der eigenen. Das machte das Interesse an den Greuellegenden so überwältigend stark. Man wollte an sie glauben, weil sie den eigenen Sieg verbürgten.
Der Amerikaner, der Gide und seine Freunde durch seine Geldprämie dazu bewegte, Nachforschungen über die Greuel anzustellen, könnte der Journalist John Palmer Gavitt gewesen sein, der während des Krieges in einer New Yorker Tageszeitung die Greuellegende zu widerlegen suchte. Er taucht gegen Ende der zwanziger Jahre in Deutschland auf, trifft in Hamburg Aby Warburg, der seine Verdienste um die Widerlegung der Greuellegende sofort parat hat. Man kann annehmen, dass die Begegnung nur wegen Warburgs Interesse an dieser Frage zustande kam. Im »Tagebuch der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek« notiert Warburg am 31. Mai 1928: »Ein fabelhaft gütiger und kluger amerikanischer Journalist John Palmer Gavitt (vom ,Survey‘ New York, früher ,New York Evening Post‘) wird mir von Erich zugeschickt. Prachtvoll, wie er erzählte, wie er mitten im Kriege die Greuellegende durch unermüdliches Nac...