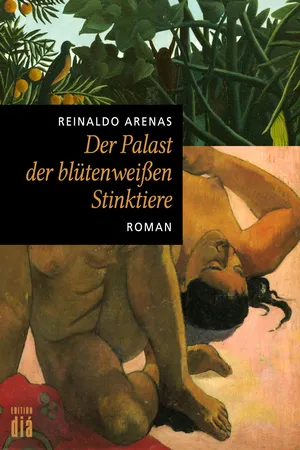![]()
Fünfte Agonie
Einmal hab ich gesehn, wie Fortunato nachts mit dem morschen Baumstamm auf dem Hof geredet hat. Er erzählte ihm was Fürchterliches und weinte sich die Augen aus dem Kopf. Beim Weinen hat er gleichzeitig schallend gelacht. Ich sagte mir: Der ist doch nicht mehr dicht, und rannte zurück in mein Bett. Das ist lange her. Heute wüsste ich nicht mehr, was ich davon halten sollte.
Die anderen.
Denn auch darum ging es jetzt: nicht wahnsinnig werden. Tapfer genug sein, um alles zu erdulden, ohne es zu dulden, um scheinbar alles hinzunehmen, ohne es wirklich hinzunehmen. Furchtlos genug sein, um so zu tun, als spiele man mit, ohne sich untreu zu werden, ohne sein Urteilsvermögen zu verlieren, ohne diesen beinahe unsichtbaren Faden zum eigentlichen Sinn zu verlieren, den keiner kennt und der ihn nie würde ernähren, seine Familie nie zufriedenstellen, den Lärm der Laufrollen und das schreckliche Licht nicht würde dämpfen können. Denn neben dem Geschrei und den Beschimpfungen, neben dem unerbittlichen Wundfraß der Zeit, dem Grauen vor dem alltäglichen Leben, neben dem ganzen nutzlosen Lärm, der darum nicht weniger unerträglich war, ihn nicht weniger verdammte, nicht weniger dazu beitrug, dass jeder nennenswerte, wirkliche, weiterreichende Plan im Sande verlief, musste er noch scharfsichtig, unerschrocken genug bleiben, um dahinter jenen hauchdünnen Faden zu erkennen, den es vielleicht nur in seiner Fantasie gab und der vielleicht nur eine der vielen Gestalten war, in denen sich uns die Niedertracht zeigt. Dahinter stand die Nacht. Nicht blau. Nicht weiß. Nicht mild. Die Nacht. Die Nacht, die Ecken stumpf macht und trübe Wasser staut. Die Nacht, die zu Moskitowolken zerfällt, sich am Ende als ein riesenhafter, verbissen ausgekratzter Topfboden herausstellt; die Nacht mit ihren Feuern, mit ihrem Gewinsel rot angelaufener Kinder und widerwärtiger, wie ihre Herren hungriger und hysterischer Hunde. Die wahre Nacht mit ihren nie versickernden Kloaken, mit ihren riesenhaften Wänden und dem unumgänglichen Feuer aus Gewehrläufen.
Wenn er eine Hand ausstreckt, wenn er sich über den Abgrund vortastet, wenn er sich anzuklammern versucht, wird ihn dann jemand halten kommen? Kann jemand auch nur verstehen, dass er um Hilfe ruft? Und könnte dieser Jemand, vorausgesetzt, er kommt, nicht einer seiner Feinde sein? … Er hatte sich in letzter Zeit wie seit eh und je so viel Geschwätz anhören müssen. Aber was war denn richtig, was war denn nun richtig, was war denn nun eigentlich richtig …
Dahinter, weiter vorn wirbelten mit fast metallischem Scheppern die Bestien, schwitzten und stanken wie er, jaulten wie er, knirschten bitter mit den Zähnen wie er. Wenn er nun einfach stillhielt, sich nicht rührte, sich ihren Krallen endlich überließ. »Im Herbst … die Bäume, im Herbst … die Bäume.« Was sollte er jetzt aufsagen, welche geniale Buchstelle könnte er mit lauter, beklommener Stimme aus dem Kopf hersagen, damit sie ihn gegen das unablässige Geknatter unempfindlich machte. Doch, er kannte ein Lied. Seine Großmutter hatte es ihm beigebracht, als er ein Kind war. Und er hatte es, auf dem Vorplatz, unter den Regenrinnen, an einer Ecke des langen Tisches immer wieder gesungen. Das Lied erzählte, ausgeschmückt mit tränenreichem Schwulst, die Geschichte eines kleinen Knaben, der vaterlos zur Welt kommt, weil sein Vater seine Frau »betrogen« und sich davongemacht hat. Der Knabe »wird zum Manne«, zieht in den Krieg und »tötet aus Rache seinen Vater«. In der letzten Strophe heißt es: »So handeln Söhne, die zu lieben wissen.« Dieses Lied würde er nie vergessen. Die Nationalhymne vielleicht oder sogar sicher, nicht aber dieses Lied. Sein Text, seine ins Ohr gehende Melodie würden in ihm nachklingen, solange sein Leben mit Kränkungen, Hunger, Erniedrigungen, Träumen und Stumpfsinn in allen Variationen gepflastert war. Solange er Gerüche roch, die vielleicht nie jemand genossen hatte, Wörter aussprach, die durch die Entfernung ihren ursprünglichen zornigen Klang einbüßten, durch Orte und Zeiten wanderte, die nur noch in dem Augenblick existieren, da man an sie als unwiederbringlich verloren zurückdenkt. Und dahinter, dahinter, was lag dahinter? Die absolute Gewissheit, dass sich das große Grauen starr und teilnahmslos über die kleinen Missgeschicke des Alltags und die kleinen Gelegenheitssiege hinweg halten würde, und dass es, um ihn einzuschüchtern und kleinzukriegen, um weiter seine grausige Wirkung zu tun, den Lärm der Laufrollen, das faule Obst und die gewalttätigen Regierungen gar nicht nötig hatte. Dahinter lag das große Grauen, die große Einsamkeit, die Überzeugung, dass der Tod bereits an die Türe klopfte, klopfte … Und selbst wenn es ihm glücken sollte – was kaum zu erwarten war –, aus dem Kreis auszubrechen, selbst wenn er noch einmal entkommen könnte – was unmöglich war –, dann würde es doch bereitstehen, um ihn weiterzuhetzen, würde ihn abpassen, um ihn zu erledigen, würde ihn immer verhöhnen. Gott war nicht mehr da, wohl aber das Gefühl, dass der uralte Betrug auf seinen kleinsten Bewegungen lastete – sich das Hemd befühlen, feststellen, dass es durchgeschwitzt ist, zum Himmel aufsehen. Wozu gleißten da noch die Sterne wie der Mittag und waren wie der Mittag teuflisch. Gott war nicht mehr da, wohl aber die Gewissheit, dass jemand – das Verhängnis, der Zwang der Umstände – ständig über Sterne, Wellblechdächer, Stachelnusszweige und Klosettbecken wachte. Gott war nicht mehr da, wohl aber die Gewissheit, dass dieser Widersacher selbst hier bei seinem sinnlosen Lauf zugegen war, mit feinem Gespür selbst sein leisestes Zittern beobachtete, immer bereit, als Zeuge aufzutreten, sein Urteil für sich zu behalten und sich im Übrigen wollüstig zu wiegen wie die Würmer auf dem Land, wenn er den Klosettdeckel hochklappte und sie das Sonnenlicht traf. Gott war nicht mehr da, und ein markiges, ovales, verführerisches, unerschütterliches, ganz und gar uneinnehmbares Gesicht, mit funkelndem, angriffslustigem Blick und strahlendem Gebiss, das ihn von seiner Erkenntnissuche entbinden könnte, hatte er auch nicht. Er hatte weder Gott noch die gefräßigen, ichsüchtigen und selbstsicheren Gesten der anderen; keine Möglichkeit, etwas zu lernen, zu reisen, rauschende Feste zu feiern. Er hatte weder Gott noch eine Plantage mit Sklaven, noch immergrüne, weite, wogende Gärten, noch den neuesten Oldsmobile, noch eine bedeutende Stellung in einem bedeutenden Unternehmen, noch ein Königreich, alles Dinge, die seinen Geist vielleicht auf andere Religionen gelenkt – oder ihm gar nicht erst die Zeit gelassen hätten, an Religion zu denken. Er hatte weder Gott, noch konnte er wie die anderen nur restlos stumpfsinnig oder restlos beglückt oder restlos unglücklich sein. Denn er hörte nun einmal ab und zu, wie jemand ihn rief; dann wollte er hinlaufen und verspürte beim Anziehen ein unerklärliche Lust zu pfeifen. Denn es passierte nun einmal, dass auch er ab und zu von der Stille, von der Dämmerung, von der Dunkelheit und vom Sichfühlen ein Stück abbekam … Er hatte weder Gott, noch konnte er dessen neuen Beauftragten vertrauen, die statt seiner mit Eifer, ja Leidenschaft der göttlichen Pflicht des Betrugs im großen Stil nachgingen. Was hatte er dann hier zu suchen, kugeldurchsiebt und am Verrecken, durch Gras und Stein und Schreie torkelnd. Lag ihm denn irgendetwas daran – hatte er etwa einen Glauben. Ja, Glauben war das Wort, war es immer gewesen.
Er war oft Adolfina gewesen und hatte sich wie sie oder noch heftiger danach gesehnt, umarmt, durchbohrt, enthauptet, erwürgt, von jemandes Liebe ausgelöscht zu werden. Oft war er Celia gewesen und hatte dann den Glanz hergebrachten Leids und den Wahnsinn kennengelernt. Oft war er Digna gewesen und hatte dann in andere Gesichter des Betrugs und der Einsamkeit geblickt, die er für unmöglich gehalten hatte. Oft war er Polo und Jacinta gewesen und hatte erfahren, wie weit Wut und enttäuschte Hoffnung gehen, wie sehr Rachsucht und Lästerung zum Bedürfnis werden können. Oft war er Tico und Anisia gewesen und hatte dann begriffen, dass es zum Überleben zweier Eigenschaften bedarf: der Unschuld und der Grausamkeit. Oft war er Esther gewesen und hatte nicht ohne Schrecken wie sie gefolgert, dass freiwillig sterben die einzige unverfälschte, selbstlose und freie Handlung ist, die ein Mensch sich vornehmen kann, die einzige, die ihn rettet, ihn mit einem Nimbus umgibt und ihm – vielleicht – ein Stück Ewigkeit und Heldentum zusichert. Oft, möglicherweise immer, war er alle zusammen gewesen, hatte für sie gelitten, vielleicht sogar noch mehr, da er mehr Fantasie hatte, da er weiterging als sie, die sich bei all ihrer Echtheit in ihrem Grauen doch immer gleich blieben; und er hatte ihnen eine Stimme, eine Ausdrucksform für ihre Verwunderung und eine Dimension des Grauens verliehen, die sie vielleicht, nein, sicher, niemals erfahren noch erleiden würden. Denn auch das kam ja noch hinzu, dass er alles Unglück der andern mittrug, dass er für sie litt und sie zu deuten versuchte. Dazu kam ja noch, dass das Grauen ständig in anderen Gestalten wiederkehrte. Und er in der Rolle des Deuters, des Ergründers, des Sprachrohrs der andern …
Gott, ja, Gott – den er nicht mehr anrufen konnte. Und er, wann würde Zeit für ihn da sein. Schließlich brauchte auch er Zeit, seine Zeit, um seine eigene Klage darin unterzubringen. Zeit für ihn, der im Bad an die Wand trommelte, tanzte, sich übergab, sich vor die Stirn schlug – er hatte Stirnhöhlenentzündung – und jetzt kugeldurchsiebt und fast schon ohne Gesicht unter Fußtritten, Halterufen, Gewehrknallen zähneklappernd davonzukommen suchte. Für den keine Zeit da war, der für alle mitlitt und allein die Gefahr auf sich nahm; der es nicht mit ansehen konnte und sich für die anderen zugrunde richtete; der liebte, hasste und auf eines Unbekannten Befehl hin, durch ein unbekanntes Verhängnis zu einem anderen wurde. War er das? War das sein wahres Ich, das sich hatte verwandeln, leiden und, immer allein, hatte auflehnen wollen? Und wozu? Wo er doch wusste, dass man mit Protestieren nichts ausrichtet, dass man dafür keinen Lohn bekommt. Wo er sich nur um der (berechtigten) Verweigerung willen verweigerte.
Da, oder vielleicht schon eher oder schon immer oder auch erst kurz danach, begriff er, dass darin der Sinn seines Daseins, sein Lebenszweck lag – doch, das ist es, das ist es, dachte er –, dass er sein wahres Wesen, seine gespaltene Erfüllung nur in der Gewalt und in den Verwandlungen finden würde … Aber wie sollte er dieses Wissen ertragen mit einem Gesicht wie dem seinen (die Augen waren braun), bei diesem Lärm, dieser Hitze und allem Übrigen? Ohne Gott und nur manchmal diese ungreifbare Unruhe zur Seite, diesen Kitzel, der immer unberechenbar blieb und dann oft das Gefühl des Gehetztseins und der Enttäuschung nur noch verstärkte.
Wie angenehm war es doch dagegen, von Fliese zu Fliese zu springen, alles von sich abzuwälzen, es anderen zu überlassen, einfach zurückzutreten und auf einer Zehe zu einer Stelle zu hüpfen, von der er alle sehen konnte, wie sie schnell, gleichgültig, manchmal auch froh vorübergingen, und ihnen nur einfach mit blutendem Herzen zuzusehen, oder im Schutz der Dunkelheit all den warmblütigen, unscheinbaren und unzerteilbaren Tieren, in denen er sich wiedererkannte, den Kopf abzureißen, oder sich auch träge aufs Sofa – mit dem ausgebesserten Sitzgeflecht – zu legen und zu krächzen, einfach zu krächzen. War nicht schon das Verb krächzen wundervoll? …
Zum Teufel mit dem fauligen Obstgestank, der immer durchdringender wurde. Zum Teufel mit der Nacht. Was hatten die Sterne noch da zu suchen (trotzdem waren sie da), was zum Henker ließ sich jetzt noch von den Sternen sagen, wozu taugten sie überhaupt, wozu waren sie nütze, wenn nicht zum Zähmen, Beherrschen, Auffressen, Runterschlingen, wenn man nicht jetzt, sofort, einen Nutzen aus ihnen ziehen konnte, wenn man sie nicht quälen, verletzen, auf ihnen rumtrampeln, sie dann zum Schrott werfen konnte, um sie schließlich nur so zum Spaß – denn das war der Schlüssel zum Gelingen des vielgesichtigen Betruges – in finstere Kerker aus Eisen zu werfen, wo sie unter leisem Wimmern sicher nach wenigen Stunden ersticken würden? … Trotzdem standen sie da, bleich und fern, und umspülten seinen zuckenden Leib mit ihrem Licht. Da standen sie, kalt und kaltblütig, und warfen ihm ihr falsches warmes Blinken zu. Die Sterne … Und die Nacht mit ihrem rätselhaften Werben und ihrem ergebnislosen Ausgang. Zum Teufel auch mit diesem Körper, diesem verfluchten jungen Körper, der – zu groß, zu plump, zu langsam, zu zu … – immer störte, immer gerade da war, wo er nicht hingehörte, immer nach etwas verlangte, sich immer verzehrte. Zum Teufel mit seinem Gesicht, den Augen vor allem, mit denen er doch nichts anfangen konnte, mit denen er nicht wusste, wohin, und die groß und traurig wie Kuhaugen ihr Gegenüber stets verwirrten und misstrauisch machten. Zum Teufel mit seinen Haaren, die bei der geringsten Gelegenheit – ein leichter Wind, ein Zweig – durcheinandergerieten. Zum Teufel mit seinen schweißtriefenden Händen, seinem knurrenden Gedärm, und zum Teufel auch mit dem Kitzel, der sonderbaren Melodie, diesem Rhythmus, diesem Schauer, der ihn dazu trieb, jetzt, ausgerechnet jetzt, zu sprechen, etwas Bleibendes, Furchtbares und unerhört Neues auszusprechen, vielleicht die Angst vor dem Bild des Sprechens, vielleicht die Angst, die man Sekunden vor dem Ausbruch spürt. Zum Teufel selbst die Widersprüche, die ihn von Schrecken zu Schrecken hetzten, ihn sich für alle entscheiden, sie alle erleiden und weiterhetzen ließen. Zum Teufel mit seinen verschiedenen Erklärungen für das Grauen, mit seinen zahllosen Deutungsversuchen, seinen Spekulationen, seinen vermeintlichen und seinen abgesicherten Entdeckungen. Zum Teufel damit. Er wollte sich nur noch treiben lassen, diesen Faden, den es vielleicht gar nicht gab, einfach nicht mehr suchen. Er wollte Grimassen, nur noch Grimassen, schlicht Grimassen schneiden und gegen Stühle treten oder auf Stühlen tanzen, auf allen vieren jaulen oder sich an Stühlen reiben, auf allen vieren all die blauen Nächte runterschlingen, die keiner je gesehen hat. Frei, leicht, entschlossen und triumphierend auf allen vieren lostraben, weil er sich en...