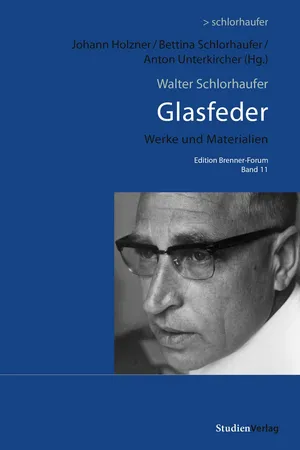![]()
Über Walter Schlorhaufer
Notiz zu einem Gedicht
von Herbert Eisenreich
Will nicht mehr
Will nicht mehr lieben
auf einer schmalen Bank,
wenn die Bäume in die Nacht reiten
und der Fluß lacht.
Will nicht mehr weggehen
von der grünen Bank,
als hätt mich einer auf-
und nicht mehr leise zugemacht.
Will sanft leben,
will das Blut glätten
und den Vers nehmen,
dreimal täglich das Gedicht:
Herr, warum liebst du mich nicht?
Walter Schlorhaufer
Der deutsche Leser wird von seinen Dichtern nicht minder als von seinen Literaturwissenschaftlern dazu erzogen, das Gedicht an Merkmalen zu agnoszieren, die der dahin zielenden Tätigkeit mehr als dem Ertrag derselben zugehören; daran, daß es als gedichtet erscheint, weil die Spuren selten gelöscht sind; am Poetischen also. Doch erst dem Vollendeten (in dem Sinne, daß unter einer bestimmten Bedingung das hier und jetzt Möglichste geleistet wurde) eignet die Unscheinbarkeit, die uns zu dem Staunen nötigt: wieso ist dies ein Gedicht?
Hier: dreimal vier Zeilen von ungleicher Länge und unregelhaftem Taktschlag, fast reimlos, beschlossen von einer isolierten Fragezeile, die auf die letzte der dritten Strophe reimt; Wörter und Fügungen, wie wir alle sie im Munde führen könnten, ohne Raffinement, ohne Finessen gesetzt; ein gar nicht kniffliger Inhalt, prunklos, ohne philosophische Anstöße oder vielrätselige Symbolhaftigkeit, ohne Handhaben für psychologische Tüftelei; und da dies mit der einfältigen Unbedingtheit des Naturgeschehens uns antritt, staunen wir ergriffener: wieso ist dies ein Gedicht?
Die erste und zweite Strophe – zwar nicht greißlerhaft wägbar, aber dem strukturellen Gewicht nach die Hälfte – erweitern, jedesmal mit ihm einsetzend, den Titel um schlichte Bilder dieses leidigen Lebens, dem der Bannruf gilt; aber noch ist es nicht abgetan, noch widersetzt es sich dem strengeren Wollen, indem es mit ungemeinen Reizen lockt, vor denen es gilt auf der Hut zu sein,
wenn die Bäume in die Nacht reiten
und der Fluß lacht.
Daher der Zwang, das „Will nicht mehr“ wiederholend zu bekräften; doch sinkt das Aufbegehren der zweiten Strophe gesänftigter schon hin:
als hätt mich einer auf-
und nicht mehr leise zugemacht.
Mühsam möchte die beiden Strophen ein zaghafter, wie zu schüchtern versuchter Reim, jeweils am Ende, zusammenhalten, doch vergeblich. Seine geringe Kraft reicht bei weitem nicht hin, all das zu bändigen, wogegen das Nicht-mehr-Wollen auftrotzt: er ist da – und das entspricht dem Wesen dessen, woran er gelegt ist –, um überschwemmt und hinweggespült, um überhört zu werden.
Schwer fielen diese acht Zeilen und lauteten unbequem, wenngleich makellos und sinnhaft, nämlich dem Unbehagen gemäß, das sie formten, da es in ihre Form sich fügte. Die dritte Strophe, mit ihr die zweite Gedicht- und Gewichtshälfte, hebt gleichfalls an mit dem „Will“ des Titels und der vorigen Strophenbeginne, wiederholt es sogar, aber klärt sich, nun eine heilere Zukunft bejahend, rasch zum exakten Lebensplan, wobei innerhalb der Steigerung des Ganzen: von der Abkehr über das Stillhalten bis zum bekennenden Schritt, in ihr eine zusätzliche sich vollzieht, allerdings schon ganz in gewisser Vorausschau:
Will sanft leben,
will das Blut glätten
und den Vers nehmen,
dreimal täglich das Gedicht:
Der Doppelpunkt bereitet drauf vor, der Strophenabstand zwingt zu sammelnde[m] Atemholen, eine Zeile lang verweilen wir noch in der Stille vor dem Sturm, aber dann läßt sich das Unausbleibliche nicht mehr verzögern: Herr, warum liebst du mich nicht? Das Selbstverständliche ward zum Wunder, dieses ward wirklich in jenem. Denn das Nichts ward zum All in dem Reim von „nicht“ auf „Gedicht“, somit in dem einzig gültigen Reim der schließenden Zeile, welche den geistigen Raum einer Strophe beansprucht, auf das ganze Gedicht. Auch ist außen nun die Entsprechung dem Reim des ersten Strophenpaares geschaffen, aber wie gegenteilig! Elementare Kräfte walten darin, Zauber durchströmt den Vorgang, denn wie sonst gelänge es diesem Reim, rückwirkend das Gedicht in sich aufzusaugen und zum Schweigen zu bringen in seinem endgültigen Einverständnis? Und welche Diskrepanz beseitigt, welche Feindschaft versöhnt er; welche Zweifel weist er zurecht, welche Ängste beschwichtigt er! Und wieviel spuktolle Nächte, fransige Tage und dumpfe oder vielgesichtige Abende eines Daseins von dreizehn Zeilen, von irdischem Himmel und Hölle kommen in ihm zur Ruhe! Gedicht und Leben, beide mündend in diesen Reim, erhalten in ihm ihre Form, weil er ihre Widersprüche und ihren Gegensatz in seinem Klange einigt: hörbar, sichtbar, greifbar – und dieses wie jenes kann nun nichts andres mehr sein als ein Gedicht (und zwar eines der erhabensten), da die Frage darauf sich reimen mußte im Willen dessen, der es kann: „Herr, warum liebst du mich nicht?“ Unweigerlich wächst daraus das Wunder: Der Reim, durch den erst die Verzweiflung möglich ist, die Liebe des Herrn zu verleugnen, gelingt als beweisendes Zeichen eben dieser Liebe, ja diese bezeugt sich erst in ihm, wenngleich das Gelingen erst den Eintritt in sie enthielt; das Gelingen des Gedichtes, welches in der Verzweiflung gelang, hebt diese auf, ohne jenes zu nichten, welches, im Gegenteil, stehenbleibt in höherer Pracht und geistigerer Fülle. Dieser Reim – von den[en] einer, die seit dem Anfang, in dem das Wort war, warten darauf, Gedicht zu werden, weil sie es immer schon sind: im Zustand des Keimes, als in die Wirklichkeit erlösbare Möglichkeit, als vergrabener Schatz aller Mythen und Märchen, auch als währender Auftrag freilich und allesfordernde Probe –; dieser Reim belohnt die Mühsal des Gedichts und damit auch die des Lebens, das sich darin, es und sich gestaltend versuchte.
Solcher Betrachtung offenbart sich das Gedicht, sofern es eins ist, als metaphysischer Bau von mathematischer Präzision. Allerdings nicht das Dichten, sondern die Ehrfurcht sollte der Leser lernen daran; und den Mut gewinnen, diese Ehrfurcht, welche höchstens den Toten gewährt wird (und das oft nur heuchelnd), endlich auch Lebenden nicht zu versagen.
Doch nun gilt’s, die Hilfslinien dieser Notiz zu tilgen: damit das Gedicht wieder rein sei und unsere Anschauung ungetrübt. Wenn jenes nicht litt und diese sich schärfte, dienten sie genug. Alles weitere indes muß jedes Gefühl für sich entscheiden, wenn es sich abermals, doch nun anders an den Versen mißt.
Felix Braun an Walter Schlorhaufer, 28.4.1953
Wien, den 28.IV.1953
Lieber Walter Schlorhaufer!
Ich stehe unter dem starken Eindruck Ihrer „Märtyrer“. Was für ein großer Fortschritt nach dem „Dignös“ ist Ihnen da geglückt! So ein Buch habe ich überhaupt noch nie gelesen. Allein die Prosa, die makellose, ist hoher Schätzung wert. Noch war ich mit der Lectüre nicht zu Ende, als ich schon an Otto Müller schrieb, sich Ihre Dichtung zu sichern.
Die einzige Schwierigkeit ist, meinem Gefühl nach, die Ironie. Einerseits muß sie als notwendiges Ingrediens bewahrt werden, andererseits geht sie manchmal zu weit. Vielleicht überlesen Sie jede Geschichte nochmals und zwar auf diesen Einwand hin. Die Ironie muß bleiben, darf aber – und das scheint mir wesentlich – nie in die Gefahr des Zynischen geraten. Das Moderne stört nicht. Ein guter Einfall war, das Wort zumeist den Nebenpersonen zu überlassen. „Die singenden Schuster“, „Sebastian“, „Die vierzig Märtyrer“, „Brief an Ursula“, vor allem „Der Verhinderte“ sind die besten Stücke. Das Gespräch zwischen Petrus und Johannes wünschte ich doch sehr anders geführt. Auch die zaubern wollende Heilige im Turm leuchtet mir nicht ganz ein.
Das Ganze nenne ich durchaus poetisch. Es hat etwas von dem Geist der byzantinischen Welt, die ja der unseren vielfach entspricht. Auch scheint mir das Buch fromm. Ich beglückwünsche Sie, lieber Dr. Schlorhaufer, zu einer solchen in der Stille geleisteten Vollendung und hoffe, daß bald viele lesen, was Sie erst nur anvertraut haben
Ihrem
Felix Braun.
Otto Grünmandl an Walter Schlorhaufer, 18.12.1956
Hall, 18.12.56
Lieber Walter,
Ich habe nun Dein Buch wieder in einem durchgelesen und benütze jetzt diesen Brief als Hilfsmittel, meine Gedanken zu ordnen.
Ich frage mich: gibt es so etwas wie eine „Wahrheit der Märtyrer“?
Eine Wahrheit unerfindlichen Inhalts, weil es keine Erklärung gibt, die das Phänomen der Märtyrer vollkommen zu deuten wüsste. Darum frage ich mich, gibt es eine solche Wahrheit, oder ist das nicht vielmehr alles Erfindung, Ausschmückung, Krankengeschichte irgendwelcher falsch verstandener Psychopathen.
Kein Zweifel an den blutigen Geschichten, sie haben sich begeben und begeben sich weiter. Aber ist dieses Leiden, diese sich durch alle Zeiten fortsetzende Qual, wirklich ein Leiden um das Einbekenntnis des Geistes? Ist diese schaudervolle Wirklichkeit Ausdruck dessen, was sie aus dem Mund ihrer Opfer zu sein vorgibt?
Gibt es „die Wahrheit der Märtyrer“?
Da erhebt sich nun, da ich das Gelesene zu überschauen und zu überdenken suche, vor meinem inneren Auge eine merkwürdige Landschaft: bizarre Formen, negative Prägungen eines Unbeschreibbaren. Ein Unbeschreibbares, das in der und durch die Beschreibung der Abdrücke, die es hinterlassen hat, mit einemmal deutlich und spürbar wird. Deutlich: man kann es deuten, das heisst: versuchen seinen Sinn zu erkennen. Spürbar, das heisst: es ist da.
Das Un...