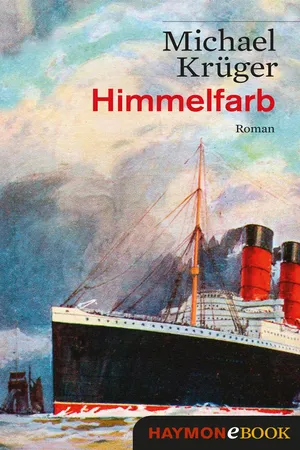![]()
XVI
Seit dem Eintreffen von Leos Brief muss ich oft an unser erstes Lager denken. Es bestand aus zwei großen runden Häusern, in denen mehrere Familien wohnten, die uns aus der Stadt gefolgt waren, etwa zwanzig Hütten der Eingeborenen, die schon länger dort lebten, und einem exzentrischen Bauwerk, das meine Residenz darstellte. Zwischen den Häusern erstreckte sich ein freier Platz, wo die Indianer auf Matten das Mandiokamehl trockneten. Gleich hinter unserer Siedlung schlossen die riesigen Bäume in der Höhe ihre Kronen zusammen und bildeten einen dämmrigen Raum, in dem die Gesetze des Dschungels galten. Zwischen den beiden Reichen vermittelten die Indianer, die eben noch schwatzend auf dem langen, dünnen Sitzbalken ihre Politik verhandelt hatten und im nächsten Moment in den Dämmer wechselten und wie vom Erdboden verschluckt waren. Da es mein erster Aufenthalt im Busch war, brauchten meine Sinne eine längere Zeit der Anpassung. So saß ich anfangs wie gelähmt auf den Holzstufen meines Hauses und starrte nur geistesabwesend in den Wirrwarr um mich herum. Es gab in all dem Gewusel keine Gliederung für das Auge, so dass es nur durch Starren, durch fixierte Blödigkeit sich dem Kollaps entziehen konnte. Ich sah alles, nahm aber nichts wahr und konnte nichts unterscheiden. Der Unterscheider war Leo. Er kümmerte sich um Menschen und Tiere, ließ Pflanzen herbeischaffen, die den Moskitos nicht gefielen, beaufsichtigte den Bau der Häuser und war mit der Anlage des Gartens beschäftigt, die er vorher in Zeichnungen festgelegt hatte, er brachte die Vorräte in Sicherheit und sorgte dafür, dass die Gerätschaften abends wieder an ihrem Platz waren. Ihn schienen weder der Lärm noch der Dreck, noch die Menschen zu stören. Nach wenigen Tagen bereits lebte er auf diesem gottverlassenen Fleck im Urwald, als habe das Schicksal ihn dafür ausersehen. Er war der Verwandler. Er gab einen Hinweis oder malte mit seinem langen Mittelfinger auf die Erde, und schon veränderte sich etwas. Selbstverständlich konnte er sich im Handumdrehen mit den Eingeborenen verständigen, die mir gegenüber düster, schweigsam, in sich gekehrt und auf eine gewisse würdevolle Art abweisend waren. Ihm gegenüber waren sie heiter, redselig und zutraulich, was meinen Hass gegen die Leute noch steigerte, dessen Heftigkeit bald meine starrende Schwermut überlagerte. Ich war vom ersten Moment an überflüssig, und je stärker ich dieses Gefühl, diese Gewissheit verspürte, desto intensiver versuchte ich meine Macht auszuspielen, der Leo ja letztendlich seine Existenz verdankte. Aber ohne seine Autorität war meine Macht sinnlos.
Vier verschiedene Lager hatte ich mit Leo eingerichtet, mit ihm in der Nachbarschaft von vier Stämmen gelebt, deren Umgangsformen nicht zu vergleichen waren, vier Sprachen hatte Leo gelernt und mir beizubringen versucht. Und auch wenn am Ende der anfangs von mir befürchtete totale Ruin unserer prekären Beziehung nicht eingetroffen war, so verlor ich doch nie das Gefühl, von ihm nicht ernst genommen zu werden. Ich war in seiner Sicht immer der deutsche Student, das verunglückte Resultat einer akademischen Dressur, unfähig, mich auf eine fremde Umwelt einzustellen, eine kraftlose Natur, die das Reine verehrte, weil sie vor allem Gemischten Angst hatte. Und tatsächlich bereitete mir das Gemisch aus Weißen und Schwarzen, Weißen und Indianern, Indianern und Schwarzen, wie es vor meinen Augen zu besichtigen war, alles andere als Vergnügen, und nicht zuletzt deshalb, weil ich es nicht verstand. Aber ich musste etwas verstehen, um eine Doktorarbeit schreiben zu können. Kein Doktorvater würde mich zwingen können, diese krause Mischung zu lieben, wie es Leo offenbar vorhatte, und ein paar paranoide Einsprengsel der Abwehr durfte meine Arbeit getrost vorweisen, doch war ein Mindestmaß von erkennender, teilnehmender Beobachtung vonnöten, um überhaupt etwas zu Papier bringen zu können. Da ich aber keine Energie aufbieten konnte, die zerstörerischen Einflüsterungen zurückzuweisen, stand plötzlich fest, dass Leo auch das Tagebuch führen sollte. Er schrieb, ich las und machte ein sinnloses Häkchen unter den Text, als letztes Zeichen einer schon längst aufgelösten Macht. In Ordnung, sollte es heißen, geprüft und für gut befunden. Korrekturen hatte ich nie vorzuschlagen. So hat Leo mir nicht nur das Leben gerettet – denn ohne ihn, das stand für mich schon nach wenigen Wochen fest, wäre ich im Urwald untergegangen, verschwunden –, sondern auch noch das Schreiben beigebracht, von dem meine ganze spätere Existenz abhängen sollte. Er lebte den Teil von mir, der zum Nichtstun verurteilt war, für mich mit. Noch jetzt, da ich diesen Bericht schreibe, zittern meine Hände, wenn ich zugeben muss, dass Leo immer noch ein Teil von mir ist, meine verbrauchten Hände, die nichts mehr richtig fassen können, diese schlappen Krallen mit den knotigen Wülsten über den Gelenken, deren Haut nicht mehr spannt.
Und schon taucht in meiner Erinnerung unsere zweite Siedlung wieder auf. Ich sehe die dichte grüne Wand der Sträucher vor mir mit den unzähligen weißen Sternchen, die in den letzten Strahlen der Sonne noch einmal aufglühen und sich dann schließen; den abenteuerlichen Philodendron mit seinen riesigen, herz-pfeilförmigen Blättern, der die dickeren Baumäste belagert und eine Unmenge dünner Luftwurzeln zeigt, die wie Schnüre zu Hunderten nebeneinander herabhängen und mit den in alle Richtungen des Raumes ausgespannten oder in lockeren Schlingen aufgehängten Lianen ein unentwirrbares System von Tauen und Strickleitern bilden, in dem die irre schreienden, kreischenden und keckernden Vögel herumhüpfen; die eigentümlich kreidig aussehende Rinde des hohen Baumes mit der schirmförmigen Krone aus zartestem Mimosenlaub, der neben meiner Residenz stand; die großen seidig blauen Falter, die mit ruhigem Flügelschlag dem Duster des Waldes entflatterten und sich in unserem Gemüsegarten niederließen, den Leo, zusammen mit den Indianern, zu einem im ganzen Distrikt berühmten Ort der Besichtigung und des gaffenden Staunens entwickelt hatte. In diesem Garten hatte er Früchte von der Größe eines Gänseeis geerntet, von anfangs grüner, später gelblicher Farbe, deren Inneres eine Menge kleiner Samenkörner enthielt, die in einer zellartigen graugrünen Substanz eingebettet lagen, deren Geschmack an Stachelbeeren erinnerte. Andere, mehligere Früchte in allen Farben und Formen wurden von ihm zu Mus verkocht und auf Fladen gestrichen. Daneben zog er Bohnen, Gurken, Kürbisse und allerhand Pfeffergewächse, die unserem Essen den Geschmack gaben. Und schließlich hatte er den Indianern beigebracht, wie sie mit den Kornfrüchten, die auf den Feldern rings um die Häuser angebaut wurden, umgehen mussten, um ordentliche Ernten zu erhalten. Leo, der jüdische Schriftsteller aus Galizien, war der ideale Gärtner.
Abends lag er in seiner Hängematte und überblickte sein Werk, den unfassbaren Reichtum, die Fülle und Üppigkeit, besprach mit dem Vorarbeiter, der neben ihm auf der Erde hockte, den nächsten Tag, schrieb und las und benahm sich insgesamt wie einer, der Europa längst aufgegeben hatte, um für immer in diesem der Wildnis abgetrotzten Paradies zu leben. Während ich der Freiheit, die ich doch, der Leipziger Universität und dem deutschen Heer entkommen, genießen sollte, nicht gewachsen war und ständig nach Ordnungsprinzipien Ausschau hielt, um mein Verhältnis zu den Menschen und der Natur zu regeln, befolgte Leo ein Prinzip des Nehmens und Gebens, des Lernens und Lehrens, des Zuhörens und Erzählens, mit einem Wort: des Austauschs, das ich nicht einmal imitieren konnte. Zu ihm gingen die Eingeborenen, vor mir hatten sie Angst. Und er ging zu ihnen, fragte sie aus, ließ sich ihre Geschichten erzählen und ihre Gegenstände erklären, sie nahmen ihn mit, wenn sie an ihren freien Tagen auf Jagd gingen oder ihren Stamm besuchten, er durfte anwesend sein bei Hochzeiten und Beerdigungen, er war der Arzt, der Richter und der Lehrer in einer Person.
Nachts saßen wir dann im Licht einer Petroleumlampe noch eine Stunde auf unserer Veranda, Leo das Tagebuch vor sich. Wenn der Tag wenig Einzelheiten erbracht hatte, die der Niederschrift wert waren, machte er thematische Zusammenfassungen. Etwa zur Reinlichkeit. Manchmal musste ich lachen über diesen Menschen, wenn er zum Beispiel mit heiligem Ernst die fehlende Praxis der Körperpflege unserer Indianer beschrieb. Er erfand immer neue Wörter, um das unsaubere, ungepflegte Äußere dieser Menschen in ein mildes Licht zu setzen. Liebevoll hielt er fest, dass sie in rauchgeschwärzten, dunsterfüllten, übelriechenden, von Unrat strotzenden Hütten hausten. Wenn sie die Haut von Insektenbissen juckte, griffen sie zu einer grauen, fettigen Tonerde, verrührten sie mit Wasser oder Spucke zu einem dicken Brei und verschmierten ihn auf der juckenden Stelle. Nahe dem Feuer trocknete diese Schicht langsam ein und wurde schließlich als feines Pulver wieder abgerieben. Leo beschrieb diese Reinigung, die oft genug die einzige war, derer sie sich befleißigten, als handle es sich um einen bedeutenden Schritt in der Geschichte der Hygiene. Selbst für das von Ungeziefer wimmelnde Kopfhaar der Eingeborenen fand er ansprechende Formulierungen. Es war fürsorgendes Mitleid, wenn eine Mutter den Kindern die schwärzlichen Läuse vom Kopf klaubte und zwischen den Zähnen zerquetschte, er bezeichnete es als einen Akt der Aufmerksamkeit, wenn diese Leute sich abends mit einer unvorstellbaren Geduld nicht nur den Kopf kratzten und immer mehr Tierchen sich von der Haut pickten und ins Feuer warfen. Alles, was eine Familie besaß, wurde regellos in einen Bastkorb geworfen, wo es zusammengeknüllt und wüst durcheinandergewürfelt liegen blieb. Brauchte jemand ein Stück, wurde der ganze Knäuel auseinandergezerrt und dadurch die Unordnung noch erhöht. Meine gutgemeinten Versuche, sie dazu zu überreden, Kleidungsstücke gut geordnet und gefaltet hinzulegen, sie zu trocknen oder zu reinigen, sie hochzuhängen und auszulüften, um den ihnen anhaftenden üblen Geruch zu vertreiben, fruchteten nichts. Dinge, die ich ihnen schenkte, schätzten sie aus Neugierde für einige Stunden, dann landeten sie achtlos im Dreck. Auch diesem gleichgültigen Verhalten den Dingen gegenüber, die ihre einzige Habe darstellten, konnte Leo noch einige gute Seiten abgewinnen, wie man in meinem Buch nachlesen kann. Er verglich es mit unserem Besitzdenken, unserer Raffgier, unserer Dekadenz, wodurch er nicht nur eine Aufwertung der Indianer erreichte, sondern mir auch noch den Ruf eines scharfen Zivilisationskritikers einbrachte, der mir bei der jungen Intelligenz hohes Ansehen verschaffte.
War die Schreibarbeit getan und das Wachstuchheft in einer verschließbaren Holzkiste verstaut, kam er mit einer brennenden Pfeife und einem großen Glas Alkohol zurück, lümmelte sich in eine Ecke der Veranda und starrte mit mir in die von einzelnen schrillen Vogelrufen durchzuckte Nacht. Der Mond schlüpfte von einer dunklen Wolkentasche in die nächste und beleuchtete fahl die Gegenstände, die wir auf unserer Terrasse für wissenschaftliche Zwecke gehortet hatten: Proviantkörbe, Töpfe, irdene Pfannen, Siebe, Matten, Mörser, Masken, Stampfer und Kalebassen. Von der Decke herab baumelten Fetische, Pfeile und Steinbeile, und in den Ecken stapelte sich kleineres Gerät, Körbchen und Trinkschalen und Schmuckstücke. Und zwischen all diesen Gegenständen, die darauf warteten, beschrieben zu werden, zogen die Ameisen Tag und Nacht ihren Weg, schwer bepackt mit Halmstückchen, Holzkohlesplittern oder Mehlkörnern.
Es war die Stunde vor Mitternacht, in der Leo sich gelegentlich mir zuwandte und mit mir sprach. Er fing die Unterhaltung stets auf vertrautem Gebiet an, indem er mir erzählte, was er am folgenden Tag machen wolle. Um die sozialen Organisationsformen zu studieren, wollte er Befragungen unter den in der Umgebung lebenden Stämmen durchführen. Mir waren derartige Untersuchungsmethoden nicht vertraut, und außerdem zweifelte ich daran, dass einer der Indianer je die Wahrheit sagen würde. Das Netz aus falschen Ansichten, schlechten Gewohnheiten und üblen Neigungen war so eng geknüpft, dass für die Wahrheit wenig Platz blieb. Aber alle Einwände konnten Leo nicht beirren. Um genaueren Einblick in die Familienstruktur zu erhalten, wollte er mit mir und einem Indianer für ein paar Tage einen Stamm aufsuchen, der ihm als besonders traditionsreich angepriesen worden war. Es stand für ihn fest, dass ich mitkommen würde. Es gab keine Widerrede. Ich musste ihm folgen, ihn nachmachen, sonst wäre ich womöglich aus unserem Lager vertrieben worden. War das „Geschäftliche“ besprochen, dauerte es nicht lange, bis er es geschafft hatte, das Gespräch in eine Richtung umzubiegen, die unweigerlich nach Deutschland führte. War er tagsüber der Urwaldmensch, der ein stattliches Lager bewirtschaftete und in Ordnung hielt, so verwandelte er sich in der nächtlichen Geisterstunde wieder zurück in einen besorgten, leidenden, verzweifelten Europäer, der die Regelmäßigkeit und Stabilität meiner von Angst ummauerten Verlorenheit mit seinen schweifenden Reden in Unordnung brachte. Dabei nahm er keinerlei Rücksicht darauf, dass ich kein Jude war, im Gegenteil, er warf mir sein Judesein gewissermaßen vor die Füße und forderte mich auf, Stellung zu nehmen. Ich wollte mich weigern, aber er hielt starrsinnig an seinen Fragen fest. Und wenn ich vorsichtig äußerte, dieses Verhältnis würde schon irgendwie wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, dann lachte er unangenehm laut in die summende Nacht. Mir war dann, als würde uns jemand zuhören. Jede weitere Hoffnung ist Selbstbetrug, rief er mir zu, das wüsste er seit Beginn der neuen Herrschaft, deren Hauptschriften er natürlich gelesen hatte, die mir dagegen gänzlich unbekannt waren. Ich musste zugeben, nichts zu wissen. Er zwang mich, einzugestehen, keine Ahnung zu haben. Ja, wenn das Glas Alkohol in seiner Hand leer war und er, den Moskitairo über dem Kopf, aufstand, um es sich ein letztes Mal zu füllen, blieb er manchmal leise schwankend vor mir stehen und schaute mich als einen Unwissenden so lange verächtlich an, bis ich zugeben musste, mich für bestimmte Dinge aus guten Gründen nicht zu interessieren. Wenn ich Glück hatte, kam er nicht wieder zurück, sondern legte sich auf sein Bett und schlief sofort ein – auch eine Eigenschaft, die ich an ihm bewunderte. Aber dieses Zurückgelassenwerden war oft noch peinigender als seine Aggressivität. Solange ich mit ihm auf der Terrasse saß und von denselben Moskitos, Bienen und Mutuka-Bremsen belagert wurde, solange er es mit seiner Würde vereinbaren konnte, mich überhaupt wahrzunehmen und mir zuzuhören, solange uns die eine Nacht umgab mit ihren starrenden Augen, so lange konnte mir nichts Lebensbedrohendes zustoßen. Selbst in seiner Zurückweisung war ich sicher. Ob er ahnte, welche Macht er über mich besaß? Er wusste es, er musste es wissen.
Wenn ich am nächsten Morgen mich zu erinnern versuchte, über was wir nachts gesprochen hatten, war er schon unterwegs. So musste ich allein mit schwerem Kopf im Schatten sitzen, der Geldgeber, der nichts zu sagen hat, und den Menschen zusehen, die ihrer Arbeit nachgingen. Ich selbst besaß nichts, was ich lieben konnte. Die Bücher? Die Natur? Die Wissenschaft? In der Luft lag ständig ein Geruch von überreifen Früchten, der meine morgendliche Melancholie noch vertiefte. Wie ein Tier äugte ich durch den Perlenvorhang, der das sogenannte Schlafzimmer von der Terrasse trennte. Leo war der Dorfgründer, der instinktiv wusste, dass er dem erinnerungslosen Urwald, in dem es keine Straße, kein Denkmal, keinen Mittelpunkt gab, sein Gesetz entgegenstellen musste. Sein Gesetz war der Garten, die Anlage, die Zusammenführung der extremen Lebensbedingungen auf einem Punkt, das verschiedene Essen, das nebeneinander eingenommen wurde, die Kleidungsvielfalt, die verlangsamte Zeit, die Erinnerung und die Erzählweisen. Hätten wir Zeit gehabt, dann wäre Leo ein Stadtgründer geworden, ein Held in heilloser Zeit, der dem Urwald die Zunge gelöst und ihn zum Sprechen gebracht hätte. Wir müssen uns seiner Mitteilungen vergewissern, weil das die einzige Möglichkeit ist, unsere jetzige Existenz zu organisieren, teilte er mir mit. Aber ehe es dazu kommen konnte, mussten wir schon wieder aufbrechen und unsere Farm, Leos Farm, dem gefräßigen Wildwuchs überlassen.
All das sah ich vor mir, wenn ich morgens, in sicherer Position hinter dem Vorhang, dem geschäftigen Treiben in unserer Siedlung zusah. Aber mein Leben war damals auf Fragen nicht eingerichtet, weil ich blind war für gesellschaftliche Wahrheiten. In mir kochte nur der Neid und hinderte mich daran, die unverhoffte Schönheit zu erfahren. Pessimismus und Fatalismus, die unheiligen Zwillinge, beherrschten meinen Tagesablauf. Einmal besuchte uns ein deutscher Pater aus der nächstliegenden Mission, der mit Schrecken unsere eigentümliche Familie betrachtete. Er äußerte unvermittelt die Ansicht, der Neger gedeihe am besten und fühle sich am wohlsten, wenn er in einem dienenden Verhältnis zu Weißen stehe. Wenn er freundlich behandelt werde, erkenne er ohne Hass die Überlegenheit der Weißen und füge sich ohne Murren in den bescheidenen Platz, den ihm die Natur in der Stufenleiter ihrer Wesen zuerkannt habe. Wir saßen auf der Veranda und wurden von zwei Schwarzen aus seinem Gefolge bedient. Als er noch weiter ging und meinte, der Neger sei treu wie ein Hund, sprang Leo vom Tisch auf und verließ unter Verwünschungen das Haus. Allein war ich nicht fähig, den Redefluss des Paters zu stoppen oder umzulenken, weil dieser Gottesmann offenbar froh war, seine Ansichten in vollem Umfang in deutscher Sprache vortragen zu können.
Seit dem Altertum, so fuhr er nach Leos Abgang ungerührt fort, sähen wir die schwarzen afrikanischen Stämme nacheinander mit allen Kulturvölkern in Verbindung treten, aber immer träfen wir ihre Angehörigen in derselben Lebensstellung als Sklaven und Diener. Das Beispiel der vorgerückteren Nationen rege sie nie zum Nacheifer an, sondern belasse sie seit Jahrtausenden im gleichen Zustand von Rohheit. Die schwarze Rasse, so beschloss er diesen Teil seines Vortrags, sei in ihrem unvermischten Zustand der Zivilisation unzugänglich.
Ich sehe noch heute seine hervorspringenden Augen, die mich über den Rand seines Schnapsglases fixierten, seine schmatzenden Lippen und die knotigen Hände, mit denen er seine Rede unterstrich. Und ich spüre noch heute meine Unfähigkeit, ihm das Wort abzuschneiden, weil ich an meine Leipziger Lehrer denken musste, die eine ganz ähnliche Lehrmeinung vertraten. Die Zunge des Negers ist zu dick, um zivilisierte Hochsprachen zu artikulieren, aber sie reißen den Mund immer weit auf, schreien, jauchzen und sind kaum imstande, leise zu sprechen. Der Indianer dagegen, ohnehin schüchtern, trübselig und schweigsam, erhebt nur selten seine Stimme und spricht stets mit zusammengepressten Zähnen. Aber auch an den Europäern ließ er, soweit ich ihn verstand, kaum ein gutes Haar, auf jeden Fall seien sie, aus rassespezifischen Gründen, nicht in der Lage, Südamerika zu kultivieren. Sie schwitzen zu stark, hatte er mir in seinem meckernden Schwäbisch zugerufen, seien also nur als Herren zu gebrauchen. Für diese Region sei ein neues Geschlecht erforderlich, eine Rasse, die körperliche Widerstandskraft und geistige Regsamkeit besitze, und für die physische Kraft sei der Neger zuständig.
Er war in Treichtlingen geboren, hatte neben der Theologie auch Geschichte studiert und ein sogenanntes Standardwerk über die Inquisition verfasst, das er ganz zufällig bei sich trug und mir zur Lektüre leihweise überließ. So durfte ich denn, unter seinen blubbernden Kommentaren, nachlesen, wie die heilige römische Kirche ihre Kinder ernährt hatte, ganz ohne Beimischung des Unkrauts der verschiedenen Irrtümer, welche bis in unsere Zeiten den größten Teil Europas geschädigt und angesteckt hatten. Besonders die Beispiele aus Brasilien empfahl er mir zum Studieren, wo die Folter am unbarmherzigsten ausgeübt worden war. Zur Erzwingung des Geständnisses benutzte man entweder einen Flaschenzug, mittels dessen der Angeklagte an der Zimmerdecke aufgehängt wurde, wobei ihm schwere Gewichte an den Füßen hingen, oder man spannte ihn, an Händen und Füßen gefesselt, über eine Bank und flößte ihm ununterbrochen Wasser ein, oder man schloss seine Füße in einen Bock, bestrich die Sohlen mit Fett und stellte ein Kohlebecken darunter. In Brasilien durfte, aus humanitären Gründen, nur eine Stunde lang gefoltert werden, fügte er aufgeregt hinzu, in anderen Ländern war eine Verlängerung möglich. Christi nomine invocato: Das Urteil...