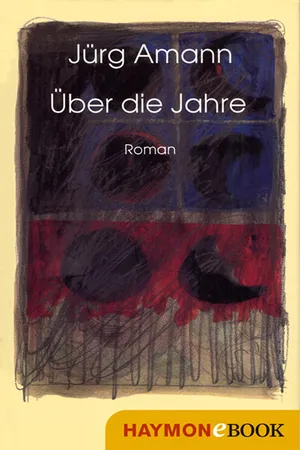![]()
Das Buch der Tage
Wie man nicht weiß, wie es anfängt. Wie es einfach begonnen hat. Wie man plötzlich ein Paar ist. Und dann wieder nicht mehr. Und wie man nicht weiß, wie es aufhört.
Wie in ihrem Fall der Anfang am Morgen des 12. August ist. Kurz nach neun. Am gemeinsamen Arbeitsplatz. Seinem ersten. Ihrem wievielten? Nachdem er sein Studium gerade beendet hat. Und sie aus Italien zurück ist. Von einem Sprachaufenthalt in Siena. Wie es wahrscheinlich ein Montag ist.
Wie sie einander vorgestellt werden von einem Herrn R., der jetzt sein Chef ist. Der ihn durch alle Böden und Zwischenböden des Hauses führt, das jetzt sein Haus ist. Und über den Schnürboden, der die linke mit der rechten Seite des Hauses verbindet. Vor und hinter der Bühne, die jetzt die Mitte der Welt ist. Zuletzt zu ihr, dem Fräulein von der Zentrale, die in der Mitte der Mitte der Welt sitzt.
Wie sie ihm also vorgestellt wird. Oder er ihr. Weil sie ja vor ihm da ist. Weil sie ihre Stelle pünktlich, also zu Monatsbeginn, angetreten hat, wie es normal ist, er aber zwei Wochen zu spät kommt. Wie sie zwar beide neu sind, er für sie aber der Neue ist, sie für ihn eine schon Vorgefundene.
Wie sie noch unsicher sind. Er noch unsicherer als sie. Wahrscheinlich um die zehn Tage, die sie ihm auf dem neuen Parkett an Erfahrung voraus hat. Wie sie auf jeden Fall, obwohl sie die an Jahren Jüngere ist, die Unsicherheit besser überspielen kann. Wie sie überhaupt besser spielen kann, also besser an diesen Ort paßt, an dem es ums Spielen geht. Wie ihm das sofort auffällt. Und wie er sich an sie hält.
Wie er, wenn er eine Frage hat, nicht die fragt, die schon lange hier sind, sondern die, die am ähnlichsten neu ist wie er. Wie sie mitten im Unbekannten für ihn das Bekannte ist. Wie sie sich, einer beim andern, an der gemeinsamen Unsicherheit halten. Wie das die gemeinsame Stärke gegen die Starken wird. Wie es ganz einfache Sachen sind. Daß sie ihm, auf seine Frage, erklärt, wo die Bleistifte sind, daß sie ihm, auf sein Bitten, eine Telefonnummer heraussucht, daß sie ihm in seiner Hilflosigkeit hilft, wenn das Kopiergerät ohne Papier ist. Oder das Kopierte zu klein wird. Oder zu hell oder zu dunkel. Wie sie sich dabei in die Augen schauen.
Oder daß sie dann Italienisch kann und er nicht. Obwohl er einen italienischsprachigen Großvater gehabt hat. Sie aber eine Art italienische Großmutter, jedenfalls die Ziehmutter der Mutter, in Mailand, die immer noch lebt – sie hat es ihm einmal erklärt, später noch einmal, er hat es nicht ganz begriffen. Wie er das Italienische jetzt können müßte, um für das Stück, das er zu betreuen hat, ein Bild von der Schweizer Botschaft in Rom zu beschaffen, wie sie im letzten Jahrhundert gewesen ist. Wie sie es für ihn tut. Und wie er ihr dafür den obligaten Kaffee verspricht.
Wie der Kaffee aber zum Wein wird. Wie sie sich zum erstenmal gegenübersitzen, in diesem spanischen Weinlokal, das er ihr vorgeschlagen hat, weil es seit seiner Studienzeit in dieser Stadt sein liebstes geblieben ist. Anfangs, nach Arbeitsschluß, am frühen Abend, noch fast allein, später, spät in der Nacht, in einem Gedränge von Menschen, in Rauchschwaden gehüllt, in der hintersten Ecke, sie mit dem Rücken zur Wand, er mit Blick in den Spiegel, der im Breitformat hinter ihr hängt, so daß er, seitenverkehrt, den ganzen Raum überblicken kann. Aber er hat ihn ja längst aus den Augen, statt dessen sich immer tiefer mit seinen Augen in ihren Augen verloren, die auffällig groß sind und auffällig weit auseinanderstehen und scheu sind und gleichzeitig brennen, in der Hitze ihres Gefechts. Wie sie über Kafka reden und über Kafka streiten. Wie sie sich ereifert, er aber ruhig bleibt. Wie sie sich wehrt, als er von Kafkas Freundin als einer Tippmamsell spricht. Und wie er ihr bis ganz zum Schluß, zum bitteren und süßen Ende, verschweigt, daß er ein Buch über Kafka geschrieben hat. Und wie sie erschrickt, als er es endlich sagt, und wie sie böse wird und ihn fragt, warum er das nicht von Anfang an gesagt habe, wenn sie das gewußt hätte, hätte sie es doch niemals gewagt, so einfach draufloszureden, und er ihr antwortet: darum. Und wie er ihr dann, als sie auf der Straße stehen, um Mitternacht, und auf die zwei letzten Straßenbahnen warten, die sie nach Hause bringen, in verschiedene Richtungen, an der Haltestelle vor dem Theater, an dem sie tagsüber arbeiten, einen Kuß auf die Stirne drückt. Möglicherweise ist das im Regen. Und möglicherweise ist es inzwischen September.
Wie sich das wiederholt. Wie sie wieder in der Bodega sitzen. Bei Wein und Salami. Diesmal am runden Tisch. An einem wärmeren Abend. Bei offenen Fenstern, die auf die Gasse gehen. Auf diese Wand gegenüber, die angestrahlt ist, mit den Fresken aus der Manesse-Handschrift. Sie reden über die Minne. Und plötzlich bemerken sie, daß ihnen der ganze Tisch zuhört. Alles weiß sie. Alles erzählt sie ihm über die Zürcher Liedersammlung. Es ist ihre Stadt, er ist nur zugezogen. Und von da wendet sich das Gespräch zu den Märchen. Er sagt, daß das Märchen die bestehenden Zustände bestätigt. Weil es in ihm immer nur auf den Helden ankommt. Alles andere darf ihm geopfert werden. Daß es gar nicht das Verdienst des Helden ist, daß er ans Ziel kommt. Nur die Jahre des Banns oder des Fluchs sind zufällig abgelaufen. Die Dornenhecke wäre auch ohne ihn aufgegangen. Dornröschen wäre auch ohne den Kuß des Prinzen erwacht. Er ist nur zufällig zum richtigen Zeitpunkt da, und die anderen vor ihm nicht. Er erfüllt nur zufällig das im Märchen sich immer wiederholende Gesetz. Und daß er andere Märchen schreiben will, in denen es um die anderen geht, die es nicht schaffen. Um die ersten und zweiten Brüder, um die Stiefbrüder und Stiefschwestern, um die Unhelden und Antihelden, die über die Welt straucheln. Oder über sich selbst. Und plötzlich stockt das Gespräch, weil sie wieder bemerken, daß es um sie herum still geworden ist. Und dann gehen sie noch ein Stück Weges zusammen, die Rämistraße hinauf, bis zu der Tramhaltestelle, an der sich ihre zwei Linien verzweigen.
Wie sie sich über Fellini streiten, über „Amarcord“, über „Roma“, über die „Vitelloni“. Ihr ist er zu wenig politisch, ihm ist er in der Satire politisch genug. Sie hat Italien am eigenen Leib erfahren, hat dort gelebt, hat Freunde dort, liebt es, er nur am Leib der eigenen Mutter, dem er in diesen Filmen vervielfacht und vervielfältigt in tausend Verzerrungen, von denen er sich distanzieren kann, wieder begegnet. Sie findet das frauenfeindlich, er befreiend und lebensrettend. Mammaverschlungenheitüberwindend. Wie er sich kaum mehr von seinem liebsten, von „Otto e mezzo“, zu erzählen getraut. Von Gelsomina, der Dicken, die vor den Kindern am Strand für ein paar Lire die Beine öffnet. Und von seinem Traum, den er dem Traum Guidos im Film nachgebildet hat, seine Großtante mit wehenden schlohweißen Haaren an einem Seil hoch über der Erde als Drachen fliegen zu lassen. Und wie sie landet, schmal, kaum mehr ein Hauch, alles Körperliche im Flug in der Reibung der Luft zerrieben, mit flatterndem schwarzem Mantel, die nackten, gläsernen Füße gegen den Sand der Wüste gestemmt. Und wie sie ihm nach diesem läuternden Flug die liebste Frau in der ganzen Verwandtschaft der Frauen ist.
Wie sie sich überhaupt immer streiten auf diesem Fest. Bei dieser Frau B. Einige sagen auch Fräulein. Die das Leben für das Leben des Vaters geopfert hat. Den sie pflegt, seit die Mutter gestorben ist. Die Schwester ist aus dem Haus, verheiratet, sie ist zurückgeblieben. Hat auf die Liebe, die sie auch gehabt hat, in Frankreich, verzichtet. Man sieht es ihr manchmal an. Sie schreibt Gedichte, die keiner gelesen hat. Langsam ist sie alt geworden neben dem Vater und muß jetzt aufpassen, daß sie in ihrem Büro, in dem sie Dramaturgiesekretärin ist, nicht eines Tages wie ein Regenschirm, weil es nicht regnet, stehengelassen wird. Bei der sie also eingeladen sind. Das ganze Haus, mehr oder weniger. Zum Saisonbeginn. Die Proben laufen ja schon, bald ist die erste Premiere. Um sich noch einmal so richtig auf alles zu freuen, bevor wieder die Frustration beginnt, die sie noch nicht oder erst vom Hörensagen kennen. In ihrer Villa am Waldrand. Oder besser in der Villa des Vaters. Hoch über dem Zürichsee. Durch die zum erstenmal auch bei ihnen der Wunsch erwacht, so zu wohnen. Oder zumindest die Fantasie. Jedenfalls reden sie beim Weggehen, spät nachts, bevor sie zu jemand Fremdem ins Auto steigen, miteinander vom Wohnen. Sie wohnt noch bei den Eltern, er hat eine kleine Wohnung, in der er ein Zimmer an eine Studentin vermietet.
Am nächsten Morgen, im Theater, wissen schon alle, auch die, die beim Fest gar nicht gewesen sind, daß sie ein Paar sind. Nur sie wissen es nicht. Herr R. sagt, daß er es von Frau E. weiß. Wie sie lachen, als man ihnen sagt: was sich streitet, das liebt sich. Und wie er sich fragt, was das soll, als Herr H., das Faktotum, ihn, als er Papier holt, beiseite nimmt und ihm hinter vorgehaltener Hand verrät, daß das Fräulein aber einen Verlobten hat, einen Ausländer, einen Italiener.
Wie sie eines Morgens, als er wie immer nach dem Frühstück, das er im Café um die Ecke zu sich nimmt, zu spät ins Theater kommt, nicht an ihrem Platz ist. Wie er nach ihr fragt. Wie er hört, daß sie krank ist. Und wie er ihr Blumen nach Hause schickt.
Als sie wieder gesund ist, erzählt er ihr, was inzwischen gewesen ist. Wie die Proben vorangehen. Wie es sich zuspitzt. Wie er damit nicht zurechtkommt, daß die Schauspieler scheinbar mit Leichtigkeit etwas spielen, das sie in Wirklichkeit gar nicht kennen. Zum Beispiel die Liebe. Mit ihren schnellebigen Affären. Daß er es ihnen auf jeden Fall nicht zutraut, so wie er sie inzwischen kennt und so wie er sich die Liebe vorstellt. Wie er sich dagegen sträubt, daß man sie überhaupt spielen kann. Wie er das Wesen der Liebe dadurch in Frage gestellt sieht, daß sie auch spielbar ist. Wie er es nicht wahrhaben will. Wie ihm das Spiel als Lüge erscheint. Wie er Angst hat, sich anzustecken. Wie er sich fragt, ob er nicht den Beruf verfehlt hat. Aber sie antwortet ihm, daß sie denkt, daß er gerade darum am richtigen Ort sei.
Wie er ihr vom Stück erzählt. Was alles in diesem Stoff liegen würde. Wie wenig der Autor daraus gemacht hat. Was er daraus machen würde.
Wie das Programmheft aus der Druckerei kommt. Sein erstes. Es ist noch feucht. Es riecht nach Druckerfarbe. Wie er ihr ein Exemplar hinunterträgt, ins andere Stockwerk, und auf den Tisch legt. Wie sie es gleich anschaut, es dann über Nacht liest, ihn anderntags dafür lobt. Wie er auch vom Intendanten gelobt wird, ein paar Tage später. Wie er es ihr brühwarm erzählt. Wie es ihm wie das Meisterstück vorkommt, mit dem er die Meisterprüfung bestanden hat. Wie er von da an dazugehört.
Wie sie sich bei der Premiere im Dunkeln, an das sie sich langsam gewöhnen, entdecken. Sie stehen. Jedes für sich, hinter einer anderen Säule. Sie haben die Plätze, auf die sie Anspruch gehabt hätten, anderen überlassen, die sonst keinen Platz bekommen hätten. Sie sind zu nervös zum Sitzen. Vorn läuft das Spiel. Mit glühenden Gesichtern, mit aufgerissenen Augen sind sie dabei. Wie ihre Herzen schlagen, wie sie mit den Schauspielern mitfiebern, wie sich ihre Oberkörper nach vorne beugen, wie sie sich fast nicht mehr hinter den Säulen halten können, wie sie einander Blicke zuwerfen, wie sie sich insgeheim Mut machen. Als ob es auch ihre Premiere wäre.
Wie sie sich gegenübersitzen, auf einer Insel von der Größe des weißen Tischtuchs, das den Tisch zwischen ihnen bedeckt, während um sie herum das Fest tobt. Premierenfeier heißt das. Mitternacht ist vorbei. Wie sie von Gott und der Welt reden. Wie es ihm wieder auffällt, daß Frauen, wenn sie im allgemeinen reden, das Spezielle meinen. Wie er sich plötzlich vorstellen kann, daß sie, wenn sie von der Welt spricht, eigentlich ihn meint. Wie er sich ein wenig davor zu fürchten beginnt. Wie es später und später wird. Wie er ihr endlich von seiner Angst erzählt, die er vor Beziehungen hat, woher sie kommt und warum er sie braucht. Wie sie ihm sagt, daß sie sie auch hat, daß sie schon zwei Verlobungen ihretwegen wieder gelöst hat. Wie er Dämme gegen sie baut, aus Bröseln, von einer Semmel, die er gegessen hat, die er auf dem Tischtuch als Grenzlinie zwischen sie und sich legt. Wie sie sie plötzlich, mit einer entschlossenen, raschen Bewegung der Hand, mit dem Zeigefinger durch sie hindurchfahrend, zerstört. Und wie sie sagt, daß sie, da sie beide vor einer Beziehung Angst hätten, voreinander keine Angst zu haben bräuchten.
Wie sie sich dann in der Nacht gegenüberstehen, ratlos, und nicht wissen, was jetzt zu tun ist. Wie sie frieren, und wie er sie plötzlich wieder, im Schutz der Dunkelheit, die seine Röte verbirgt, auf die Stirn küßt, bevor sie ins Taxi einsteigt. Und er allein den Berg hinaufrennt, zu sich nach Hause, in seine kalte Wohnung, während vereinzelt schon Vögel, die sich in der Stunde getäuscht haben, pfeifen.
Wie sie ihm „Gehen“ von Thomas Bernhard zu lesen gibt. Er liest es sofort. Aber er muß zu lesen aufhören, weil sich ihm beim Lesen die aberwitzigen Kreisstrukturen der Sätze so sehr in seine Hirnstrukturen eindrehen, daß er Angst bekommt, wahnsinnig zu werden. Wie er ihr davon erzählt. Wie er das Buch erst nach einigen Wochen zu Ende liest. Wie es aber von da an zwischen ihnen ein gemeinsamer Nenner ist. Wie sie, wenn er „tschechoslowakische Ausschußware“ sagt, lachen muß. Wie er, wenn sie vom „Rustenschacherschen Hosenladen“ spricht, nicht anders kann, als zurückzulachen.
Er gibt ihr eine Geschichte zu lesen, die er selber geschrieben hat, früher, in der ein Fallensteller, der natürlich er selber ist, Fallen um sich selber auslegt, Fallgruben aushebt, damit die anderen, die sich ihm nähern wollen, hineinfallen, so daß er allein bleibt, in seiner Mitte, und seine Ruhe hat, und die eigentliche, wirkungsvollste, letzte Falle, für die, die sich durch alle anderen nicht haben von ihm abhalten lassen, soll diese Geschichte selber sein. Aufgescheucht antwortet sie ihm, sie ist zornig, sie schreit ihn an. Was sie ihm getan habe. Was er sich einbilde. Sie wolle doch gar nichts von ihm. Wie sie dabei blaß ist. Wie sie zittert dabei. Wie er ihr sagt, daß sie ihn falsch verstanden habe. Wie er aber weiß, daß sie ihn richtig verstanden hat. Wie er nicht mehr recht weiß, ob er von ihr richtig verstanden hat werden wollen.
Wie sie sich von ihren früheren Lieben erzählen. Wie er nicht viel zu erzählen hat. Wie sie ihm erzählt, daß sie einmal, ein einziges Mal, in Italien, als junges Mädchen, mit einem Mann geschlafen hat, mit dem sie gar nicht hat schlafen wollen, mit ihrem Lehrer, den sie verehrt und der ihre Verehrung ganz falsch gedeutet hat, dem sie sich aber nicht nein zu sagen getraut hat, nicht deutlich genug, in jenem Sommer, im Freien, hinter der Kirche, wie es aber ein Mißverständnis gewesen ist. Wie ihm das im nachhinein noch für sie weh tut. Aber ebenso sehr auch für sich. Daß jemand sie hat haben können, den sie gar nicht gewollt hat. Wie er selber dadurch verletzt ist. Wie er eifersüchtig auf ihr Vorleben ist.
Wie sie zum erstenmal zusammen ins Kino gehen. Ausgerechnet in „Gotho, die Insel der Liebe“. In Schwarz-Weiß. Ungefähr in der Mitte des Films, im Unsichtbaren, legen sie ihre Hände ineinander. Aber am Schluß, als das Licht wieder angeht und sie sich lassen und jeder für sich aufsteht und sich in seine Jacke hineinzwängt, tun sie so, als ob sie nichts davon wüßten.
Zusammen fahren sie zum Stadtrand hinaus, mit der Elf oder der Dreizehn, ins beste Gastspieltheater der Stadt, um Bernhards „Macht der Gewohnheit“ zu sehen, mit Bernhard Minetti. Wie sie begeistert sind, vom Stück und vom Schauspieler, den sie zum erstenmal sehen, vom „Forellenquintett“, das gespielt werden muß, obschon keiner es spielen will. Noch monatelang werden sie bei jeder Gelegenheit „Morgen Augsburg“ sagen, um sich aufzumuntern, wenn ihr eigenes Theater oder sie selber in einen trostlosen Trott verfallen. Während sie jetzt, als er nach der Vorstellung mit seinem Freund, den er getroffen hat, geistig das Pfauenrad vor ihr schlägt, immer mehr auseinandertreiben. Sie steht daneben und redet nicht mit. Längst in der Straßenbahn, längst auf dem Heimweg, längst wieder mit ihm allein, sagt sie noch immer kein Wort. Sie schaut aus dem Fenster ins Dunkel. Und er betrachtet sie von der Seite. Wenigstens im Spiegel der Scheibe versucht er einen Blick von ihr zu erhaschen. Einen Anhaltspunkt zu bekommen. Es gelingt ihm nicht. So daß er sie fragt, was denn sei. Und sie antwortet: nichts. Wie er daraufhin, ohne selber noch etwas zu sagen, obwohl er noch lange nicht aussteigen müßte, ohne zu grüßen an der nächsten Station aussteigt. Und sie ihn Tage später, als sie wieder Worte gefunden haben, rückblickend des geistigen Hochmuts bezichtigt. Wie er ihr erklärt, daß ihn ihre Reaktion, ihr Schweigen voll Vorwurf, an die Reaktion seiner Mutter auf seinen Vater erinnert habe. Vor der er geflohen sei.
Wie ihm trotzdem, als ihn Freunde einladen, in einem kleinen Bauernhaus, das einer von ihnen vor den Toren der Stadt gemietet hat, mit ihnen Silvester zu feiern und dazu eine Begleiterin mitzubringen, niemand anderer einfällt als sie. Mit dem er den Jahreswechsel begehen möchte. Er überlegt lange. Dann denkt er, warum immer vom Unmöglichen träumen, warum nicht das Mögliche tun. Wie sie zusagt. Und wie sie also hinausfahren, mit Zug und Postauto, beladen mit Wein, Rum und Zuckerhut, den Ingredienzien der Feuerzangenbowle, für die sie zuständig sind.
Wie da, während die Stunde fortschreitet, darüber philosophiert wird, warum die Fliege, die einem eben noch um die Ohren gesaust ist, unwiderstehlich von der Flamme angezogen wird, obwohl sie sich daran die Flügel verbrennt. Wie sich, vom Alkohol angeregt, die wildesten Theorien darüber bilden. Im Gelächter rund um den Tisch schlagen sie schallend zusammen. Wie sie nicht merken, daß alles, was sie sagen, ohne den Alkohol gar nicht lustig wäre. Daß ihr Lachen also vollkommen fehl am Platz ist. Wie es schon gegen Mitternacht geht. Wie ihre Köpfe brennen, wie ihre Augen brennen, wie die Kerzen brennen, wie der mit Rum übergossene Zuckerhut brennt. Wie die Freunde, als alles getrunken ist, ins Dunkel und in die Kälte hinausgehen, um den Jahreswechsel unter freiem Himmel zu feiern. Und sie zwei allein in der Stube zurückbleiben. Ohne sich abzusprechen, unter dem gleichen Vorwand. Weil es ihnen draußen zu kalt ist. Weil sie jetzt das Licht und die Wärme wollen. Auch auf die Gefahr hin, sich daran zu verbrennen. Wie sie um Mitternacht vom Tisch aufstehen und um den Tisch herum aufeinander zugehen und sich in der Mitte des Raums um den Hals fallen und sich unter der Lampe zum erstenmal wirklich küssen. Erst dann, mit diesem offenbaren Geheimnis, gehen sie zu den anderen hinaus, um sich in ihre übermütige Schneeballschlacht einzumischen.
Wie sie danach schläfrig werden. Wie sie erhitzt sind und frieren. Wie sie still und starr auf dem Rücksitz des Wagens sitzen, in dem sie ein Freund mit in die Stadt zurücknimmt. Wie sie ihn trotzdem, und obwohl es schon gegen Morgen geht, fragt, als sie aussteigt, ob er noch zu ihr hinauf will. Wie er ja sagt. Wie er sie aber mißverstanden hat. Weil er glaubt, daß sie ihn gefragt hat, ob er jetzt mit ihr schlafen will. Und sie ihm auch nicht sagt, daß sie das nicht gefragt hat. Wie es aber nicht geht. Wie sie nebeneinander auf dem Bett liegen und für alles zu müde sind. Wie er bei sich denkt, daß man mit einer Frau, wenn man sie erst einmal in den Händen hält, gar nicht so viel anfangen kann, wie man gedacht hat, als man sie noch nicht in den Händen gehalten hat. Weniger jedenfalls als mit sich selbst. Wie er sie streichelt, wie sie aber bald einmal zu Ende gestreichelt ist. Wie sie ihm für das Streicheln zu nah ist. Wie er, um sie zu sehen, ein wenig zurückweicht. Wie er ihr sagt, daß ihr Leib schön sei; wie es ihm aber vorkommt, als klinge das wie eine Entschuldigung für seine Erschöpfung.
Wie sie noch etwas reden. Wie er ihr, mitten im Winter, an der Grenze zum Schlafen, den „Nachsommer“ ans Herz legt. Wie er davon erzählt, wie die ideale Ordnung der Buchwelt beim Lesen heilsam, gleichsam idealisierend, also ihn verbessernd auf ihn übergegangen sei, daß er förmlich gespürt habe, wie ihm dieses Buch im wörtlichen Sinn gut getan habe. Von se...