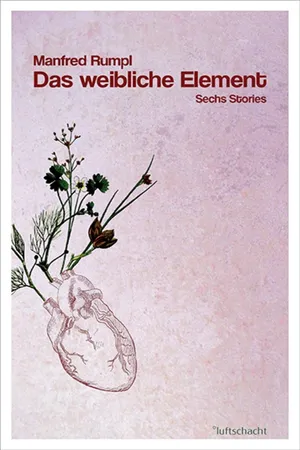![]()
Die Freundin meines Freundes
Noch saßen wir uns in einem kleinen Innenstadtbistro befangen gegenüber, ein jeder verstrickt in seine eigene Geschichte. Nach Jahren der Entfremdung hatten wir uns nun verabredet, um endlich zu klären, wie das damals wirklich war, oder doch wenigstens, wie es gewesen sein könnte. Zeit ist relativ und umso mehr sind es unsere Gefühle, die sich mit der Zeit in etwas Anderes verwandeln: Etwas, das von der Zeit erst herausgearbeitet wird. Wie die Form einer Landschaft von der Bewegung eines Gletschers.
Toni wirkte ruhiger als früher. Er sprach langsamer und ohne jene Schärfe im Ausdruck, die noch Nebensächliches zum Funkeln brachte. Er sei seit ein paar Jahren verheiratet, sagte er, habe eine Tochter und gehe einer geregelten Arbeit nach. Dinge, die uns früher wenig bedeutet hatten, damals, als wir in erster Linie spontan waren, hedonistisch, rebellisch und unberechenbar. Toni war einer meiner besten Freunde geworden, nachdem wir aus der uns umgebenden Idiotie ausgebrochen waren, um uns eine Gegenwelt zu erschaffen. Das alles begann etwa Mitte der Siebzigerjahre, als Tom Waits seine ersten Platten veröffentlichte.
Wir bestellten zu trinken. Essen mochte keiner. Vielleicht käme der Hunger ja, wenn wir uns ausgesprochen hätten. Eine plötzliche Nervosität ließ mich meine Taschen nach Zigaretten durchsuchen. Toni verfolgte das mit Blicken und lächelte nachsichtig. Er rauche nicht mehr, nein! Ich war immer ein so genannter Gelegenheitsraucher gewesen, während er entweder gar nicht oder aber vierzig Stück pro Tag geraucht hatte, und nur sehr starkes Zeug: Rothändle, Lucky Strike, Gauloises ohne Filter.
Mehr als zehn Jahre waren wir eng befreundet gewesen, bevor es zum Zerwürfnis kam. Heute noch glaube ich, dass meine Rolle in diesem Drama nicht nur die des rücksichtslosen Bösewichts war, was er wohl nie so sehen konnte, denn er gab all die Jahre ausschließlich mir die Schuld am Zerbrechen unserer Freundschaft. Da waren meiner Meinung nach aber ein paar Missverständnisse mit im Spiel, die nie richtig geklärt worden waren. Mit unserer Freundschaft zerbrach damals auch die Möglichkeit, die Wahrheit über dieses Scheitern herauszufinden. Man kann leider nur mit Worten darüber sprechen, dass auf Worte kein Verlass mehr ist.
Ich saß in der großen Küche unserer WG beim Frühstück. Allein am schweren, rohen Tisch, las ich einen Zeitungsartikel über eine in einer Semmel gebackene Maus, in die jemand vor kurzem gebissen hatte. Der Bericht war irgendwie komisch, fand ich, gerade weil er ernst sein wollte und auf allerhand Bezug nahm, woran ich nicht glaubte. Gut gelaunt, biss ich nebenbei von meiner Semmel ab, auf der die Marmelade meiner Mutter in der Morgensonne blutrot glänzte. Bis ich plötzlich ein seltsames Geräusch wahrnahm, ein Geräusch, das zugleich außer und in mir war, vom Krachen einer reschen Semmel aber so verschieden, dass ich misstrauisch wurde. Meine neugierige Zunge ertastete die Körnigkeit feinen Sandes. Ich hatte auf etwas ziemlich Hartes gebissen. Ich spuckte den Bissen auf den Teller vor mir, setzte die Kaffeetasse ab und verfluchte die Bäcker dieser Stadt. Dann durchsuchte ich den Teig, aber was ich da fand, war nichts, was ein schlampiger Bäcker zu verantworten hatte. Ein Zahn! Und zwar nicht irgendeiner, sondern mein rechter Augenzahn, wie meine Zunge frustriert bestätigte.
Kurz vor meinem achtundzwanzigsten Geburtstag musste ich an eine zweifellos makellose Semmel meinen ersten Zahn verloren geben. Dieser Zahn war vor fünfzehn Jahren einer Wurzelbehandlung unterzogen worden und schon seit langem hinüber, dass er aber an einer gewöhnlichen Semmel zerbrach, kränkte mich dann doch. „So komme ich mir also selbst abhanden!“ Das soll Montaigne bei dieser Gelegenheit ausgerufen haben. Ein schwacher Trost, musste ich doch zugleich zur Kenntnis nehmen, dass ich mir zurzeit keinen Zahnersatz leisten konnte. Mein Lächeln würde auf unbestimmte Zeit entstellt sein.
Dass ich mit meinem verlorenen Freund hier saß und versuchte, alte Missverständnisse aufzuklären, Jahre nach diesem Biss in diese Semmel, hatte irgendwie mit diesem Zahn zu tun. Toni aber blieb vorerst streng, rümpfte die römisch geschnittene Nase, strich sich eine Strähne seines noch immer schulterlangen Haares hinters Ohr und wollte wissen, was ich zu meiner Entlastung vorzubringen hätte. Einen Moment lang befielen mich Zweifel am Sinn unseres Treffens. Sollte man all das nicht besser ruhen lassen? Würden neue Erklärungen nicht neue Verwirrung stiften? Aber dann gab ich mir einen Ruck, rauchte eine Zigarette an und erzählte, wie ich es sah.
Wieder einmal halfen mir meine Eltern mit Geld aus. Meine Mutter wollte nicht, dass ich mit einer Zahnlücke auf die Uni ging. Am Philosophischen Institut sah man zwar gewöhnlich über derlei materialistische Banalitäten hinweg, um den Blick auf größere Zusammenhänge zu richten, aber dennoch: So etwas gehörte sich einfach nicht! Man gab mir das nötige Geld, und ich recherchierte einen Zahnarzt, der nur die Hälfte vom üblichen Preis verlangte. Ein pensionierter, ausgezeichnet Deutsch sprechender Herr, der im Keller seines Hauses in der Nähe von Maribor eine Praxis betrieb. Ich wollte nicht so viel ausgeben und er musste zur Rente dazuverdienen, um über die Runden zu kommen. Telefonisch vereinbarten wir einen ersten Termin.
Drei Tage vor meinem Besuch beim Zahnarzt in Slowenien rief mich Vera an. Ich hatte lange nichts mehr von ihr gehört, wie auch von ihrem Gefährten, meinem alten Freund Toni, der mit ihr von Graz nach Innsbruck gezogen war, weil sie ihr Medizinstudium dort fortsetzen wollte. Von allen Frauen, die ich im Lauf der Jahre an seiner Seite erlebt hatte, war sie zweifellos jene, für die er bereit war, über einige seiner Schatten zu springen. Ich war Zeuge einer Verwandlung geworden, die aus meinem hyperaktiven, dominanten und irrwitzigen Freund einen verliebten, kompromissbereiten und verständnisvollen Liebhaber gemacht hatte. Skeptisch erkannte ich die Macht an, die diese Frau auf Toni ausübte, aber eigentlich wollte ich gar nicht an die neuen Tugenden glauben, die sie an ihm zum Vorschein brachte: Sanftmut, Gelassenheit, Selbstlosigkeit ... Was ich seit jeher an ihm kannte und mochte, war seine ungezügelte, bei der geringsten Gelegenheit ins Groteske umschlagende Phantasie, die ihn zu verwegenen, oft aber auch sinnlosen, um nicht zu sagen gefährlichen Taten trieb. Wie der Protagonist aus einem Roman Célines war er ein von allen möglichen Dämonen Getriebener, der trübsinnig wurde, sobald ein Ende der Bewegung in Sicht war. Er dachte, redete und handelte fast mit Lichtgeschwindigkeit. Auf dieser, seiner Reise ans Ende der Nacht war es irgendwann zu einer Kollision mit Vera gekommen. Die erste Frau, die ihn schließlich einbremste, zivilisierte und einigermaßen salonfähig machte. Ich brauchte eine Weile, um mich mit dem Verlust der anarchischen Schönheit meines Freundes abzufinden. Da mochte durchaus ein Quantum Eifersucht mit im Spiel sein. Es stimmte mich einfach traurig zu sehen, wie eine solche Naturgewalt domestiziert und, wie ich dachte, äußerst fragwürdigen Zwecken angepasst wurde. Nun hatte man auch meinen wilden, freien Freund zu allen anderen in den erbärmlichen Menschenzoo gesteckt!
Es überraschte mich, dass sie anrief und nicht er. Mit ihr war ich gar nie richtig ins Gespräch gekommen. Eine attraktive, kluge Frau, zweifellos, doch irgendwie mochte ich ihren Ehrgeiz nicht, den sie kaum verbergen konnte, etwas Verbissenes in ihrer ganzen Art, das den Dandy in mir beleidigte. Ich hieß sie dennoch willkommen, als sie mich fragte, ob ich ihr am kommenden Wochenende einen Platz zum Übernachten anbieten könne.
„Ich war so lange nicht mehr in Graz!“ Sie schien sich wirklich sehr auf diesen Besuch zu freuen. „Ich komme übrigens allein, ohne Toni“, sagte sie. Es klang fast, als wollte sie damit noch etwas anderes zum Ausdruck bringen. Wir vereinbarten, dass sie zunächst einmal in die WG in der Kalchberggasse kommen würde, um ihr Quartier zu beziehen, dann könnten wir ja gemeinsam etwas unternehmen. Erst nach dem Telefonat fiel mir ein, dass mir der rechte Augenzahn fehlte und ich am Samstag nach Slowenien fahren musste, um diesen Makel zu beheben.
Vor ein paar Monaten war ich aus dem gemeinsamen Haushalt in Liebenau mit meiner langjährigen Freundin Katharina in eine WG im Stadtzentrum übersiedelt. Vier Männer zwischen achtundzwanzig und vierundvierzig Jahren, ich war der jüngste. Zwei Architekten, ein Turnusarzt und ein Student der Philosophie, der nebenbei Taxi fuhr und kleine Erzählungen schrieb, die in Literaturzeitschriften oder im Rundfunk veröffentlicht wurden. Ich war zwar noch mit Kathi liiert, unsere Beziehung war aber in der letzten Zeit auf eine harte Probe gestellt worden. Im Grunde befanden wir uns in einem Dazwischen, ein Ort, von dem aus alle Wege und kein Weg wegführten. In diesem Reich der Möglichkeiten, eigentlich ein Übergangsstadium, hatten wir uns dauerhaft eingerichtet. Sie war nicht gerade begeistert, als ich ihr mitteilte, dass Tonis Freundin zu Besuch kommen und bei mir wohnen würde. Die Wochenenden waren nach wie vor dem Miteinander vorbehalten. Endlich einigten wir uns darauf, am Freitag zu dritt auszugehen, alles Weitere würde sich dann schon ergeben. Die Solidarität der emanzipierten Frau setzte sich schließlich gegen das archaische Misstrauen der eifersüchtigen Furie durch.
Der Freitag verlief einigermaßen nach Plan. Um drei Uhr morgens hatte ich mein Taxi abgestellt, abgerechnet, und war direkt nach Hause gegangen, ohne noch, wie sonst meist, einen Abstecher ins Triangel zu machen, um bei einem Bier darauf zu warten, dass endlich der Nachhall des Funks in meinem Kopf verstummte. Ich schlief mich aus, duschte, trank Kaffee, allein in der großen Küche, und ging auf die Universität. Ich mochte den Fußweg durch die Altstadt, die sich im klaren Licht dieses Junitages sonnte. Zufrieden registrierte ich die Gerüche, die in der Luft lagen, und die Vorfreude der Passanten auf das Wochenende. Ich liebte es, den Stadtpark zu durchqueren.
Ich hörte eine Vorlesung über Heidegger, die mich mit Ambivalenz erfüllte. Diese Terminologie rief in mir Misstrauen, Widerwillen und Widerspruch hervor. Dann ein Seminar über Schopenhauer. Dozent Streminger war ein würdiger Vertreter seines Faches. Er suchte und unterstützte den lebendigen Diskurs, hielt sich aber selbst dezent im Hintergrund. Er dirigierte die Gespräche auf eine sokratische Weise, die unsere Fragen mit der Schönheit dieses Denkens versöhnte. Am Nachmittag überwand ich meine Abscheu und setzte mich ein weiteres Mal in ein Seminar des Dozenten Reibinger: Ein selbst ernannter Kantianer, der auf jede Kritik, die nicht von Kant stammte, äußerst allergisch reagierte. Er hasste jede Auseinandersetzung mit uns Studenten, wollte uns nur eintrichtern, wovon er überzeugt war: Ohne wenn und aber! Solche Jünger hatte Kant sich wirklich nicht verdient. Einen Offizier der Reserve mit einem Hang zum katholischen Fundamentalismus (man munkelte, er habe sich eine Privatkapelle bauen lassen), der rot anlief und Schweißausbrüche bekam, wenn jemand eine Frage stellte, die nicht in sein Konzept passte. Credo quia absurdum sum: Diese Worte Nietzsches schienen mir exakt auf diesen Typus gemünzt. Nach einer halben Stunde musste ich die Vorlesung verlassen, wollte ich nicht noch verbal ausfällig werden.
Vera kam pünktlich. Ich zeigte ihr das Gästezimmer, dann machten wir einen Rundgang durch die riesige Wohnung. An der Seite meines Freundes hatte ich sie nie wirklich wahrgenommen, fiel mir nun auf. Akzeptiert ja, aber nie mit jener Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen, die eine reizvolle Frau provozieren kann. Es irritierte mich, dass ich plötzlich eine ungebundene Frau in ihr sah. Bis jetzt war es mir unmöglich gewesen, sie mir anders als an der Seite Tonis vorzustellen. Falls ich überhaupt je richtig an sie gedacht hatte.
Ich verwies auf meine Zahnlücke, bevor sie ihr auffiel. Sie neigte den Kopf, lächelte hintergründig und meinte, ich sehe derart ein wenig aus wie Huck Finn. Damit konnte ich leben. Sie wollte sich meine Bücher ansehen. „Nur zu“, sagte ich, folgte ihr dann aber wie ein Schatten, als sie die Regale inspizierte, neugierig darauf, was sie interessierte. Sie nahm Bücher in die Hände und blätterte darin: Pessoa, die Mansfield, Nachtgewächs von Djuna Barnes ... Lapidar kommentierte ich ihre Wahl, während ich den Impuls unterdrückte, ihr diesen Roman wegzunehmen und ihn zurückzustellen. Es gab schließlich Bücher, die nicht für jeden oder jede bestimmt waren! Sie bemerkte mein Zögern und gab mir das Buch, das ich vier Mal ganz und immer wieder einmal auszugsweise gelesen hatte. Dabei kamen wir einander so nah, dass ich unvermittelt vor der Frage stand, ihr das Stöbern in meinen Büchern zu untersagen oder – sie zu küssen? Ein spontanes Dilemma, das ich löste, indem ich Kathi erwähnte, die wir bald treffen würden. Wie konnte ich nur so überraschend in das Gravitationsfeld dieser Frau geraten? Ich verbarg meine Verunsicherung hinter einem Hinweis auf ein Buch von Danilo Kiš, den ich vor kurzem entdeckt hatte.
Wir flanierten durch die Gassen der Innenstadt. Im Franziskaner-Viertel überlagerten einander Gerüche aus Cafés, Restaurants und den geöffneten Fenstern der Parterrewohnungen. Ein milder Abend, der eine Ahnung von der Hitze des kommenden Sommers mit sich brachte. Wer einen Platz bekam, saß in einem der Schanigärten im Freien. Vera an meiner Seite machte eine gute Figur. Sie hatte die alternativen Reiseklamotten gegen Bluse und Rock getauscht. Knie, Waden und die Füße, die in Sandalen mit Absätzen steckten, waren von einem goldenen Braun, auf dem blonde Härchen sichtbar wurden, wenn man genau hinsah. Ich riskierte den einen oder anderen Blick, wenn sie einen halben Schritt vor mir war. Als würde ich durch die Augen meines Freundes prüfen, ob alles in Ordnung war. Was aber sollte nicht in Ordnung sein? War es etwa in Ordnung, dass Vera sich manchmal bei mir unterhakte und ich den Druck ihrer Brust an meinem Oberarm spürte? Oder mich für Sekunden anblickte, um zu sehen, was in mir vorging, wenn ich sie in ihrer Attraktivität wahrnahm? So oder so, ich hielt mich bedeckt, so gut ich konnte. Bald würden wir ohnehin Kathi treffen. Wir setzten uns und bestellten Wein. Im Licht der Abendsonne erschien sie mir plötzlich äußerst begehrenswert. Ich fragte mich, was ich bei unseren spärlichen Begegnungen bisher übersehen hatte. War sie, als Freundin des Freundes, tabu für mich gewesen? Und änderte sich dies nun, während sie in Andeutungen davon sprach, dass es mit Toni nicht mehr so gut lief? Sie sagte Sachen wie „Auszeit“ ... „Klarheit gewinnen“ ... „vorübergehende Trennung“ ... „Bedenkzeit“ ... „getrennte Wege“ und dergleichen mehr.
Bevor wir los mussten, bat sie mich ganz nebenbei, meiner Freundin nichts von ihrer Krise zu erzählen. Ich wunderte mich über diesen Wunsch, versprach aber, das Thema nicht zu erwähnen. Und im selben Moment erschrak ich, über meine Freude darüber, dieses kleine Geheimnis mit Vera zu teilen. Es schuf eine Art Komplizenschaft zwischen uns. Trotz dieser winzigen Stiche im Bauch bemerkte ich, wie die untergehende Sonne ihr blondes Haar, das sie aufgesteckt hatte, langsam mit Gold übergoss. Sie erinnerte mich an Ellen Barkin in The Big Easy, in die ich mich einmal verliebt hatte. Im Dunkel eines Kinos für die Dauer eines Spielfilms jedenfalls.
Ein ungewöhnliches Gefühl, an der Seite einer Frau, die einen auf widersprüchliche Weise reizt, der eigenen Freundin gegenüberzutreten. Kathi rauchte bereits etwas ungehalten, als wir endlich ankamen. Im Laufe des Essens gelang es mir, ihr Misstrauen zu beschwichtigen und ihre charmante Intelligenz zum Vorschein zu bringen. Wir aßen gut und unterhielten uns dabei ganz ungezwungen. Fast schien es, die Gegenwart einer anderen Frau bringe uns einander wieder so nahe wie in der Zeit vor unserer Entfremdung: Vera also gewissermaßen als Katalysator unseres verschwundenen Begehrens. Ich ließ das zu, obwohl ich mir keineswegs sicher war, denselben Hoffnungen zu erliegen wie meine Freundin.
Später gingen wir ins Q, eine Disco im Untergrund der Stadt, wo man auffiel, wenn man nicht schwarz gekleidet war. Kathi und Vera konnten ganz gut miteinander, dennoch wurde ich das Gefühl nie los, dass sie einander belauerten. Die Blicke, mit denen Kathi uns auf die Tanzfläche folgte, waren kaum einzuschätzen, obwohl ich ihr Repertoire seit Jahren kannte. Ich verspürte plötzlich den Wunsch, mich diesen Blicken zu entziehen. Wir taumelten mitten hinein in einen Haufen zuckender Körper und verschwanden in der ekstatischen Menge. In Ellipsen trieben wir aufeinander zu, bis sich unsere Körper berührten ... Schultern, Hüften, ihr Hintern im Licht des Stroboskops für zerhackte Augenblicke an meiner Seite. Im Inneren der rhythmisch tobenden Menge, angepeitscht vom treibenden Beat, kam es zu energetischen Reaktionen. Kernfusionen. Für Bruchteile von Sekunden vielleicht nur. Doch lange genug, um etwas in mir zu zünden, das mich verwandelte, und auch sie, vor meinen Augen. Ein Kribbeln blieb in meinem Bauch zurück, als wir uns wieder zu Kathi gesellten. Mir kam vor, sie konnte unmöglich übersehen, dass wir beide in dasselbe Licht getaucht waren. Dieses flackernde Rot, orange und gelb an den Rändern. Jedenfalls behielt sie für sich, was ihr missfiel, falls es ihr überhaupt in dem Ausmaß auffiel, wie ich es empfand. Katharina und ich hatten uns im letzten Jahr offenbar sehr weit voneinander entfernt.
Als ich einschlief, tauchte Vera ein paar Mal auf dem Zelluloid meines Bewusstseins auf, schwarz-weiß und mit Bewegungen wie in einem Stummfilm. Ich musste mich beherrschen, um nicht einfach loszulachen, weil mir diese Szenen ziemlich komisch erschienen. Aber dann versuchte ich, sie da herauszubekommen und mit meiner Zeit zu synchronisieren, um sie weiter in Ruhe betrachten und manchmal auch berühren zu können. Indessen träumte sie im Gästezimmer, wie ich später erfuhr, einen ähnlichen Traum, in dem aber ich mich in Zeitlupe bewegte und sie mich im Zeitraffer immer wieder verfehlte. Als würden wir beide in unterschiedlichen Welten leben, die einer je anderen Physik entsprangen.
Bevor ich in diese Phase verfiel, überlegte ich eine Weile hin und her, wie es wohl wäre, einfach hinüberzugehen und mich zu ihr zu legen. Natürlich war ich mir nicht sicher, ob sie das auch wollte, was wir aber noch gemeinsam erleben sollten, lässt den Rückschluss zu, dass sie jedenfalls kaum etwas dagegen gehabt hätte. Mir war überhaupt nicht mehr klar, welche Verpflichtungen ich in meiner Beziehung zu Kathi noch hatte, die in diesen Monaten eine geschwisterliche Komponente entwickelt hatte. Der Inzest in der Literatur, bei Trakl oder Musil etwa, hatte mich, als schwesternlosen Jüngling, schon immer interessiert, Katharina aber war nicht meine Schwester, sondern wurde lediglich allmählich zu etwas wie meiner Schwester. Dass sie nicht einmal darauf bestanden hatte, bei mir zu übernachten, obwohl die andere da war, gab mir auch zu denken. Entweder schloss sie aus, wir könnten für einander interessant sein, oder sie war sich der weiblichen Solidarität so sicher, dass sie sich nicht weiter darum scherte. Mit einem Zahn zu wenig, aber einem starken Gefühl für die Freundin meines Freundes schlief ich dann irgendwann doch ein.
Beim Frühstück fiel es mir schwer, die Befangenheit abzulegen, die sich einstellte, wenn die Erinnerung an meine nächtlichen Träumereien mit der Aufgeräumtheit kollidierte, die Vera an den Tag legte. Außer uns war niemand in der WG, und so konnte ich mir einbilden, meinen weiblichen Gast bis auf weiteres ganz für mich zu haben. Noch wollte ich mir nicht eingestehen, dass ich mich, seit sie in mein Leben geplatzt war, immer mehr zu ihr hingezogen fühlte. Um auf Nummer sicher zu gehen und ihr keinen Anlass zu geben, sich einzubilden, ihr Auftauchen könnte irgendwelche Folgen für mich haben, begegnete ich ihr mit einer wohldosierten Mischung aus Sarkasmus, Desinteresse...