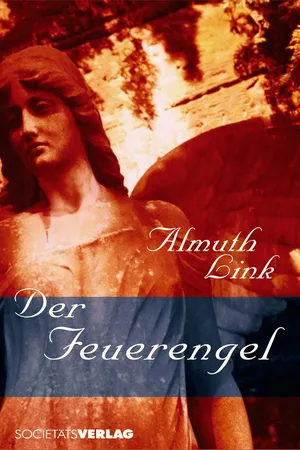
- 175 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Der Feuerengel
Über dieses Buch
Der Main bestimmt Frankas Leben: Sie wurde unter einer Brücke in Frankfurt geboren, verbringt ihre Jugend auf Lastenschiff – und muss erleben, wie ihr Vater, ein Mainkapitän, in den Fluten ertrinkt. Danach ist nicht mehr wie vorher, denn sie hat einen grauenhaften Verdacht: War der Tod ihres Vaters kein Unfall, sondern Mord durch einen Nebenbuhler, den Geliebten ihrer Mutter? Lange kann sie mit niemand darüber sprechen, und als sie sich endlich ihrer Schwester offenbart, kommt es zu einem weiteren fürchterlichen Unfall. Almuth Link erzählt voller Melancholie von einem Leben am Fluss. Ihr Roman ist eine Hommage an den Main und die Menschen, die sich an ihn verlieren.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
Kapitel 1
Unter der Alten Brücke in Frankfurt am Main bin ich zur Welt gekommen, 1938, an einem Juliabend um halb zehn. Eine tüchtige Hebamme sei dabei gewesen, erzählten mir meine Eltern später, und alles sei einigermaßen gut verlaufen. Unser Koppelverband-Schiff, ein Schleppkahn, aus einem Schubleichter und einem Gütermotorschiff bestehend, sei mit leisem Dröhnen mainaufwärts in Richtung Osthafen durch den warmen Abend getuckert. Nur zwei kleine Fackeln, die mein Vater und meine Schwester Corinna draußen auf dem Kajütendach im Kreise herumschwenkten, hätten die Besonderheit der Stunde angezeigt. Der Empfang kurz darauf im Hafen sei fantastisch gewesen, doch hätte ich ihn komplett verschlafen, ebenso wie meine geschundene Mutter. Weil ich also in Frankfurt geboren bin, gaben sie mir den Namen Franka, und ich war mit diesem Namen zufrieden. Schließlich hätte mir eine Schiffsgeburt auch in Hanau oder Würzburg passieren können, dann wären meine Eltern vielleicht auf die Idee gekommen, mich Hanni oder Burgl zu nennen. Nein, Franka gefiel mir besser, und auch meine Eltern, gebürtige Frankfurter, freuten sich über diese günstige Fügung.
Mit Nachnamen hießen wir Müller, Arthur und Annemarie, Corinna und Franka Müller. Unser Vater war Kapitän, angestellt bei einer Schifffahrtsgesellschaft, und wir transportierten in der Regel Sand und Kies aus Stollhofen. Unsere Kajüte auf dem Gütermotorschiff könnte man mit einem soliden unterirdischen Wohnwagen vergleichen, zu dem zwei Treppen hinabführten. Alles ein wenig beengt, aber sorgfältig durchdacht und praktisch eingerichtet. Jeder hatte eine kleine Schlafkoje, meine Eltern, wir beiden Mädchen, und unser Matrose. Es gab eine Küche und natürlich auch ein gemütliches kleines Wohnzimmer mit Essecke. Unter der Toilette hörte man das Wasser des Mains rauschen und gurgeln, was uns Kindern immer einen Schauer über den Rücken laufen ließ - so wie in den Toiletten der Eisenbahnzüge, unter denen man bedrohlich laut die Schienen scheppern hört.
Corinna war drei Jahre älter als ich. Sie soll mit rührender Zärtlichkeit um mich besorgt gewesen sein, mich gestreichelt und mir Lieder vorgesungen haben. Sobald mir der erste Brei verabreicht wurde, habe sie eifrig darüber gewacht, dass ich ja auch genug davon bekäme, um schnell groß werden zu können. Das Schiffskind brauchte eine Spielkameradin, herbeigesehnt wie nichts sonst auf der Welt, denn es gab ja keine Nachbarn oder Kindergartenfreunde.
Spätestens von meinem dritten Geburtstag an habe ich ihr diesen Wunsch erfüllen können. Im Sommer spielten wir auf dem Vordeck, dem Oberdeck, auf dem Dach, auf der Brücke, am Steuerhaus, in all den wunderbaren Nischen und Gängen des Schiffes Versteck, blinder Passagier, Polizist und Einbrecher und zum Leidwesen unseres Vaters auch Nachlauf vom hinteren zum vorderen Schiff, denn es gab einen wackeligen Übergang vom Gütermotorschiff zum Schubleichter.
Im Winter badeten und wickelten wir im Wohn-Esszimmer der Kajüte unsere Puppen oder wir bauten Bauernhöfe auf, deren holzgeschnitzte Bewohner sich überwiegend aus Männern zusammensetzten, Bauern, Holzfällern und Pferdekutschern. Nur zwei Frauen besaßen wir. Die von Corinna hieß, nach dem Geburtsnamen unserer Mutter, Frau Seidenader, die meine hieß Frau Müller. Natürlich waren sie eng miteinander befreundet und besuchten sich häufig in einem unserer kleinen Puppenhäuser zum Kaffeetrinken.
Alles, was um uns herum geschah, nahmen wir nur am Rande zur Kenntnis. Mama hielt sich immer in der Nähe auf, kochte das Mittagessen oder wusch in einer kleinen Blechwanne Wäsche, die sie dann im Freien, hinter dem Steuerhaus, auf die Leine hängte. Ich kann mich nicht erinnern, dass dort, außer an Regentagen, jemals keine bunten Wäschestücke im Wind geflattert hätten. Sie gehörten dazu wie das Dröhnen und Tuckern des Schiffmotors, der Tanggeruch des Wassers, die lauten Zurufe zwischen unserem Vater und seinem Matrosen, das schäumende und spritzende Wasser rechts und links des Schiffes. Was noch dazugehörte: die Vögel mit ihren wilden, bedrohlichen Schreien, das dunkle Tuten des Nebelhorns, die langsam vorüberziehenden Landschaften, Dörfer und Städte, der Gruß, wenn uns ein Schiff begegnete: „Eine Handbreit Wasser unterm Kiel!“, der Stollhofener Hafen schließlich, in dem man den Kies oder den Sand in unser Schiff einlud, und zwei Tage später wieder Anlegen im Südbecken des Frankfurter Osthafens, in dem das Schiff gelöscht wurde.
Während der Aufenthalte in den Häfen liefen wir mit Mama in die jeweilige Stadt, kauften mit Hilfe eines riesigen Einkaufszettels ein, ließen die Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Nudeln, Reis, Mehl und Fett sogar anliefern, weil wir so viel nicht tragen konnten. Wenn wir Glück hatten, gab es an solchen Tagen auch neue Schuhe, ein Kleid, einen Pullover oder eine Trainingshose, zu Corinnas Leidwesen aber auch neue Schulbücher, Schwamm und Griffel für die Schiefertafel.
Freilich wurden solche Ausflüge zunehmend überschattet vom Krieg, in dem sich unser Land seit 1939 befand und der sich gegen Ende immer aggressiver mit seinen Bombengeschwadern über die Städte zog. Wir Kinder mussten jetzt auf dem Schiff bleiben, und die Fahrten nach Stollhofen wurden eingestellt, nicht nur wegen der gefürchteten Tiefflieger, sondern auch wegen einiger zerstörter Brücken. Nichts im Gemeindewesen funktionierte mehr geordnet und reibungslos, auch nicht die Schule mit ihren Sonderregelungen. Niemand wollte unsere Eltern zwingen, wenigstens alle zwei oder drei Tage in irgendeinen Hafen einzulaufen, um Corinna zur Schule zu schicken. Sie blieb zu Hause und lernte mit Mama, glücklich, wenn unser Schiff in einem kleinen Mainhafen außerhalb von Frankfurt angelegt hatte und uns die schweren Angriffe erspart blieben.
Nicht eine einzige Bombe hat unser Kies- und Sandschiff getroffen, nicht ein einziger Schuss. Unversehrt – wenn auch von Angst oftmals gepeinigt – sind wir durch den Krieg getuckert bis zu seinem bitteren Ende. Riesengroß müssen die Flügel des Schutzengels gewesen sein, den uns der liebe Gott vor die Kajüte und Papas Steuerhaus gesetzt hatte, uns zu behüten! Das wurde auch schon mir, der Siebenjährigen klar.
Es war im Sommer 1945, also kurz nach Kriegsende, als mich Mama eines Vormittags in die Frankfurter Innenstadt mitnahm. Ich saß auf dem Gepäckträger ihres rostigen Fahrrades und klammerte mich an ihr fest, denn sie musste slalomartig um die vielen Schlaglöcher herumfahren, die aus den ehemals asphaltierten Straßen lehmige Pfützenwege gemacht hatten. Rechts und links davon türmte sich der Schutt. Dahinter ragten Ruinen hoch oder auch nur vereinzelte Wände mit Fensterhöhlen wie trostlose Augen, abgebrochene Mauern, verbogene Gitter, abgeknickte Türme. Ein gespenstisches Niemandsland, als hätte jemand die Stadt abtransportiert und Unbrauchbares zurückgelassen.
Als wir endlich über all die unkenntlich gewordenen Straßen an der Domruine angekommen waren, die einsam zwischen vereinzelten Häuserresten und breiten Schutthalden emporragte, begann meine Mutter zu weinen. „Unsere schöne, schöne Altstadt“, sagte sie leise, „nichts mehr davon da!“ Wir liefen zum Garküchenplatz, dessen verkohlte Ruinen aussahen wie lieblos zusammengezimmerte, nach drei Seiten hin weitgehend offenstehende Puppenhäuser. Daneben kein Baum, kein Strauch, kein Bürgersteig, kein Asphalt. Nur kleine Hügel von Steinbrocken, vertrockneter Erde, Asche und staubigen Grashalmen.
Heute ist das alles nicht mehr vorstellbar. Damals stand ich entsetzt davor wie vor den Bildern grausamer Märchen, in denen sich unsichtbare böse Geister zusammenrotten, um auf hinterhältige Weise ihr Unwesen zu treiben.
Auch in dieser chaotischen Zeit wurde uns der tägliche Schulbesuch erlassen, mit unseren Eltern aber die Regelung getroffen, dass sie uns alle vier Wochen der Lehrperson einer jeweils zuständigen Volksschule vorzustellen hatten, die uns prüfen und den neuen Stoff mitteilen sollte. Da wir aber wegen der gesprengten und noch nicht wieder reparierten Brücken zunächst gar nicht auf Fahrt gehen konnten, hätten wir nach irgendeiner Schulbaracke in Frankfurt Ausschau halten müssen. „Ach was,“ meinte unsere Mutter, „ich bringe euch alles Nötige bei. Da habt ihr mehr davon als wenn ihr jeden Tag mit euren kaputten Schuhen durch die kaputte Stadt in eine kaputte Schule lauft!“
Natürlich hat ihr Unterricht geklappt.
Bei Arthur und Annemarie Müller klappte aber auch sonst alles. So jedenfalls wollte ich es sehen und habe dabei wahrscheinlich manches übersehen. Sie mussten in der Enge ihres Schiffes aufeinander eingeschworen sein wie ein gutes Team, genau wie wir beiden Schwestern. Wegen des eingeschränkten Platzes hatten wir alles miteinander zu teilen, die wenigen Spielsachen, die Schlafkoje mit dem Doppelstockbett, den kleinen Spieltisch, den Einbauschrank und schließlich unser ungewöhnliches Leben, das wir aber merkwürdigerweise nicht als ein heimatloses Leben empfanden. Unsere Heimat war halt beweglich. Sie bestand aus dem Koppelverband zweier Schiffe, einer Kajüte und einem Steuerhaus auf dem hinteren Schiff, dem Gütermotorschiff, einigen Treppen, Gängen, Ecken und Winkeln, Bullaugen, Oberlichtern, und das wars. Weder interessierten uns Kinder die Namen der Landschaften, Dörfer und Städte, noch die Häfen, in denen wir, zweieinhalb Jahre nach dem Kriegsende, nun wieder anlegten. Nur die Einkäufe mit Mama, wo auch immer, wurden zu interessanten Unternehmungen, ebenso wie die Schulprüfungen, denen wir jedes Mal in einer Mischung aus Angst und Vorfreude entgegenfieberten.
Alles hätte so bleiben dürfen, ein Leben lang. Wir waren unversehrt durch den Krieg getuckert, also standen wir offensichtlich unter einem guten Stern. Nichts konnte uns passieren.
Aber es passierte etwas, ausgerechnet im November, meinem Lieblingsmonat. Aus heiterem Himmel, ohne die leiseste Vorwarnung, brach es über uns herein und fügte dem Urvertrauen, das meinem Leben bis dahin Kraft verliehen hatte, einen tiefen Riss zu. Ich bekam Kinderlähmung. Gegen alles mögliche waren wir als Babys geimpft worden, nicht aber gegen diese tückische Krankheit, von der vermutlich jedermann dachte, sie tauche nur ganz selten auf, und wenn überhaupt, dann träfe sie die anderen.
Sie traf mich. Nicht in der schleichenden Form einer anfänglichen vermeintlichen Grippe, sondern wie ein hinterhältiger Überfall. Abends ging ich gesund ins Bett, wir spielten noch eine Runde „Schwarzer Peter“, Mama kam hinzu, betete mit uns, bevor sie das Licht ausmachte und den Vorhang zuzog, und wir hörten vor dem Einschlafen, wie immer, die leisen Stimmen unserer Eltern.
Als ich am nächsten Morgen aus dem Bett steigen wollte, konnte ich beide Beine nicht bewegen. Ich schrie auf vor Entsetzen, versuchte mich irgendwie an den Bettrand zu schieben, die Beine mit den Händen hochzuheben. Corinna sprang mit einem Satz von ihrem Oberstock herunter, kniete sich vor mich hin, rief abwechselnd nach Mama und Papa, begann vor Verzweiflung zu weinen. Mama war sofort da. Weiß bis in die Lippen schrie sie nach Arthur, stolperte die Treppe hoch zum Deck, schrie ihm entgegen: „Sie hat Kinderlähmung, das kann nur Kinderlähmung sein!“
Alles, was nun weiter mit mir geschah, hat sich in meiner Erinnerung zu einem Gewirr aus Aufregung, Funksprüchen, Zurufen, Ansteuerung eines Hafens, lauten Ratschlägen und tröstenden Worten zusammengeballt. Da ich immer wieder das Wort „Honsellbrücke“ hörte, nahm ich an, was mich ein wenig erleichterte, dass wir uns in der Nähe unseres Frankfurter Osthafens befanden.
Es ging mir schlecht. Ich fühlte mich plötzlich sehr schlapp, konnte kaum sprechen, hatte Kopfschmerzen, überall taten mir die Muskeln weh. Um mich herum Hektik, Aufregung, Unruhe, im Hafen dann ein Rot-Kreuz-Auto, über den Schiffsfunk schon herbeigerufen, in das ich wie auf einem Backblech hineingeschoben wurde, laut, aber flink und routiniert. Sie brachten mich in die Universitätskliniken.
Meine Familie saß um mich herum, sogar der Matrose, denn Mama meinte, alle sollten sich unbedingt, wenn es noch sinnvoll wäre, impfen lassen. In der Klinik dann, nach endlosen Wartereien in Fluren und Labors, bekam ich ein eigenes kleines Zimmer. Wäre mir nicht so elend gewesen, so hätte ich mich an der neuen Umgebung, für ein Schiffskind luxuriös und ganz ungewohnt, sicherlich gefreut. So aber konnte keine Freude aufkommen, denn der Rachenabstrich und die Blutuntersuchung hatten schon bald den gefährlichen Virus bei mir nachgewiesen.
Franka hatte Kinderlähmung.
Kapitel 2
Es wurde ein langer Winter im Krankenhaus. Langweilig wurde er nicht, denn Mama mietete in der Nähe der Kliniken für sich und Corinna eine kleine Mansardenwohnung und schickte ihren armen Arthur und seinen Matrosen allein auf Fahrt. Corinna, inzwischen zwölf Jahre alt, machte die Aufnahmeprüfung in die Quinta eines Mädchengymnasiums in Frankfurt-Sachsenhausen, und bestand sie. Annemarie Müller, geborene Seidenader, war eben eine gute Lehrerin für uns gewesen, die uns nicht nur in Mathematik, sondern auch in den anderen Fächern, vor allem in Deutsch und Englisch, eine Menge beigebracht hatte.
Meine Schwester strahlte vor Glück und Stolz, und jeden Nachmittag ließ sie mich an ihrem Glück teilhaben, indem sie mir von den einzelnen Schulstunden berichtete, jede Lehrerin, jeden Lehrer genau beschrieb, mir ihre Figuren aufmalte, ihre Profile, ihre Haarfrisuren, ihre Kleider. So lernte ich Frau Hof kennen, Frau Dr. Pepp und Herrn Sindel, den Hausmeister Kolb und die Verteilerin der Schulspeisung, Frau Rohr.
Meine Vormittage dagegen waren weitgehend ausgefüllt mit physikalischer Therapie und orthopädischen Maßnahmen, die ich mit zusammengebissenen Zähnen über mich ergehen ließ. Manches tat sehr weh, einiges aber machte mir auch Spaß, vor allem wenn ich gelegentlich einen winzigen Fortschritt spürte. Das geschah zwar äußerst selten und nur am rechten Bein, aber einen kleinen Lichtblick bescherte es mir schon. Wenn Zeit zwischen den Behandlungen übrig blieb, gab mir Mama, angespornt durch Corinnas Erfolge, Unterricht.
Im Handumdrehen war so der November vergangen, und auch der Dezember, in diesem Jahr schneereich und kalt, verging für uns, auch für mich in meinen weißen Wänden, wie im Flug.
Kurz vor den Weihnachtsferien sollte Corinnas Klasse ein Krippenspiel für die Eltern aufführen. Corinna war die Rolle des Verkündigungs-Engels zugesprochen worden. Damit ich teilhaben durfte, brachte sie ihr weißes Engelsgewand mit ins Krankenhaus und zog es sofort an. Es bestand aus einem ziemlich luftundurchlässigen, durch zahlreiche Gummizüge dehnbaren Nylonstoff und hatte, ebenfalls aus Nylon, aber mit Pappe verstärkt, gewaltige Flügel. Schwitzend, doch glücklich, sprach sie ihren Text: „Denn siehe, ich verkündige euch große Freude…“, und ich fand meine Schwester mal wieder hinreißend, schön, lieb, klug, und nun auch noch schauspielerisch großartig.
Mama freute sich mit uns. An dem großen Tag zog sie ihr „gutes Kleid“ an, ein blaues Baumwollkleid mit weißen Blümchen, und sie versprach mir, mit ihrer uralten Kamera Corinna während ihres Auftrittes zu fotografieren. So nur konnte ich den Abschied von den beiden verschmerzen, als der wichtige Nachmittag gekommen war.
Corinnas Berichte hinterher fielen wahrscheinlich länger und wohl auch lebhafter aus als das ganze Krippenspiel. Vor allem freute sie sich darüber, dass sie das Engelsgewand behalten durfte. Die Fotos waren leider nur klein, dunkel und vollkommen unkenntlich geworden.
Unser Vater richtete es ein, am 24. Dezember bei uns zu sein, so dass wir in meinem kleinen Krankenhauszimmer zu viert Weihnachten feiern konnten. Ich bekam eine mühsam ergatterte Babypuppe, die liebe Edeltraut, meine Schwester eine blaue Schultasche aus Stoff, von Mama selbst gebastelt und mit eingenähtem Filz einigermaßen stabil gemacht. Corinna spielte auf ihrer Mundharmonika Weihnachtslieder, wir sangen leise dazu und beobachteten das zarte Flackern der fünf Kerzen, die in einem winzigen Bäumchen steckten. Tränen ließ ich nicht zu, obwohl mir gerade an diesem Abend der Gedanke die Kehle zudrücken wollte, während meines ganzen weiteren Lebens im Rollstuhl sitzen zu müssen oder aber, was ich mir fast noch schlimmer vorstellte, eine hinkende Frau zu werden. Oft sprach ich mit Corinna darüber. Sie nahm mich dann jedes Mal stürmisch in die Arme und tröstete mich. Aber ihre Hilflosigkeit und manchmal auch ihre Tränen konnte sie nicht verbergen.
Da Papa nach den Feiertagen wieder zu seinem Schiff musste, nahmen wir uns für Silvester nichts vor. Wir wollten durchschlafen und erst am Morgen das neue Jahr begrüßen, das Jahr 1948.
Es brachte mir nicht die vollständige Heilung, aber es brachte mir im April, nach fast sechs Monaten, die Entlassung aus dem Krankenhaus mit einem einigermaßen stabilen rechten Bein und einem dünn und etwas kürzer gebliebenen linken, das ich nachzog. Ich hinkte; unschön und plump, in einer Art verschobenem Takt wie eine alte gichtgeplagte Frau. Und mir war klar, soviel hatte ich aus den Gesprächen zwischen den Erwachsenen heraushören können, dass ich kaum eine Chance hatte, jemals wieder richtig laufen zu können. So ergab sich für mich und damit auch für die übrige Familie die Planung der nächsten Jahre ganz von selbst: Um keinen Preis der Welt wollte ich mit diesem Gebrechen in eine öffentliche Schule gehen. Die Mitschülerinnen würden mich nachmachen, mich auslachen, hinter mir herflüstern, die Jungens pfeifen und einen Wettstreit um spöttische Bemerkungen austragen. „Die Kinder gewöhnen sich ganz schnell an deine Lähmung“, gab Mama vorsichtig zu bedenken, „wir könnten in der kleinen Wohnung bleiben, und nur Papa geht auf Fahrt.“ Hätte ich die Wahl nicht gehabt, hätte ich das abgeschirmte Leben zu fünft auf dem Schiff nicht gekannt, so wäre mir ja gar nichts anderes übrig geblieben als nachzugeben. So aber erschien mir in diesen Momenten unser grauer Kieskahn wie eine blühende Oase, eine Insel der Seligen, ein Ort der absoluten Sicherheit, der Geborgenheit, des Friedens. Auch glaubte ich, dass unsere Eltern unter langen Trennungszeiten leiden würden – und das machte ich mir zunutze. Was meine Schwester betraf, so kämpfte ich unentwegt gegen mein schlechtes Gewissen an, das sich heftig zu Wort meldete, wenn ich sie ansah, das Unglück in ihren Augen, weil sie ihre geliebte Schule schon wieder verlassen sollte.
Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn sich Corinna damals in dieser wichtigen Frage durchgesetzt hätte. Wir standen vor einem der berüchtigten Scheidewege, die sich im Leben plötzlich auftun und die, beide in eine unbekannte Zukunft führend, nichts als Angst und eine beklemmende Hilflosigkeit einflößen. In den Kirchen wird Gott gerühmt, weil er uns den freien Willen schenkt. Ich kann mir kein grausameres, zynischeres Geschenk vorstellen als dieses, und ich war immer meilenweit davon entfernt, Gott ausgerechnet hierfür zu rühmen! Ganz zu schweigen davon, dass ich es ihm nicht verzieh und nicht verzeihen wollte, mich zu einem Krüppel gemacht zu haben.
Unser zweites Leben auf dem Schiff, es war auf einmal ein anderes. Die Monate im Krankenhaus hatten mich verändert, mich älter gemacht, ernster, sicherlich auch melancholischer. Anders als früher, schaute ich mir jetzt öfter die vorüberziehenden Landschaften an, die Häuser und Gärten und arbeitenden Menschen, die spielenden Kinder, träumte von meiner Zukunft und blieb jedes Mal an der Vorstellung hängen, Corinna würde irgendwann heiraten, sich damit räumlich von mir trennen, ich würde ihr und ihrem Mann zum Abschied winken und allein auf meinen Kieskahn zurückhinken.
Corinna hielt sich tapfer, mir zuliebe, aber das Getümmel der Schule fehlte ihr sichtlich. Sie schrieb Briefe an ihre Klassenkameradinnen, gab ihr Taschengeld für Briefmarken aus und lief selber, wenn wir in irgendeinem Hafen eingelaufen waren, zum nächsten Briefkasten. Mit Rückantworten konnte sie nicht rechnen...
Inhaltsverzeichnis
- Titelseite
- Impressum
- Zitat
- Vorwort
- Kapitel 1
- Kapitel 2
- Kapitel 3
- Kapitel 4
- Kapitel 5
- Kapitel 6
- Kapitel 7
- Kapitel 8
- Kapitel 9
- Kapitel 10
- Kapitel 11
- Kapitel 12
- Kapitel 13
- Kapitel 14
- Kapitel 15
- Kapitel 16
- Kapitel 17
- Kapitel 18
- Kapitel 19
- Kapitel 20
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Der Feuerengel von Almuth Link im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Literatur Allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.