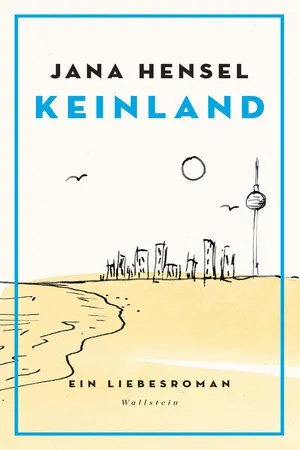![]()
SCHNEE
Justus von Dohnányi hatte mich nach dem Abendessen geküsst, und ich war überrascht, wie sanft er küssen konnte. Wir standen bereits wieder unten auf der Straße, und ich hielt den Lammfellkragen meiner Jacke fest in beiden Händen, als er seine Lippen plötzlich auf meine legte. Der Berliner Novemberwind blies so kalt wie immer. Sanft, leicht, vorsichtig und doch ganz verbindlich, nicht flüchtig und wie im Vorübergehen, sanft eben. Ein bisschen so, wie ich mir vorstellte, dass Frauen einander küssten. Ich musste dabei an Martin denken, manchmal vergaß ich seine Küsse, in diesem Moment aber konnte ich mich ganz genau an sie erinnern, obwohl Martin ganz anders küsste, eher ungestüm, eher unverbindlich, oft zu groß, manchmal sogar ein bisschen pathetisch, und ich fragte mich, ob so ein Kuss mit Justus eigentlich unserer Vereinbarung widersprach. Geh weg und komm her, komm her und geh weg. Am besten beides zugleich, am besten beides im gleichen Augenblick.
Schaffst du das, Nadja?
Ja, Martin, ich will.
Vor dir hat das aber noch niemand geschafft.
Ich werde da sein und ich werde weg sein, wann immer du willst.
Justus von Dohnányi hieß natürlich nicht Justus von Dohnányi, er sah auch nicht aus wie Justus von Dohnányi, aber seine Freunde nannten ihn trotzdem so. Oder Doonie, Graf Don oder nur Vondohnányi. Zusammengeschrieben, das konnte man hören. Ich nannte ihn Justus. Er war klein, kaum größer als ich, und eher kräftig, immer wenn ich ihn sah, trug er karierte Flanellhemden und braune Cordhosen. Auch lief Justus wie ein Bauer durch die Stadt, mit schweren, schnellen Schritten, und wenn ich hinter ihm herlief, dachte ich, Berlin ist sein Acker, sein großes Feld. Justus’ bester Freund war Alkoholiker, arbeitete in einem Hotel als Nachtportier und schrieb natürlich Gedichte. Seine beste Freundin hatte Leukämie im Endstadium, und Justus kümmerte sich um die beiden wie ein Bauer um seine Saat. Regelmäßig und verlässlich und ohne viel darüber nachzudenken, wie mir schien. Irgendwie mochte ich das.
Während des Abendessens hatte Justus von Dohnányi neben mir gesessen und mir von seiner Ehe erzählt. Ich hatte dazu geschwiegen, und ihn hatte das offenbar nicht besonders gestört. So erfuhr ich, dass er zehn Jahre mit einer Frau verheiratet gewesen war, die seinen Namen nicht haben wollte oder der er seinen Namen nicht geben wollte, das habe ich nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich wollte sie ihn nicht haben, weil er ihn ihr nicht geben wollte. Denn mir schien, als hätte er in dieser Ehe viel Zeit damit zugebracht, ihr zu erklären, dass sie nicht gut genug für ihn war, dass sie für ihn besser werden musste. Sie blieb trotzdem bei ihm, wie Frauen das manchmal so machen, so lange, bis für ihn selbst ihr Bleiben keine Hoffnung auf Besserung mehr war. Ich verstand das, ich nickte, als er mir das erzählte, es war mitunter schwer, Menschen, in die man sich jung verliebt hatte, auch dann noch zu lieben, wenn man nicht mehr jung war, sondern erwachsen. Und Justus war erwachsen, ziemlich erwachsen sogar.
Er wirkte auf mich wie ein Mann, der wusste, was er tat, der mit zwei Beinen auf der Erde stand, der auch wusste, dass das Beste, was er besaß, sein Name war. Dieser Name ließ sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen, und einige seiner Vorfahren waren mehr oder weniger berühmte Politiker gewesen, die selbst viele Jahrzehnte nach ihrem Tod noch einen Eintrag bei Wikipedia bekommen hatten. Ich las diese Einträge, als ich nach dem Abendessen wieder zu Hause war, vor dem Einschlafen noch schnell im Bett und konnte mir trotzdem keinen rechten Reim machen, was das alles zu bedeuten hatte, warum Justus mich auf der Straße im kalten Novemberwind plötzlich und, wie mir schien, spontan, aber sanft geküsst hatte. Wie eine Frau, die eine Frau küsste.
Erst seit ich Martin kannte, ging ich zu solchen Abendessen, vorher hatte ich das nicht oft gemacht, sondern meist aus irgendwelchen Gründen, die mir selbst nie fadenscheinig vorgekommen waren, abgesagt. Kollegen aus der Redaktion luden mich ein oder Leute, die ich während einer Recherche kennengelernt hatte. Ich mochte solche Abendessen, bei denen meist ein paar Leute zusammensaßen, die sich nur flüchtig kannten, nicht besonders. Ich mochte sie dann am allerwenigsten, wenn begonnen wurde, sich diese Und-was-machen-Sie-eigentlich-so-Fragen zu stellen und diese Ah-das-ist-aber-interessant-Antworten zu geben. Ich dachte in solchen Momenten wieder an meine Wohnung, wollte im Bett liegen, über alles nachdenken, mir alles vorstellen. Aber wenn ich das tat, wartete ich die ganze Zeit nur auf Martin. Ich schaute immer wieder auf mein Telefon oder las seine Einträge auf Facebook und Twitter.
Ich hatte das mittlerweile an so vielen Abenden und in so vielen Nächten getan, dass ich nun selbst jene Einträge kannte, die er, lange bevor wir uns begegnet waren, geschrieben hatte. Und ich wollte nicht die ganze Zeit auf ihn warten. Auf seine Nachrichten, seine Anrufe, seine Hände, seine Worte, seine Fragen. Seine Wahrheit. Ich vermisste unsere Abendessen in Tel Aviv, vermisste die Schlangen vor den Restaurants am Rothschild Boulevard, ich vermisste Martins Wohnung am Sderot Yerushalayim, vermisste den Blick auf Jaffa und auf das Meer. Ich vermisste das alles so sehr, dass ich Justus dankbar war. Auf eine Art hatte sein Reden mich vor den Fragen der anderen am Tisch bewahrt, auf eine Art hatte er sich während des Abendessens mit seinen Ehegeschichten um mich gekümmert. Vielleicht auch wie um einen Suchtkranken. Auf eine Art also, die man ebenfalls als anständig und aufmerksam bezeichnen konnte. Und pflichtbewusst.
Martin hatte schon wieder seit ein paar Tagen nicht mehr auf meine Nachrichten reagiert, meine Bilder, meine Sehnsucht, meine Liebe. Seit ein paar Tagen schon hatten wir nicht mehr miteinander gesprochen. Seit ich mit Bettie im heiligen Land gewesen war, hatte ich Martin nicht mehr gesehen. Nur manchmal hatte er mich nachts angerufen, wenn er anrief, rief er immer nachts an. Ich stellte mir vor, wie er bei sich zu Hause schon das Licht gelöscht hatte, wie er die Welt an diesem Tag bereits hinter sich gelassen, dass er sie bereits überlebt hatte. Er rief mich mit der letzten Kraft an, die er für einen gewöhnlichen Tag noch übrig hatte. Manchmal rief er aber auch dann an, wenn er eigentlich keine Kraft mehr hatte. Dann hatte seine Stimme schon keinen Klang mehr, dann fielen die Worte so aus ihm heraus. In solchen Momenten sagte er, ich will dich nicht verlieren, Nadja.
Ich habe so große Angst, dich zu verlieren.
…
Vielleicht wäre es besser, du würdest gehen. Du würdest mich verlassen, bevor ich dich verlieren kann.
…
Was meinst du?
Danach legte er auf. Und mir blieb nichts anderes übrig, als weiter zu warten. Zu warten, dass er erneut wie aus dem Nichts auftauchte, zu hoffen, dass er diesmal nicht so schnell wieder verschwinden würde. In sein Nichts. Bettie hatte ein paar Tage nach dem Abendessen zu mir gesagt, im Grunde genommen sei ich doch wehrlos gewesen, ein leichtes Opfer für Justus. Nein, das sagte sie nicht. So etwas würde Bettie nie sagen. Aber in gewisser Weise hat sie es so gemeint. Martin, wo warst du denn schon wieder, dachte ich. Habe ich etwas falsch gemacht, fragte ich mich. Sprich doch mit mir, bitte, redete ich in Gedanken auf ihn ein.
Als ich Justus von Dohnányi wiedersah, hatte er sich gerade ein Profil auf Tinder eingerichtet. Aber die beiden Frauen, mit denen er sich bereits verabredet hatte, er habe sie jeweils einmal und nur zum Abendessen getroffen, wie er mehrmals betonte, schienen ihm auch nicht gut genug zu sein. Er schlief nicht mit ihnen, sondern gab ihnen Tipps, wie sie ihr Leben besser in den Griff bekommen könnten. Einer der beiden riet er sogar, zukünftig keine Männer mehr über Tinder zu treffen, sich auf all das um Gottes willen nicht mehr einzulassen. In diesem Moment musste ich lachen, aber Justus schaute mich nur ein wenig verwirrt an und zündete sich eine Zigarette an.
Justus rauchte viel, Justus rauchte immer, ich mochte auch das. Justus rauchte nicht ironisch. Eher gab das Rauchen ihm eine Unruhe, es sah so aus, als seien seine Gedanken ständig unterwegs und als versuchte er, indem er den Rauch inhalierte, sie in seinen Körper zurückzuholen. Als ich mit ihm schlief, fühlte sich auch das ganz leicht an. Wie seine Küsse. Manchmal war das so, manchmal schlief man mit kräftigen Männern, weil man sich selbst dabei leichter fühlte. Ich dachte am nächsten Tag, oder nein, ich hoffte am nächsten Tag, diese Leichtigkeit würde mir helfen, sie könnte eine Entschuldigung sein. Diese Leichtigkeit würde bei allem nicht weiter ins Gewicht fallen, sagte ich mir und musste wieder lachen, weil das natürlich ein blödsinniger Satz war.
Hinterher, als ich, die Arme unter dem Kopf gekreuzt, in seinem Bett lag und Justus am Fenster stand, um eine Zigarette zu rauchen, obwohl es eigentlich viel zu kalt war, so am offenen Fenster zu stehen und zu rauchen, hinterher fiel mir wieder ein, wie Martin mir einmal von dieser Frau erzählt hatte, dieser zerbrechlichen, kindhaften Frau, bei der er bleiben wollte, die er liebte und die doch irgendwann begonnen hatte, mit einem anderen Mann zu schlafen. Ich bin zu schwach, Nadja, hatte Martin damals gesagt. Und ich war schweigend die Toleranzstraße in Richtung Hackescher Markt zur S-Bahn gelaufen. Justus zündete sich noch eine Zigarette an, und ich stand auf, lief ins Bad, um Martin eine SMS zu schreiben.
Ich bin nicht wie die anderen Frauen, Martin.
Ich bin nicht die anderen Frauen.
Ich warte nur auf dich.
Ich weiß, Nadja, schrieb er sofort zurück.
Ich melde mich morgen, ich rufe dich morgen ganz bestimmt an.
Und ich wusste, dass ich mit dieser Nachricht nun wieder ein paar Tage auskommen musste, schon auskommen würde. Ich legte mich zurück ins Bett und sagte zu Justus, dass er mir bitte keine Tipps fürs Leben geben sollte, woraufhin Justus mich noch einmal küsste, länger als zuvor, noch sanfter als zuvor.
Ich fragte ihn, ob er mit mir nach Polen fahren würde, obwohl ich mir sicher war, dass einer wie Justus noch nie dort gewesen war, wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht hatte, je einmal in seinem Leben nach Polen zu fahren. Das Land lag für Justus sicherlich auf einem anderen Planeten, dessen Entfernung zwar bereits errechnet worden, dessen tatsächliche Existenz schon bewiesen worden war, zu dem aber noch nie jemand wirklich gelangt war. Das Gut von Justus’ Eltern befand sich irgendwo in Süddeutschland, einer Gegend wiederum, in der ich noch nie gewesen bin. Ich musste den Namen des Ortes auf Google Maps eingeben, um zu sehen, wo genau er lag, wo Justus alles über Äcker erfahren hatte.
In Polen dagegen bin ich schon fast überall gewesen, aber das war nun lange her, schien fast keine Rolle mehr zu spielen. Es war ein anderes Polen gewesen, ein anderes als jenes, in das ich jetzt fahren wollte. Das Ferienlager in Nowa Huta zum Beispiel. Nowa Huta ist ein Neubaugebiet am Rand von Krakau, wir wohnten dort in einer nicht besonders schönen Schule und schliefen auf Feldbetten, die man in leeren Klassenzimmern für uns aufgestellt hatte. In einem die Mädchen, in einem anderen die Jungen und für die Erzieher hatte man dieselben Feldbetten im Lehrerzimmer aufgestellt. Oft taten wir nichts anderes, als in die Innenstadt, genauer gesagt, zu den Tuchhallen zu fahren. Wir schlugen die Zeit tot, drehten jeden Złoty dreimal um und überlegten uns hundert Mal, welche Aufkleber und Gürteltaschen mit adidas-Aufklebern und Stickern, die wir Ansticker nannten, wir kaufen sollten. Wir küssten uns abends auf dem Schulhof mit den polnischen Pfadfindern, die im Stockwerk unter uns schliefen, und wenn einer der Erzieher das mitbekam, mussten wir im Lehrerzimmer berichten, warum wir das getan hatten. Am Ende des Ferienlagers kontrollierten die Erzieher unsere Taschen, nahmen uns die Gürteltaschen und Ansticker wieder weg und schmissen sie vor unseren Augen in den Mülleimer. Jene Sachen, die sie nicht fanden, weil wir sie doch zu gut versteckt hatten, holten später im Zug die Grenzer aus unserem Taschen und Koffern heraus, sodass wir ohne Erinnerungen nach Hause fuhren, ohne Erinnerungen nach Hause fahren sollten, ganz so, als wären wir nie dort gewesen. In Polen.
Ein andermal, sechs, sieben Jahre später war das, waren Robert und ich in Auschwitz. Obwohl, nein, das stimmt nicht, ich bin schon zweimal mit Robert in Polen gewesen. Robert erinnerte mich wieder daran, ich hatte es längst vergessen, aber Robert erinnerte sich, wenn es darauf ankam, an alles. Das erste Mal an der Ostsee, das zweite Mal in Auschwitz. In Auschwitz war Roberts damalige Freundin dabei gewesen, und hinterher, kaum hatten wir das Lager verlassen, ist es zwischen uns zum Streit gekommen, aber zwischen den meisten von Roberts Freundinnen und mir war es irgendwann zum Streit gekommen. Robert glaubt, das hätte nicht an der Nähe gelegen, die es zwischen uns gab, sondern an der Intensität dieser Nähe. Damit sei keine seiner Freundinnen zurechtgekommen.
In dem Streit, will Robert sich auch erinnern, hatte sie uns vorgeworfen, wir seien zu schnell und zu unkonzentriert durch das Lager und die Baracken gelaufen, seien dem Ort nicht angemessen begegnet, aber ich kann mich an nichts Genaues mehr erinnern. Überhaupt sehe ich diese Jahre, nachdem das falsche Land aufgehört hatte zu existieren, heute nur noch sehr verschwommen. Diese Jahre kommen mir im Nachhinein wie taub vor, müde, eine Zeit, die auf nichts hinauslief oder von der ich nicht wusste, worauf sie hinauslief, eigentlich hinauslaufen sollte. Vielleicht hatte Roberts Freundin ja recht, denke ich heute, vielleicht liefen wir damals wirklich zu schnell und zu unkonzentriert herum. Nicht nur durch Auschwitz, sondern eigentlich durch alles, immer. Am Tag nach dem Streit habe sie ihre Sachen gepackt und sei zurück nach Berlin gefahren, sage ich. Robert meint, ich sei diejenige gewesen, die danach ihre Sachen gepackt habe und nach Hause gefahren sei. Das kommt mir zwar ein bisschen dramatisch vor, aber auch das kann sein, ich weiß es nicht mehr.
Ich fragte Justus, ob er mit mir nach Polen fahren würde, weil ich dich nicht fragen konnte, weil ich dich auch dann nicht hätte fragen können, wenn du mit mir geredet hättest, Martin. Ich wäre mit dir ja auch nicht auf einem Friedhof spazieren gegangen. In Polen waren deine Leute als Aschehaufen in den Wolken aufgegangen, nach Polen fuhr dieser Zug, dorthin waren einst fast alle Züge gefahren. Ich musste allein nach Polen fahren. Und Justus war ein Mann, der von alldem nichts ahnte und von dem ich wusste, dass er keine Fragen stellte. Von dem ich wollte, dass er mir Fragen stellte. Verstehst du das, Martin? Weißt du, was ich meine?
Meine Großmutter stammte auch aus Polen, sie kam aus Schievelbein, einer kleinen Stadt in der Nähe von Stettin. Ich hatte mich dafür nie besonders interessiert. Schievelbein war so klein, kleiner als die Straße, die man in Berlin nach dem Ort benannt hatte, aber bis vor einigen Wochen, als meine Mutter plötzlich von einem Stapel alter Briefe meiner Großmutter erzählte, hatte ich selbst das nicht gewusst. Oder anders gesagt, war mir selbst das nicht klar gewesen, obwohl ich oft durch diese Straße gegangen bin, sie lag nicht weit von meiner Wohnung. Eigentlich lag sie ganz in der Nähe. Ich dachte nie an meine Großmutter, meine Großmutter war aus meinem Leben verschwunden, als mein Vater verschwand. Er ging wenige Monate, nachdem das falsche Land aufgehört hatte zu existieren, von uns weg, aber auch dafür hatte ich mich damals nicht besonders interessiert. Es hatte wichtigere Dinge gegeben als so einen Vater, der verschwand. Fast schien es mir logisch, dass er ging. Alles verschwand, alles löste sich auf, alles ging auf eine Art verloren, alles war Teil einer großen Mechanik, einer riesigen Drehbewegung, die sich wie über Nacht in Gang gesetzt hatte. Ein Vater, eine Mutter, eine Tochter, eine Familie, das war nicht mehr wichtig. So wie Roberts Vater verschwand, verschwand auch meiner. Der einzige Unterschied war, dass mein Vater sich dafür nicht mit einem Seil an den Heizungsrohren in der Garage aufhängen musste.
Von wem hast du deine Augen, Nadja?
Von wem stammt die Farbe deiner Haare, hatte mich Martin im Frühsommer einmal gefragt.
Ich weiß es nicht. Nimm sie dir, sie gehören dir, Martin, hatte ich damals lachend und fast ein wenig übermütig geantwortet.
Ich schenke dir meine Augen, meine Haare gehören dir, wenn du willst. Ich schenke dir alles, ich weiß ohnehin nicht viel damit anzufangen, schrieb ich und hatte dabei nach langer Zeit mal wieder an meinen Vater gedacht. Wo war er? Hatte man mir als Kind nicht immer gesagt, ich sähe aus wie mein Vater? Was machte er? Hatte es früher nicht immer geheißen, ich hätte die Haare meiner Großmutter? Ihre dunklen Haare. Die Locken, auf die sie einmal sehr stolz gewesen war. Wie es meinem Vater wohl ging? Ein paar Jahre nachdem das falsche Land aufgehört hatte zu existieren, war meine Großmutter gestorben, und ich war auf ihrer Beerdigung gewesen, obwohl ich sie davor schon lange Zeit nicht mehr gesehen hatte. Die einzige Erinnerung an sie war, dass sie immer zu viel Butter in die Erbsen gab, aber selbst das war etwas, was meine Mutter mir erzählt hatte, an das sie sich erinnerte und nicht ich. Hatte meine Großmutter je von Polen erzählt? Hatte sie mir je von Polen erzählt? Hatte ich vergessen, was sie mir damals von Polen erzählt hatte?
An jenem Novembermorgen, an dem Justus und ich losfuhren, waren es in Tel Aviv 18 Grad, und blauer Himmel. So stand es auf meinem Telefon. An jenem Morgen waren es in Berlin 5 Grad und es gab natürlich keinen blauen Himmel. Für die nächsten Tage war sogar leichter Schneefall vorhergesagt, es wäre der erste Schnee dieses Winters. Ich stellte mir vor, wie Polen unter einer dünnen Schneedecke aussehen würde, weil Schnee, der auf Feldern lag, doch ein Bild war, das sich durch die Jahrhunderte nicht veränderte, das immer gleich blieb und immer gleich bleiben würde. Millionen vor uns hatten Schnee auf Feldern gesehen, Millionen nach uns würden Schnee auf Feldern sehen.
Ich saß in meiner Küche, trank Kaffee und wartete auf Justus. Ich dachte an Martin, an sein auf eisige Temperaturen heruntergekühltes Büro, vielleicht waren es auch dort jetzt nicht mehr als 5 Grad. Meine Sachen hatte ich in eine kleine Tasche gepackt und die Briefe meiner Großmutter, lose Blätter, alte Zeitungsausschnitte, Fotos und Postkarten in einer durchsichtigen Folie, obendrauf gelegt. Ich fragte mich, was du wohl über Justus denken würdest, Martin. Ob dich seine Flanellhemden und Cordhosen auch an jene Berge erinnerten, in die du nicht fahren konntest, ...