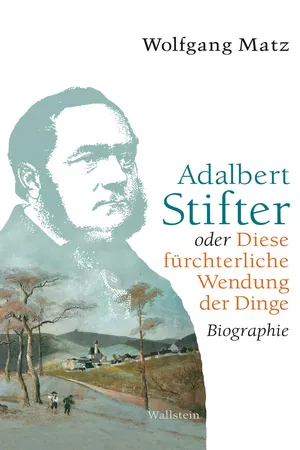![]()
ZWEITER TEIL
Prekäres Gleichgewicht
1837 – 1848
ERSTES KAPITEL
Der Dichter greift zur Feder
Die zwei Jahre zwischen dem endgültigen Bruch mit Fanny und der Heirat mit Amalia, ebenso die folgende Zeit – Stifters Leben verstrich weiter wie zuvor mit der Plackerei als Hauslehrer, mit »schoppizistischen« Freundschaften und seelischem Elend. Weitere Bewerbungen waren gescheitert, 1835 in Prag, 1836 um eine Assistentenstelle in Wien. Den Freunden, den Bekannten, der Familie und nicht zuletzt sich selbst gegenüber war Stifter einer, der auf ganzer Linie versagt hatte: Beruflich gescheitert, hielt er sich mit notdürftigem Broterwerb über Wasser; gescheitert nicht weniger im Persönlichen, wo er aus eigener Schuld seine Liebe verspielt hatte und an einer Frau hängengeblieben war, die vor allem anderen nach einer »Versorgung« suchte. Es gab nichts, woran das ohnehin nicht allzu stabile Selbstgefühl Stifters einen Halt finden konnte. Er war ein Versager, und er wusste es.
In dieser Lage wurde die Suche nach einem Ausweg zu mehr als einer bloß beruflichen Frage, sie war längst eine Angelegenheit des psychischen und damit ebenso des physischen Überlebens. Und auch Fanny hatte ihn noch nicht losgelassen; wollte er sich irgendwann auch seelisch von ihr lösen, so musste er versuchen zu verstehen, was da mit ihm geschehen war. Acht Jahre lang war sie der Mittelpunkt seines Denkens und Fühlens gewesen; acht Jahre sind eine Zeit, die man nicht so ohne weiteres vergisst, wenn sie vorüber ist. Sie war vorüber; doch mit seinem Herzen hatte er sich noch nicht in die Wirklichkeit gefunden und grübelte unaufhörlich realen und eingebildeten Erklärungen für die Katastrophe hinterher. Er musste da hinaus, sollte es noch einmal einen neuen Anfang geben. Mit aller Gewalt drängte sich die Kunst auf, als der einzige Ausweg. Der Satz aus dem November 1833, »mir tut es not zu produzieren«, ist nun so wörtlich zu verstehen wie nur möglich: Fürwahr, es tat dem inzwischen über Dreißigjährigen not, irgendeinen Inhalt für sein immer schneller dahinfließendes Dasein zu finden. Die Literatur war nicht länger mehr dichterische Verkleidung seines narzisstischen Selbstmitleids, jetzt schrieb Stifter wahrhaftig um sein Leben.
Schon mit den Jahren 1836 und 1837 begannen sich in Briefen die Erwähnungen literarischer Pläne zu mehren. Die Lyrik hatte er dabei allerdings ganz und gar aufgegeben. War ihm die mangelnde Qualität seiner Verse zu Bewusstsein gekommen? Es wird mehr gewesen sein als das; zudem ließ sein erster Novellen-Versuch durchaus kein größeres Können erraten. Stifters Gedichte waren nie über das Epigonale hinausgelangt; es waren literarische Montagen, die sich herkömmlicher Formen für gestanzte Gefühlsmuster bedienten. Seine sprachliche Begabung lag nicht in der verdichtenden, auf das Wesentliche reduzierenden Form der Lyrik; er brauchte zum Ausdruck die offene Breite, den ungehemmten Strom der Epik. Dem widerspricht das Poetische in seinen späteren Erzählungen keineswegs: Sein so ganz eigener lyrischer Ton war allein in der Form der Prosa zu verwirklichen.
Am 4. Februar 1836 schrieb er an Adolf von Brenner, der als Attaché an der Botschaft in Rom seine erfolgreiche Karriere fortsetzte: »Ich wollte sogleich den ganzen Roman mitschicken, aber wird er denn fertig?«, um gleich darauf anzufügen: »Zweifünftel Trauerspiel und ein halber Roman ist fertig, und werden nächstens nach den sieben Hügeln wandern, und Dich schüchtern grüßen.« Das »Trauerspiel« hat sich verloren; der »Roman« aber war das, was unter dem Titel Feldblumen dann eine der ersten Erzählungen werden sollte. Auch von den Umständen, unter denen Stifter sich an die Arbeit machte, verrät der Brief einiges: »Wie ich mich sonst befinde? Ei, seit ich in Wien bin, nie so miserabel. […] Ich bin auch wirklich in eine Lage geraten, daß ich manchen Tag nicht weiß, wovon ich morgen leben werde«. Und am Ende stand der sehnsüchtige Blick auf alles, worum er den erfolgreichen Freund nur beneiden konnte, und die Bitte, ihn wenigstens im Brief daran teilnehmen zu lassen: »Peterskirche, Frauen, Capitol, Amphitheater etc. … Karneval etc. … etc. … Römer, Römerinnen etc. …« Das war es, was ihn verlockte: die große Welt, und natürlich immer wieder die Frauen.
Der tägliche Kampf mit Papier und Feder blieb hart genug. Stifter ist nicht von heute auf morgen zum Dichter geworden, und auch als sich der Druck zur Produktivität von Tag zu Tag verstärkte, lähmte ihn doch immer wieder die alte Unschlüssigkeit und der Hang zum Schleifenlassen der Dinge. Beständig erschallte die Klage über angefangene und liegengebliebene Briefe, und auch die Literatur kam noch nicht hinaus über Fragmente. Diese innere Blockade ließ ihn sogar günstige Gelegenheiten versäumen. So hatte im Frühjahr 1836 auf der großen Wiener Kunstausstellung der Streit um die neue katholische Kunstrichtung der Nazarener die Gemüter erhitzt. Die Allgemeine Zeitung publizierte eine Artikelserie, die voll des Lobes war; Stifter, der den religiösen, altertümelnden neuen Stil scharf ablehnte, plante eine vernichtende Entgegnung. Die Dinge ließen sich bestens an: Der Maler und Akademielehrer Johann Fischbach, den Stifter durch seine eigenen Kunstinteressen kennengelernt hatte, versprach ihm Förderung und Vermittlung für die Publikation. Aber wieder verlief alles im Sande, und Stifters Rechtfertigungen für dies weitere Scheitern klingen mehr als dubios: Er hatte den »mystischen Aufsatz« nicht einmal gelesen, und trotz aller Mühe wollte es ihm nicht gelingen, der Sache habhaft zu werden. Veröffentlicht in einem Blatt, das bei jedem Zeitungshändler auf Käufer wartete …
Aber allen Lähmungen zum Trotz – diesmal hielt Stifter fest an seinem Plan. Diesmal musste er schreiben. Mühsam, aber mit zäher Geduld entstanden Briefe an die Freunde und neue Bruchstücke zu seinem »Roman«. Und oft genug war das eine kaum vom anderen zu unterscheiden, denn die Feldblumen ihrerseits wurden eine Brieferzählung, bestehend aus den Herzensergießungen eines jungen und unbekannten Wiener Malers namens Albrecht. So manche Formulierung ging von Albrechts in Adalberts Briefe über, und so manche nahm den umgekehrten Weg. Diesmal begann Stifter zu kämpfen; allen Widrigkeiten jener Jahre zum Trotz – der Geldmangel und die elementare Sorge um das tägliche Brot verstärkten noch die psychische Qual – oder gerade ihretwegen schrieb er weiter. Auch wenn er immer wieder abbrechen musste, da er mit Stoffen und Formen nicht zurande kam, ganz gab er seine Bemühungen um eine eigene Sprache nun nicht mehr auf. »O teurer, lieber Sigmund, ich fühle oft eine Einsamkeit, daß ich weinen möchte wie ein Kind«, ein solcher Satz verrät, wie es ihm wirklich erging zwischen all seinen gescheiterten Plänen.
Der Condor – Feldblumen – Das Haidedorf
In den fünf Jahren zwischen 1835 und 1840, dem Augenblick der ersten Veröffentlichung, waren es insgesamt drei Erzählungen, an denen sich Stifter versuchte, und auch inhaltlich bilden sie eine recht einheitliche Gruppe. Selbst wenn sie in vielem noch Züge des Unreifen tragen, unterscheiden sie sich doch in einem deutlich von ihrem Vorgänger Julius: Sie sind Literatur und nicht mehr nur persönliches Dokument. Wie viel von Stifters eigenem Leben und seiner Problematik in die Erzählungen eingegangen ist, fällt sofort ins Auge; trotzdem ist es dem Autor gelungen, ein Netz zwischen Wahrheit und Dichtung zu spannen, das eines vom anderen trennt. Das Ich der Erzählung ist nicht mehr umstandslos das Ich ihres Autors; die Begebenheiten, auch wo sie der Wirklichkeit entstammen, nicht mehr deren bloßes Abbild. Immer noch sprach Stifter von sich selbst, nun aber war das Bild verwandelt, gebrochen durch die wiederholten Spiegelungen der Sprache. Alle drei Erzählungen tragen deutlich die Spuren des Kampfes, mit denen Stifter sich aus dem Nur-Persönlichen zu befreien versuchte, und die lange erfolglos bleibenden Mühen um den »Roman« Feldblumen hatten ihren Grund gewiss vor allem in der Schwierigkeit, gerade die gefährdete Form der Brieferzählung nicht zu einer bloßen Sammlung eigener Briefe werden und damit scheitern zu lassen.
Eine genaue Chronologie lässt sich kaum ausmachen, aber wahrscheinlich entsprach die Entstehung nicht ganz der späteren Reihenfolge bei der Veröffentlichung. Den Anfang machten wohl Condor und Haidedorf, denen dann die Feldblumen-Fragmente folgten. Fertiggestellt wurden die beiden letzten jedoch sicher erst, nachdem der überraschende Erfolg des Erstlings eine Veröffentlichung möglich gemacht hatte. Was die drei Texte zu einer Gruppe zusammenschließt, zeigt sich am deutlichsten im Haidedorf: der Versuch, die eigenen Lebensprobleme zu verarbeiten, zugleich aber den Abstand durch die Literatur zu schaffen. Doch trägt diese Erzählung noch am stärksten die Spur des Julius, mit dem sie den Charakter der literarischen Wunscherfüllung teilt.
Erzählt wird die Geschichte eines Kindes. Felix wächst auf in der Haide, zwischen Pflanzen und Tieren, zwischen den einfachen Menschen des Landes und ihren ewig sich gleichenden Lebensumständen – in der äußeren Wirklichkeit zeichnet Stifter hier ein genaues Bild seiner eigenen Kindheit, bis hin zum liebevollen Porträt der uralten, in wirren Reden sich verlierenden Großmutter Ursula. Eines Tages bricht Felix auf, um in der Welt Wissen, Erfolg und sein Glück zu suchen; und ebenso steht er nach Jahren eines Tages wiederum vor dem ärmlichen Haidehaus: »das Mutterherz aber […] hing die ganze Zeit über an seinem Angesichte, und glänzte, und schäumte fast über vor Freude und Stolz.« Die Erfahrung der Welt hat ihren Sohn zum Dichter gemacht – und zum Fremdling in der eigenen Heimat. Die einfachen Menschen verstehen ihn nicht mehr, diesen sonderbaren, so ganz anders gewordenen Rückkehrer, und auch wenn sie ihn nicht förmlich verstoßen, er bleibt ihnen unheimlich und fremd. Bis zu dem Tage, da der König selbst ins Haidedorf einzieht und aller Welt beweist, dass der verlorene Sohn nicht etwa als gescheiterter Träumer zurückgekehrt war, sondern als der nunmehr ruhmreich gekrönte Dichterfürst – denn »er ist auch ein König und Held – ein König der Herzen, der regieren wird, solang eines schlägt«. Felix aber, den seine Landsleute und selbst sein Vater für »krank oder geistesirre – oder – oder – «, den sie für weit Schlimmeres als einen Gescheiterten gehalten hatten, vergilt ihnen die Verachtung nicht mit gleicher Münze: Er schlägt die königlichen Edelsteine aus und bittet stattdessen um gnädige Hilfe für das von einer Missernte heimgesuchte Dorf.
Ganz durchsichtig ist in allen Elementen der autobiographische Gehalt. Stifter, der in Oberplan längst nur noch als Versager galt, fabulierte sich hier den Erfolg und die Anerkennung zurecht, welche ihm die rauhe Wirklichkeit so hartnäckig versagte; aus dem verachteten Niemand machte er den Retter der Heimat. Der vollkommen haltlose, realitätsferne Charakter solcher Phantasien lag jedoch derart offen zutage, dass Stifter die Erzählung schon 1844 für die dann fällige Neuausgabe vollkommen umschreiben und dabei den königlichen Deus ex machina ersatzlos in die Requisitenkammer verbannen musste; nachdem er inzwischen selbst den erstrebten Erfolg als Schriftsteller errungen hatte, dürfte es Stifter bewusst geworden sein, dass die plakative literarische Wunscherfüllung des Erstdrucks kein überzeugender Abschluss gewesen – und durch die Wirklichkeit auch überflüssig geworden war.
Bis zu diesem Punkt unterscheidet sich das Haidedorf noch durch nichts von den Julius-Phantasmen. Eines aber hebt die Erzählung trotzdem vollkommen über alles Vorhergehende hinaus: die Sprache. In allen drei Früherzählungen bleibt zunächst noch der vorherrschende Einfluss des großen Vorbilds Jean Paul spürbar, den Stifter »während eines ganzen Sommers, gleichsam auf einem Divan wohnend, verschlang«; dort fand er die wilde, romantische Phantasie und die sprunghaften Fügungen des Ausdrucks, die recht gut der herrschenden Mode entsprachen. Aber zwischen epigonalen Bildern und aufgesetzten »Schoppizismen« stehen jetzt immer häufiger Passagen, die sich von allen vorgefertigten Mustern lösen. Und schon beginnt sich eine Eigentümlichkeit des Dichters Stifter abzuzeichnen: Wo es um Menschen und ihre Verhältnisse geht, um Psychologie und äußere Beschreibung von Gestalten, da herrschen noch fast unumschränkt das geborgte Klischee und eine nichtssagende Gefühligkeit, denen man weniger wirkliches Gefühl anmerkt als vielmehr ihre literarische Herkunft. Wo jedoch Landschaft und Natur in den Blick des Dichters kommen, wo er in breiter Einleitung und ohne unmittelbare Handlung etwa die Welt des Kindes auf der Haide vor seinem inneren Auge entwirft, da beginnt die Sprache zu sich selbst zu finden. Der Mondaufgang in den Feldblumen, erst recht der Blick auf die erwachende Metropole – hier erwacht das Ureigenste von Stifters Schreiben selbst: »Oder ich lese eine Nacht aus, in der ich auf einen der Westberge Wiens steige, um den Tagesanbruch über der großen Stadt zu sehen, wie erst sachte ein schwacher Lichtstreif im Osten aufblüht, längs der Donau weiße Nebelbänke schimmern, dann die Stadt sich massenweise aus dem Nachtdufte hebt, theilweise anbrennt, theilweise in einem trüben Goldrauche kämpft und wallt, theilweise in die grauesten Ferntöne schreitet, der ganze Feenteppich durchsäet mit goldnen Sternen, blitzend von Fenstern, Metalldächern, Thurmspitzen, Wetterstangen und endlich gesäumt von dem blaßgrünen Band des Horizonts, der schwach wie ein Hauch draußen durch den Himmel ziehet.«
Da war mit einem Male eine Sprache, wie man sie noch nicht gehört hatte. Schilderungen, in denen die Landschaft nicht vermenschlicht wird, dennoch voll ist von ausdrucksstarkem Gefühl. Der Blick auf das Häusermeer Wiens, der die Großstadt erfasst, als wäre sie Natur, und der sie zugleich zeigt in ihrer eigenen, so ganz fremden und neuen Schönheit – das ist große Prosa von großer und gewagter Eigentümlichkeit. Hier war dem Dichter tatsächlich etwas gelungen, hier zeigte sich der Weg, auf dem er eines Tages zum Eigenen gelangen mochte.
Mit den Feldblumen hatte Stifter indessen noch einen weiteren Sprung gemacht. Immer noch drängte es ihn zur Verarbeitung seiner Jahre mit Fanny, und immer noch war er dem keinen Schritt näher gekommen. Im Haidedorf hatte er wenigstens das Problem seines beruflichen Scheiterns gelöst – wenn auch allein durch die Attrappe eines opernhaften, vollkommen bodenlosen Rettungsschlusses. Jetzt musste er sich noch an das Liebeserlebnis wagen. Die lange Entstehungszeit verrät, wie schwer ihm die Sache wurde, das Ergebnis aber war nicht ohne Erfolg. Stifter hatte ein Mittel gefunden: Er hatte seinen Stoff literarisiert und ihn erst damit wirklich zum Stoff gemacht; es war ihm gelungen, die lange Brieferzählung aus dem Kreis des nur Autobiographischen zu lösen. Albrecht, der Held der Feldblumen, ist Stifter, und zugleich ist er es nicht. Er ist es, insofern er Gefühle und viele Züge des äußeren Lebens mit seinem Erfinder teilt; er ist es nicht, weil die Einzelheiten seines Daseins erfunden sind und der Verlauf seiner Liebesgeschichte nur ihm gehört. Stifter gab nicht mehr einfach nur eine Beschreibung seiner eigenen Erlebnisse; er hatte sie verwandelt und in dieser stilisierten, verfremdeten Form einer literarischen Kunstfigur anvertraut.
Die Geschichte der Feldblumen ist einfach. Albrecht, der junge, mittellose Maler, berichtet einem in den Pyrenäen weilenden Freund von seinen Erlebnissen in Wien. In der Begegnung mit Angela, einem wahren Wunder an Bildung und Schönheit, findet und gewinnt er das Glück seines Lebens – doch nur, um es aus eigener Schuld sofort wieder zu verspielen. Als er Angela im Park von Schönbrunn in vertrauter Nähe zu einem anderen Mann erblickt, zweifelt er aus Eifersucht und gekränktem Stolz an ihrem Versprechen und verlässt die Stadt. Die Entzweiung aber hält nicht lange vor, und durch den beherzten Eingriff ihres Stiefbruders – denn niemand anders als er war der junge Mann gewesen – kommt es alsbald zu Versöhnung und glücklicher Heirat.
Zufälle, Wiedererkennungsszenen, verschleierte Frauen, die sich als die Gesuchte entpuppen – all das entstammt dem zeitgemäßen Arsenal der Romantik und verrät neben Jean Pauls Einfluss auch den von Ludwig Tieck oder E. T. A. Hoffmann. Genauso deutlich fällt das autobiographische Material ins Auge, das auf diese Weise verarbeitet wurde; am Ende ist es geradezu erstaunlich, dass Stifter es schaffte, von dem persönlichen Ursprung so weit Distanz zu gewinnen, wie es zum Gelingen nötig war. Immer wieder dreht es sich um die entscheidende Frage: Warum hat der Liebende die Geliebte nicht für sich gewinnen können? Und noch ein Schritt davor: Was war denn diese das eigene Ich überwältigende Liebe überhaupt, dass er ihr gegenüber so vollkommen wehrlos war? »Sind das Polaritäten der Geister, sind es psychische Wahlverwandtschaften? Ist es gänzliche Narrheit?« Albrecht begreift es so wenig wie Stifter; das einzige, was beide zu wissen glauben, ist, dass Liebe und Leidenschaft nicht zusammengehören.
Hier liegt der zentrale Gehalt der Feldblumen; Stifter musste sich endlich Klarheit darüber verschaffen, wie sich Liebe, Freundschaft und Leidenschaft zueinander verhielten. Angela ist das Traumbild eines Mädchens, das umfassende Bildung mit vollkommener Schönheit in sich vereint. Albrecht ist von beidem gepackt – wie aber soll man sich einen Liebenden vorstellen, der an der Geliebten zwar die Schönheit wahrnimmt, nicht aber den erotischen Reiz? Angela bleibt ihm »eine würdevolle Jungfrau, vor der zaghaft jeder Schmuzgedanke verstummen muß«; oder, noch deutlicher: »Das ist das Hohe einer naturgerecht entwickelten Seele, daß jenes kranke, sentimentale und selbstsüchtige Ding, was wir Liebe zu nennen pflegen (was aber in der That nur Geschlechtsleidenschaft ist), vor ihr sich scheu verkriecht«.
Im Mittelpunkt der Erzählung steht jener Augenblick, den man als eine Schlüsselszene für Stifter ansehen muss, wiederholt er sich doch fast wörtlich in der Mappe meines Urgroßvaters, jenem Lebenswerk, das den Schriftsteller begleitete bis zu seinem Tod: der Eifersuchtsanfall, mit dem der Held seine Liebe verspielt, selbstverschuldet und grundlos. Auch wenn die Wirklichkeit Stifter den guten Ausgang der Literatur versagte, spricht er hier offenkundig von seinem Verhalten gegenüber Fanny Greipl. Er selbst hatte die Eifersucht empfunden, die er jetzt Albrecht zuschrieb, er selbst hatte den Verrat begangen. Was aber war dieser Verrat? Wirklich nur die Eifersucht eines Mannes, der sich betrogen glaubt – eine zwar tatsächlich grundlose, doch kaum unverständliche Reaktion? Noch herrschte ja nicht jener harte, übermenschliche Begriff des absoluten Vertrauens wie in der Letzten Mappe, und Angelas Verzeihung kommt nicht erst nach langen Jahren der Bewährung, sondern bereits nach vierzehn Tagen. Nein, der Verrat lag tiefer. Bei Stifter selbst waren es weniger die gekränkte Liebe und das Eheversprechen an Amalia gewesen, als er die falsche Nachricht von Fannys Verlobung erhielt, es war etwas, was er dieser nie eingestehen durfte: die körperliche Beziehung zu der anderen Frau. Und am Grunde der ganzen Problematik von Eifersucht und betrogenem Vertrauen liegt ebenso noch mehr: Stifter warf es sich als Verrat vor, dass selbst in der »reinen Liebe« zu Fanny eben nicht jeder »Schmuzgedanke« verstummt war. Das ...