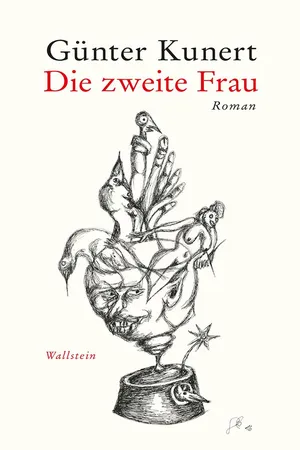![]()
II
Würde man Barthold fragen, was eigentlich für seine Lebensumstände am typischsten wäre, müsste er nach längerem Überlegen, nötig, die Gewöhnung an ebendiese Umstände durchbrechen und ihre Besonderheit erkennen zu können, das Warten in allen seinen Erscheinungsformen nennen. Vom simplen Harren in konkreter Einkaufsschlange auf Bedienung sowie dem gleichen, doch abstrakteren Warten auf einer Liste mit Konsumgütern gehobenen Bedarfs, zu den höheren Ebenen der Erwartung verbesserter Arbeitsbedingungen, Prämien, Gehaltsaufbesserungen bis zu gesteigerten Formen, in denen das Warten zum Hoffen wurde, wodurch die individuellen Ziele zu allgemeinen erweitert wurden: man ein größeres Maß an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zu erhalten gedenkt, doch in diesem umfänglicheren Bereich ähnlich oder ganz genauso versorgt wird wie im Konsum-Laden, und die Ecke, wo das Bier entweder vor Bartholds Erscheinen ausverkauft ist oder erst noch kommen soll, das Weißbrot überhaupt wieder mal ausblieb und die ungarische Salami, ein legendäres Genussmittel, an eine kleine Gruppe privilegierter Kunden heimlich verteilt wurde. Unter solchen Umständen trösten sich manche Leute mit dem gerahmten Spruch in ihrem Wohnzimmer: »Die Hälfte seines Lebens / Wartet der Mensch vergebens!«, oder aber, wie Barthold, tragen sie in einer Aktentasche eine halbe Bibliothek mit sich herum: Wenn sie schon um das einzige Wesentliche, das sie besitzen, bestohlen werden, um Daseinsdauer nämlich, wollen sie die Verluste wenigstens so klein wie möglich halten.
In Leserbriefen forderten Bürger, man möge beispielsweise während des Anstehens in Fleischereien Vorträge über die Mitteleuropäische Tierwelt halten oder zumindest Ratschläge für gesunde Mahlzeiten erteilen; im Fachblatt für Gesundheitswesen ist erwogen worden, ob man nicht in den Wartezimmern der Staatlichen Arztpraxen Beratungsstellen über interessierende Fragen wie etwa Selbst-Therapie einrichten sollte, um erstens die behandelnden Mediziner zu entlasten und zweitens jedem die Möglichkeit zu geben, sich unter Anleitung selber zu kurieren. Solange das jedoch noch nicht erreicht ist, liest man eben: wie Barthold, zu einer Zwischenkontrolle seiner »Vegetativen Dystonie« bestellt, und nun, ungestört von Husten, Hüsteln, Räuspern, Schneuzen, Stuhlbeinscharren, Geflüster, Zeitungsgeblätter, gedämpftem Straßenlärm, über die neuesten Ergebnisse der Luftbild-Archäologie gebeugt. Phantastisch, dass man aus einer gewissen Höhe Erkenntnisse gewinnt, die unten nie zu ernten sind!
Eine Verfärbung des pflanzlichen Bewuchses, eine schwache Absenkung des Bodens anstelle völlig verschwundenen Mauerwerkes, ergibt ineinandergeschachtelte Rechtecke und Quadrate einstiger Bauten. Ausgehend von den zur Illustration der Methode abgedruckten Fotos, bieten sich Barthold gewisse philosophische Spekulationen an: Beweisen die Bilder nicht exakt die These, dass die Negation einer Sache diese selber enthält und aufbewahrt? Kann man eigentlich die Spuren der Vergangenheit »rein wissenschaftlich« betrachten? Es gibt doch gar keine »reine« Wissenschaft, nur der Grad ihrer Verschmutzung mit Ideologie, Glaubensgrundsätzen, Vorurteilen, fragwürdigen Interessen – eben mit menschlicher Beschränktheit – schwankt und ist nur selten genau messbar. Früh- und Vorgeschichte: Mich hat doch nicht die Abschlagetechnik bei der Faustkeilherstellung als solche interessiert; nicht der konkrete Gegenstand an sich, sondern sein unsichtbarer Begleitumstand. Dass vor zehn-, vor fünfzehntausend Jahren ihn ein anderer Barthold in der Hand gehabt hat, die Glätte der kantigen, splittrigen Flächen fühlend, und wie nach einer Weile in der Umklammerung das keilförmige Stück sich erwärmte. Ich kann davon nicht absehen oder solche Gedanken beiseitelassen und ausschließlich einen toten Gegenstand in einen chronologischen und geographischen Zusammenhang einordnen. Das allein wäre unbefriedigend; für mich stellt der bearbeitete Brocken die Verbindung her, über unbegreifliche Zeiträume hinweg, zu einem »Damals«, von dem uns leblos-akademische Zeichnungen untalentierter Illustratoren einen Eindruck zu vermitteln suchen, der gar nicht zu vermitteln ist. Falls in ferner Zukunft irgendwer Bilder von uns finden sollte, was schon könnte er daraus entnehmen? Dass wir in Häusern lebten, pferdlose Wagen fuhren, Hüte trugen und manchmal Helme. Auch von unserem wahren Wesen würde der künftige Betrachter nichts erfahren. Wie es in Wirklichkeit gewesen ist, im vorgeschichtlichen Dämmerlicht, ahnt niemand, wobei fraglich erscheint, ob es sich de facto um Dämmerlicht gehandelt und nicht ausschließlich unsere geringe Kenntnis des Gewesenen diese Formulierung geprägt hat. Was für eine Borniertheit, unseren individuellen Mangel zum Maßstab zu erheben: bloß weil wir etwas nicht erkennen, reden wir von Finsternis! Als das monotone »der Nächste bitte!« ertönt, vergehen einige Augenblicke, ehe Barthold aus dem Mesolithikum zurück ist und inmitten leidender Gestalten Umschau hält, wer wohl der nächste Patient sei, bis er merkt, dass keiner aufsteht, dass die Aufforderung ihm gelten könne. Verlegen die Bücher zusammengerafft und eilig dem Ruf nachgekommen, während Margarete Helene daheim noch aufräumt: Ihr vierzigster Geburtstag steht ins Haus, darinnen die Fenster geputzt, die Gardinen gewaschen, die Böden geschrubbt, die Teppiche geklopft werden müssen. Besondere Daten fordern besondere Ordnung. Längst ist der Schuppen liquidiert und vergessen; seine Bestandteile hat Barthold an der Hauswand aufgestapelt: für Feuerholz im Winter. Nur der festgestampfte Lehmboden, gelbliches Quadrat im Grünen, ist noch umzugraben, pflanzbereit zu machen; die einstige Existenz des Schuppens wäre nur aus mehreren hundert Metern Höhe mit Spezialfotografie nachzuweisen: Dergleichen Forschung interessiert weder die Archäologen noch Margarete Helene, die, nachdem sie in allen Zimmern die Gardinen abgehakt, dies als letztes in Bartholds Arbeitszimmer vornimmt: Wie ganz anders der Raum wirkt, viel heller und ungemütlicher. Geradezu nackt! Und bei diesem Stichwort, indessen sie sich über das Bündel Tüllgeknüll beugt, stellen sich unbewusst Kontakte zwischen Hirnzellen her, leiten bio-elektrische Ströme Reize weiter, daraus ein Büstenhalter Bildnis wird: vom Original, das die Müllkippe Schwanebeck bei Berlin auf Nimmerwiedersehen verschlang, insofern unterschieden, als es nicht derart alt und zerfallen erinnert wird, wie es tatsächlich einmal war. Je intensiver Margarete Helene sich das Stück zurückruft, desto neuer wird es. Und wenn Barthold ihn doch dort versteckt hatte? Von wem stammt er? Von einer Vorgängerin? Gibt es möglicherweise von ihr noch mehr Relikte? Ihr Blick durchkreist den Raum wie eine Überwachungskamera im Kaufhaus, die alles »aufnimmt«. Margarete Helene nimmt ebenfalls alles auf, was die vier Wände ihr präsentieren: Bücher, gebundene Zeitschriften, Aktenhefter, Sammelmappen mit Zeitungsausschnitten, Karteikästen, einer offen, seine gelben Karten mit bunten Reitern besteckt, ein Schreibtisch, ein Sessel, abgewetzt, ein Läufer, abgetreten, wir sind wirklich keine reichen Leute, und zwei Blattpflanzen in irdenen Töpfen auf alten Porzellantellerchen. Ein Versteck bemerkt sie nicht, aber das wäre wohl auch keines, entdeckte man es beim ersten Hinsehen. Ein bisschen suchen müsste man schon, wäre das nicht zu unfair. So etwas tut man nicht. Man kramt nicht heimlich in fremden Fächern, mein Kind. Jawohl, Mama, aber Barthold ist kein Fremder. Fremd meint ja auch bloß: nicht dein Eigen, mein Kind! Ja, Mama, aber juristisch gehört einem Ehepaar alles gemeinsam, sodass sein Eigen auch mein Eigen ist, und in meinem Eigen kann ich nach Herzenslust wühlen! Vor solcher Logik verstummt die ohnehin schwache Gegenstimme, und Margarete Helene zieht das oberste Schubfach aus dem Schreibtisch: zum ersten Mal in ihrer Ehe. Vor ihr befinden sich mehrere Bleistifte in unterschiedlichen Stadien des Verbrauchtseins; ein Anspitzer in Globus-Form, anstelle der Antarktis ein winziger nach innen gerichteter Trichter; Büroklammern, zwei Schlüssel, vermutlich von Zimmertüren; Schreibpapier; ein Oberhemdenknopf, den sie schon lange gesucht hatte: Na, also, das legitimiert solche Suche eindeutig; Heftklammern; und in den seitlichen Ritzen die übliche Menge undefinierbaren Gekrümels. Nichts sonst.
»Und wie fühlen Sie sich jetzt?« Aus dem gerade über den Kopf zurückgestülpten Hemd wie unter einer dämpfenden Kapuze hervor, beantwortet Barthold die Frage negativ.
»Also nicht besser?«, fragt erneut das junge Gegenüber im ungewohnten Kittel, da dauernd an den Ärmeln und Aufschlägen herumgezupft wird.
»Aber Sie nehmen doch regelmäßig, was ich Ihnen verschrieben habe?« Diese Erkundigung meldet das nahe Ende seines Lateins. Schon schaut er dabei hilflos auf den leeren Notizblock vor sich, auf den keine unsichtbare, doch gütige Fee einen Hinweis schreibt, was man in derartigen unsicheren Fällen noch veranlassen könnte. Warum ist man auch von der Chirurgie zur inneren Medizin hinübergewechselt – da, eine Erleuchtung!
»Wir könnten vielleicht eine Kur beantragen …?«, und dazu ein einladendes Lächeln: Mensch, sag schon ja, das verordne ich nicht jedem, aber dieser Nichtjeder schüttelt den Kopf:
»Wissen Sie, Herr Doktor, die Arbeitsbedingungen, immer in Regen, Wind und Wetter draußen, das Rheuma, klar, habe ich schon lange, bin ja eine ziemliche Zeit dabei, Bandscheiben, die sind ebenfalls stark beeinträchtigt, der Magen, das Herz, dann die Kopfschmerzen: Mein Gott, falls das so weiter geht mit mir …«
»Beruhigen Sie sich, so schlimm ist das doch nicht, diese Symptome haben doch alle Leute, das können Sie mir glauben. Das ist eine Zeiterscheinung …«
Was soll man dem noch hinzufügen, wo doch, wie Barthold es Schwarz auf Weiß weiß, Herr Michel de Montaigne vor vierhundert Jahren darüber erschöpfend Auskunft gegeben hat; ja, er könnte dem jungen Arzt ins rosige Gesicht hinein zitieren: »In dem Durcheinander, das bei uns seit dreißig Jahren herrscht, sieht jeder Franzose, in seinem Privatleben wie in der allgemeinen Politik, sich zu jeder Stunde vor die Möglichkeit gestellt, dass sein Schicksal vollständig umschlägt; umso mehr braucht er kräftige, haltbare moralische Stützen für seine Widerstandskraft. Eigentlich sollten wir dem Schicksal dankbar sein, dass wir nicht in eine weiche, schlaffe, faule Zeit hineingeboren sind: jetzt kann mancher Mensch durch sein Unglück eine gewisse Bedeutung erlangen, dem das auf andere Weise nie gelungen wäre!«, doch das würde den minorennen Jünger Aesculaps noch mehr verwirren. Zaghaft setzt er gegen Bartholds schweres Kopfgeschüttel wie einen Beschwörungsspruch die Worte:
»Bad Brambach!«
»Vielleicht«, seufzt Barthold, »nähert man sich bereits der Invalidität …?«
Aufgeregter Protest der Gegenseite:
»So weit sind Sie noch lange nicht, bleiben Sie vorerst noch eine Woche zu Hause, dann sehen wir weiter …«
In der untersten Lade der linken Schreibtischseite steckt ganz aufgerichtet und darum vielleicht übersehen hinter einem Schnellhefter eine Ansichtskarte von einer neutralen Waldeslichtung, verblichen mit der Anrede »Lieber Barthold« und der Unterschrift: »Deine Elfi«. Die Mitteilung dazwischen ist kurz: »Wir haben jeden Tag schönes Wetter. Die anderen fragen, wo ich meinen Mann gelassen habe. Das geht die gar nichts an.« Unterschrift. Punkt. Aus. Kurz und knapp und trotzdem rätselhaft. Poststempel: Roggenthin / Mark. Zwar legte Barthold nicht das übliche voreheliche Geständnis über vorangegangene Amouren ab, Beichten dieser Art hatte sie nicht verlangt, er erwähnte auch nur zwei, drei oder gar vier flüchtige Bekanntschaften sexual-hygienischer Natur, unter denen aber, wie Margarete Helene sich nun zu erinnern meinte, sich niemals eine Elfi befunden hatte. Was hieß: »… fragen, wo ich meinen Mann gelassen habe …« – das klang verdächtig, und nicht nur nach großer Intimität, sondern sogar nach einem gewesenen Lebensbund. Der Büstenhalter! Meine Ahnung! Das war Elfis Busen – kein Zweifel!
»Viel frische Luft, Ruhe, leichte Speisen, also ausreichend Obst und Gemüse, und vor allen Dingen: Keinen Ärger!« Als Barthold, ohne seinen Unmut zu verbergen, was eventuell für die fernere Behandlung vernünftiger gewesen wäre, auf den floskelhaften Schluss der Beratung ein »Das sind doch alles utopische Vorschläge!« hervorstößt, setzt die im Hintergrund klappernde Schreibmaschine für einen Moment aus, um mit doppelt heftigem Anschlag fortzulärmen.
»Kommen Sie in der nächsten Woche wieder, ich habe jetzt keine Zeit mehr, es warten Hunderte von Patienten …«, und blättert schon in einer anderen Krankengeschichte. Barthold kommt sich verhöhnt vor: frische Luft, Obst und Gemüse, keinen Ärger?
»Warum verordnen Sie mir nicht gleich einen Kuraufenthalt in der Schweiz? Das ist so leicht zu erreichen wie die Vermeidung von Ärger! Wo leben Sie denn, Herr?« Und zeitlich synchron mit seinem Faustschlag auf den Schreibtisch, demzufolge die Krankenkartei zuklappt und das Stethoskop herunterfällt, wundert er sich selbst über seine Erregung, für die der Anlass viel zu nichtig gewesen ist, um ihre Heftigkeit erklären zu können. Die Schreibmaschine schweigt endgültig und betroffen. Bartholds Gegenüber errötet tief, während sein Patient ihn wild anstiert, die erstarrte Faust noch immer auf der Schreibunterlage, als sollte sie dort künftig als Briefbeschwerer verbleiben. So viel gestaute Aggressivität hätte man dem Patienten nicht zugetraut, machte er doch eher einen phlegmatisch-melancholischen Eindruck, keinen cholerischen. Aber wer besaß heute denn noch genügend Menschenkenntnis; man kannte sich ja selber nicht.
Vielleicht war die erste Diagnose falsch: Der Mann litt an beginnender Schizophrenie, an Spaltungsirresein, lebte in zwei Zuständen zugleich, und falls der Arzt jetzt diese Überlegungen geäußert haben würde, Barthold hätte ihm vermutlich zufrieden zugestimmt: Gespalten kam er sich vor; seine eine Hälfte registrierte ganz kühl und sachlich, auch ein bisschen verwundert, was die andere da anstellte, indem sie heiser rief:
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Sie wissen doch genau, was los ist! Ärger vermeiden! Warum verordnen Sie nicht gleich Zyankali!« Zugleich hat Barthold volles Verständnis für den anderen, für dessen Hilflosigkeit angesichts allgegenwärtiger psychosomatischer Anomalität, an der alles ausschließlich medizinische Bemühen zur Kurpfuscherei entartet. Zustände werden nicht mit Pillen kuriert. Darüber hinaus spürt der unbeteiligte Barthold das Mitleid, das dem Berserker Barthold zuteil wird, weil der hier ablädt, was ganz woanders hingehört. Er, der falsche Adressat, schweigt dazu; außerdem wird der Ausbruch in wenigen Minuten vorbei sein. Was der Mensch an Nahrung in sich hineinfrisst, muss ja auch wieder raus, darüber besteht kein amtlicher Zweifel, nur was die Seele an Unverträglichkeiten täglich schlucken muss, das soll sie spurlos verdauen, ohne es ausscheiden zu dürfen. Ganz klar, dass, bei passender Gelegenheit, das große Kotzen anfängt. Merkwürdig, dass solche Symptome nie als Symptome erkannt werden; deshalb redet man ja auch juristisch darum herum. Schon macht sich eine Abschwellung der Stirnadern bemerkbar, ein Absinken der Stimmlage auf die Wellenlänge der Resignation; die Rückzugshaltung drückt sich auch verbal aus:
»Na, ist doch wahr! Was soll denn der ganze Unfug … Da helfen eben keine Tabletten …« Erledigt. Vorbei. Kann abgeheftet werden. Die Sprechstundenhilfe, mit trainiertem Gehör dem Ablauf folgend, hat bereits ein bedrucktes Blättchen ausgefüllt, das sie dem Internisten vorlegt, damit er unterschreibe. Währenddessen wiedervereinigten sich die beiden Bartholde, um in der Sekunde des Dockings Scham und Reue hervorzurufen, von einem Ausmaß, dass für ihr Verschwinden längere Zeit benötigt werden wird.
»Hier, Ihr Rezept, ich habe Ihnen noch ein Beruhigungsmittel dazu geschrieben, Faustan, nicht mehr als zwei am Tag, also bis zum nächsten Dienstag … Der Nächste bitte, Schwester Anni …«
Später erst, die Mappe fest an die Seite gepresst, als enthielte sie etwas unendlich Kostbares, etwas, das man nur einmal im Leben erhält, arbeitet Bartholds Kopf daran, das Unbehagen abzustellen und den üblichen Zustand emotionaler Spannungslosigkeit herzustellen. Auf einer lädierten Bank, Geschenk des Magistrats von Groß-Berlin an seine für das und anderes zu Dauerdank aufgeforderten Bürger, versucht Barthold in der ägyptischen Finsternis seines immateriellen Innerns die Gründe für seinen Ausbruch aufzufinden, funkenschlagend erkennt er unverhofft, was er ins tiefste Dunkel abgedrängt zu haben glaubte: Eolithen. Natürlich nicht allein die Eolithen. Der Gründe gibt es viele, so weit das Auge zu schweifen gewillt ist, aber die Eolithen bedeuten einen niemals überwundenen Schlag. Die Reaktion der lieben Kollegen und vorgesetzten Kollegen: eher spöttisch statt verständnisvoll, höhnisch statt tröstend, seinen Irrtum nicht in der Sache suchend, sondern ausschließlich bei ihm. Freilich habe ich mir in meinem naiven Sinn die Mitmenschlichkeit anders gedacht; nicht derart von Konkurrenzneid geprägt. Dass man eines anderen Ansehen herabsetzt, um das eigene zu erhöhen, das war doch für unsere Ordnung nicht vorgesehen. Eolithen! Größere Geister haben sich da täuschen lassen. Und Bartholds Schock war besonders intensiv, weil er, und vielleicht ist er in dieser Hinsicht ebenfalls ein Produkt und Opfer der Gesellschaft, stärker an seine Entdeckung geglaubt hatte, als es sonstwo üblich war. Mitten in der Mark Brandenburg ein ganzer Acker voller Kleinplastiken: Pferdeköpfe, faustgroße fratzenhafte Schädel, abgeschliffene Idole, steinerne Gesichter und Ritzbilder auf Steinen, alles eigentlich ganz deutlich, betrachtete man sie von der richtigen Seite und fiel das Licht in einem bestimmten Winkel auf die Fundstücke. Noch dazu, wo sich im gleichen Umfeld Tonscherben mesolithischer Herkunft befanden: in Bartholds Bericht über die Ergebnisse der Grabungen sprach sich die Überzeugung aus, die späten Mittelsteinzeitalter der Mark Brandenburg hätten, wie ihre Skulpturen bewiesen, Kontakte mit der im östlichen Mittelmeer bereits stattgefundenen neolithischen Revolution gehabt; vergliche man Ritzzeichnungen und die starke Stilisierung zweier Gesichtersteine mit zeitlich früheren Erzeugnissen im Dreieck Kleinasien, Palästina, Irak, sei der Einfluss unleugbar. Verbindungen jungsteinzeitlicher Kultur vom Orient bis zur Ostsee und England sind verifizierte Tatsachen; Barthold schwelgte in der Vorstellung, dass seine Funde in Bälde zu einer geographisch benannten Leitformation werden könnten, wie das Neanderthal einen Frühmenschen bezeichnet, Aunjetitz in der Tschechoslowakei eine Keramiktechnik oder das Örtchen Le Moustier den Komplex der Feuersteinindustrien der Paläanthropinen. Wandlitz bei Berlin würde zum Namen für die Kleinplastik eines bestimmten Typs, in allen Museen der Welt stünden Wandlitziana, wobei nicht unvermerkt bliebe, dass Barthold der Entdecker dieser Kultur gewesen sei. Plötzlich: alles bloß Eolithen. »Von Witterungseinflüssen und Erosion geformtes Gestein.« Sah aus, als ob, war aber nicht.
Und eines Morgens hatte er auf seinem Schreibtisch im Institut einen Granitbrocken gefunden, Mund, Augen, Nase kindlich mit dem Filzstift drauf gemalt, darunter ein Zettel mit dem Text: »Dem Entdecker meiner künstlerischen Talente – Mit brüderlichen Schöpfergrüßen – sein Picanthropus!« Das hieß: »Affenmensch.« Die besten Späße sind die anonymen. Solche leidigen Erinnerungen ergaben, dass Margarete Helene ihre Hausarbeit vollbrachte, ohne (wie sonst) durch den immer an störenden Stellen herum sitzenden oder herum kramenden Mitbewohner behindert zu werden. Die Gardinen haben den maschinellen Waschvorgang überstanden, die Scheiben sind geputzt, die Teppiche und Läufer gesaugt, rein mechanisch jedoch und ohn...