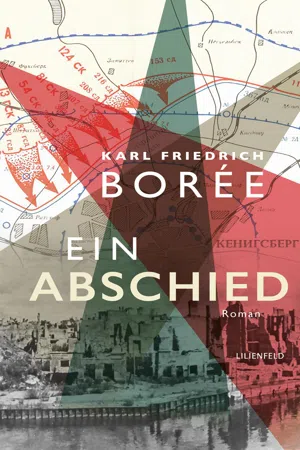![]()
1
Die von den Russen bedrohte Stadt Königsberg befand sich bis zu ihrer tatsächlichen Einschließung, bis weit in den Januar 1945 hinein, in einem Zustande, den man wohl einer Euphorie vergleichen durfte, da der Todgeweihte, sei es durch die Gnade der Natur, sei es dank der Geschicklichkeit seiner Ärzte, an sein nahes Ende nicht glaubt. Dabei hatte sie eine in Wahrheit niemals heilbare Wunde schon empfangen, ihr Leib war ausgebrannt: in zwei kurz aufeinanderfolgenden Augustnächten des Jahres 1944 war die alte, dicht gebaute, historische Innenstadt, die innerhalb der ehemaligen, jetzt in Anlagen verwandelten Wälle lag, durch einen Feuerregen vernichtet worden, so daß eigentlich nur noch die angehängten Gartenvororte blieben. Indes man nahm nach dem ersten Entsetzen und nachdem man sich, so gut es ging, in den unzerstörten Kellern und Außenvierteln eingerichtet hatte, diese Katastrophe als einen nun einmal unvermeidlichen Anteil am allgemeinen Kriegsschaden hin. Es herrschte noch kein größerer Mangel an irgendwelchem Lebensbedarf als jener durchaus erträgliche, an den man seit Beginn des Krieges klüglich gewöhnt worden war, und man vertraute der Festung, die, auf den modernsten Stand gebracht, dem Feinde trotzen würde bis zum Waffenstillstand, der nun allerdings nicht mehr auf sich warten lassen werde, nachdem das vor einem Jahre noch Unaussprechliche und wahrhaft Unglaubliche Tatsache geworden war, daß der Feind, von Stalingrad, Moskau und Petersburg die Front zurückdrängend, im Lande stand. Ohne sonderliche Panik sah man die ländliche Bevölkerung in die Stadt hineinströmen: wie in alten Zeiten war die befestigte Hauptstadt der Provinz die vorgesehene Zuflucht.
Soweit das Befinden des Todeskandidaten. – Herr Marian Burger, der, zu einer kleinen Arbeitspause veranlaßt, jenen nicht ganz ziemlichen medizinischen Vergleich bei sich anstellte, kam nun zu den geschickten Ärzten, die das Sterbelager umstanden. Unter dem Treuwort – so bezeichnete man es wohl am besten – „Die Festung Königsberg wird gehalten!“ trafen die Behörden weder Anstalten, die Stadt räumen zu lassen, noch munterten sie die Einwohnerschaft zur Abreise auf. Sie träufelten ihr Glauben ein. Sollte es wirklich, so vertraute man ihnen, zu jener äußersten militärischen Situation kommen, von der man sich kaum eine Vorstellung machte, so würde unter dem Schutz des Verteidigungsringes immer noch Zeit bleiben, die unbeteiligte und wahrhaftig doch unschuldige Zivilbevölkerung in Sicherheit zu bringen.
Doktor Marian Burger, Chemiker in der großen Zellstoffabrik, die flußabwärts am nördlichen Ufer des Pregels lag, stand breitbeinig vor dem Fenster seines Laboratoriums, in der einen Hand seine Pfeife, in der andern ein Reagenzglas, und wartete auf den Niederschlag, der sich in dem schmalen Glaszylinder zeigen sollte. Er tat einen Zug aus der Pfeife. Sein Gehilfe, ein älterer Arbeiter, den er sich aus der Kocherei geholt und selbst herangebildet hatte, hantierte im Hintergrund.
„Also jetzt dürfte doch dem Blödesten allmählich ein Licht aufgehen, warum man ihn hierhält.“
„Wenn ich meine Meinung sagen darf, Herr Doktor: weil man die Soldaten woanders braucht.“
„Sehr weise, mein Herr. – Und – weil die Herrschaften Angst vor einer Panik haben. Ich beneide diese Leute um ihre Großzügigkeit. Dreihunderttausend Menschen …“
„Das müssen doch jetzt mehr sein, mit all den Zugekommenen“, bemerkte der Gehilfe.
„Es sind aber auch etliche weg, denen es hier zu östlich wurde.“
Sogar die Heizung im Haus funktionierte noch gut. Draußen waren an diesem Morgen zehn Grad Kälte gewesen. – Der mittelgroße, etwas zur Fülle neigende Mann von ungefähr vierzig Jahren hatte sich umgedreht und lehnte jetzt mit der Straffheit der Wohlbeleibten in der Fensterecke, ein Bein lässig über das andere geschlagen. Sein Gesicht war rund und voll, ein kleines Bärtchen saß auf seiner Oberlippe; das dichte Haar war leicht durchgraut.
„Seien wir froh, daß wir hier im Hause stecken!“
Der ganze Betrieb lag sozusagen wohlverschanzt hinter seiner Kriegswichtigkeit. Bis zu diesem Tage – einem Tag in der Mitte des Januars 1945 – war es Burger gelungen, dank seiner Unentbehrlichkeit in einem für „kriegsentscheidend“ erklärten Unternehmen und dank einem leichten Herzfehler jeder „Erfassung“ zu entgehen, und er war geneigt, in solcher Verschonung, die er sich nicht gescheut haben würde, auch mit verbotenen Mitteln zu verteidigen, eine ihm geschuldete Rücksicht der längst ihre Schranken überschreitenden Zeitgeschichte zu erblicken. Er stand dem Staat an sich skeptisch gegenüber; vollends aber in dessen gegenwärtiger Gestalt, die ihm durch die Person eines jeder Kultur baren und jeder Brutalität, auch der handhaften, fähigen örtlichen Repräsentanten versinnbildlicht wurde – sah er in ihm einen Räuber an seinem Leben, das durch ihn gezwungen wurde, schönste Jahre in einer Epoche leiblicher und geistiger Beschränkungen abzuspulen. – Die Arbeit hätte er sich nicht besser gewünscht. Die meisten leitenden Herren waren einberufen, einzelne längst gefallen. Dadurch hatten sich Burgers Geschäfte vermehrt, aber manche lästige Reibung war geschwunden. Er hatte es nur noch mit dem Generaldirektor zu tun, der seinerseits so mit Arbeit belastet war, daß er ihm völlig freie Hand ließ.
Aus Überzeugung hielt er auch die Arbeit in den seiner Meinung nach jedem Erwerbsberuf zukommenden Schranken: sie mußte ihm gestatten, ein Leben zu führen, wie es seiner Vorstellung vom Leben entsprach, das Leben eines geistigen und also den Wert des Daseins erkennenden Menschen. Er war stolz darauf – und hatte bewußt nach diesem Ziele gestrebt –, daß sein qualifiziertes Können ihm eine Stellung verschaffte, in der er schwer zu ersetzen war, und überhaupt, wie er es gern ausdrückte, einen zu jeder Zeit und allerorten kursfähigen Wert darstellte. Es war ihm im Grunde recht, daß man ihn nicht in den Vorstand der Firma gewählt hatte. Seine Position im Betriebe sicherte ihm eine angenehme Unabhängigkeit und gab ihm nicht nur die Mittel, sondern ließ ihm auch die Zeit, die er zur Befriedigung seiner mäßigen, aber ausgewählten Lebensansprüche brauchte. Er wandte die auf solche Weise errungene Freiheit seiner Bibliothek zu, die ihn als Kenner der Literaturgeschichte auswies, dem Theater, der Musik, welche er zwar nicht selbst ausübte, aber mit Verständnis genoß, dem Umgang mit wenigen ähnlich gerichteten Freunden und mit seiner Frau. Diese hatte er zu Anfang des Krieges sich entschlossen zu heiraten. – Er verglich seine Situation ohne Überheblichkeit, lediglich im Sinne eines rechtfertigenden Vorbildes, mit der seines Landsmanns Johann Georg Hamann, der als bescheidener Packhofverwalter in eben diesem Königsberg den Platz gefunden hatte, um sich durch seine „nebenberuflichen“ Arbeiten den europäischen Namen eines „Magus im Norden“ zu erwerben. Solche schlichte Behauptung der Souveränität des Geistigen erschien Burger mustergültig. – Solange die Hartungsche Zeitung existiert hatte, war er häufig in ihr als Theater- und Musikkritiker zu finden, und die Unterdrückung dieses altehrwürdigen und bis zum letzten Tage der Tradition der Geistesfreiheit ergebenen Journals hatte ihn als ein gegen seine Person gerichteter Schlag getroffen.
Der Gehilfe war dazu übergegangen, Glas- und Porzellangeräte in dem breiten Waschbecken abzuspülen. Burger hielt die gläserne Röhre noch einmal gegen das Licht. Es zeigte sich sozusagen nichts. Er bewegte sie flüchtig über der kleinen offenen Gasflamme auf dem Tisch. Man konnte nichts anderes tun, als den Lauf der Dinge abzuwarten und den Betrieb im Gange zu halten, notfalls in einem Anschein des Ganges. Das Zimmer lag im vierten Stock. Der Morgen war hell, ein frostklarer Januarmorgen wie irgendeiner. Wenn man von diesem Fenster aus, von dem der Blick nach Süden ging, in die Welt hinaussah, merkte man gar nichts. Unten lag der Strom, dunkel und glatt, wie ein Teich. Jenseits zog sich eine Zeile niedriger, tief verschneiter Schuppen und Lagerhäuser hin, die das andere Ufer säumten. Über diese unregelmäßige Kante hinweg sah man auf das ungekränkte Weiß der Wiesen, das sich in der Ferne durch einen milchigen Dunst mit dem Himmel vermählte. Das Weiß war matt vergoldet, seine Schatten glommen blau. Rechts starrte, schon in einiger Entfernung, kräftig angestrahlt der Doppelbau des städtischen Silospeichers aus dem platten Grund in die milchige Luft, ein ungestümes Monument des menschlichen Schaffenswillens. – Die Gedankenverbindung, daß dies alles deckende Weiß ein Leichentuch sei, eine ironische Täuschung, war so banal und zugleich so zwingend und treffend, daß Burger lächelte. Seit Stalingrad reifte das, was er für seine Person vom ersten Kriegstage an hatte wachsen sehen, das Schicksal dieser Stadt, das Schicksal der Provinz: dieser Krieg würde von Deutschland mit Ostpreußen bezahlt.
Er wandte sich etwas ins Zimmer hinein: „Es geht nichts über die tröstliche Gleichmütigkeit der Natur oder – über ihre schauerliche Gleichgültigkeit.“
Dieses lebendige Wesen, das mit Seehafen und Großhandelsstätten, mit Universität, Kunstakademie, Opernhäusern und Theatern, wie auch mit Marzipan fabrizierenden Kaffeehäusern und mit Weinstuben, mit dem anmutigen Gürtel seiner zu Parkanlagen verzauberten Wälle und seiner von Nachtigallen tönenden Gartenquartiere, im Rahmen einer eigentümlichen Landschaft, welche Meeresstrand, Steilküsten, Haffe und Nehrungen einbezog, einen wohl abgerundeten, autonomen Organismus bildete und, seiner alten deutschen Tradition bewußt, ein reges geistiges und gesellschaftliches, sanft sybaritisches Dasein genossen hatte, war in seinen Augen schon dahin. Sie hatten es dazu kommen lassen, daß man sein Herz verbrannte, wie man einen Haufen Gerümpel verbrennt, und nun opferten sie auch den Rest. Vielleicht hing er an diesem Geschöpf mehr als an irgendeinem menschlichen Wesen. Schon gab es nicht mehr den Kneiphof auf der Pregelinsel, die Altstadt, den Löbenicht, den Tragheim, den Roßgarten, den Sackheim, Quartiere, deren jedes in aller Anmutlosigkeit ein ausgeprägtes Gesicht besaß. Ihre absonderlichen Namen waren jetzt schon das Einzige, was von ihnen noch existierte, ein Schall in den Ohren des lebenden Geschlechts, in wenigen Jahren mit ihm verhallend. Der doppelhöckrige, rote Dom war zusammengebrochen; es gab keine Junkerstraße mehr, in der man vor den Schaufenstern flanieren konnte; das Schloß war eingestürzt und hatte unter sich das „Blutgericht“ begraben. Man würde niemals wieder bei Schwermer sitzen und bei einer Tasse Kaffee durch die Lindenwipfel auf den Schloßteich schauen, diesen schlanken See inmitten einer Großstadt. Keiner würde sich mehr an den alten Fachwerkspeichern der Lastadie und ihren skurrilen Hausmarken ergötzen.
Die Gedanken liefen schnell. Jetzt hörte er den Gehilfen antworten: „Es fehlt Schlittchen zu fahren an solchem Tag!“
„Schlitten fahren! Warum nicht Schlitten fahren? Nach Groß-Holstein oder Haffkrug. Vielleicht fährt der Herr Gauleiter gleich mit.“
„Im Haffkrug kriegt man immer noch frische Wurst.“
Burger blickte in die frostklare Landschaft hinaus und dachte sehr unbestimmt darüber nach, was nun kommen werde. Im Herbst waren die Russen in Riga, Grodno und Kowno angelangt – „aufgetaucht“ hätte man auch sagen können; denn für die meisten war es ein Auftauchen, wobei man diesen Ausdruck allerdings ebensogut auf sie selber anwenden konnte, die nun endlich aus ihrer Siegesverblendung emportauchten. – Weihnachten hatte man sie in der Provinz: von der Romintener Heide bis Neidenburg krümmte sich die Front. Jetzt, Mitte Januar, war die Stadt vom Lande her nahezu eingekreist, wenn auch in einem weiten Bogen. Aber jetzt erst begann das tönende Wort von der „Festung Königsberg“, das für Burgers Ohren immer einen blasphemischen Klang besessen hatte, weil in ihm die Drohung mitschwang: „Uns wird es nicht darauf ankommen, diese Festung bis zum letzten von euch zu halten“, begann dieses Wort auch für die ewig Harmlosen den scharfen Ton der Wirklichkeit anzunehmen. „Festung“ und „Belagerung“ rückten in ihren Sinn ein; der Krieg nahm die Leute beim Wort. Nun sahen sie sich der Abschnürung gegenüber, der Auspressung ihrer letzten physischen Kräfte durch einen fanatischen Willen, der planmäßigen Hinmordung durch Granaten und Bomben, möglicherweise unterstützt von Hunger und Seuchen. Burger sah noch mehr. Er sah Plünderung, Verschleppung, Versklavung. Er sah eine Massenkatastrophe, die über die Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts hereinbrach, – ja, man mußte schon sehr weit zurückgreifen, bis ins Altertum, um einen rechten Vergleich zu finden. Vielleicht ging eine Generalvergewaltigung der Frauen nebenher, auch dies nach antiken Mustern. Die Geschichte versah sich um drei Jahrtausende, sie war zurückgefallen in abgelegte, barbarische Gebräuche. Burger lächelte: Die Geschichte? – Nein, der Mensch, das liebe deutsche Volk, das jetzt erwachte. Es hatte uralte Kräfte entfesselt, die nun, in moderner Ausrüstung, ihren Gesetzen folgend, sich endlich gegen die Entfesseler selber wandten. Es war ein Massenexperiment des modernen Menschen an seinem eigenen Leibe. Vivisektoren dürfen kei...