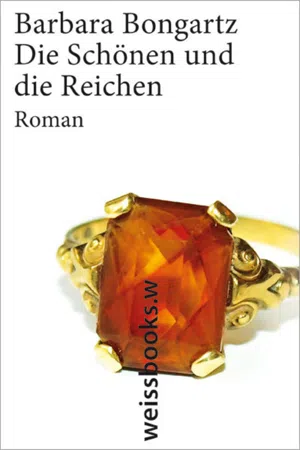![]()
Erster Teil
Dallas in Bayreuth
![]()
1
Einen großen Teil meiner Kindheit habe ich in wechselnden Häusern verbracht. Es waren Häuser, in die wir nicht gehörten. Später erst wurde mir klar, dass dieses Nomadentum, wie ich es nenne, weil der Begriff einem widerlichen Zustand die Aura von Abenteuer und Würde verleiht, schon lange vor meiner Geburt begonnen hatte. Meine Mutter, eine alleinstehende Frau, lebte davon. Sie putzte für andere Leute.
Als kleines Kind setzte sie mich in einer Küchenecke ab. Danach machte sie sich an die Arbeit. Später ging ich in dieselbe Schule wie die Kinder der Leute, für deren Dreck sie zuständig war. Vormittags saß ich im selben Unterricht wie die feinen Töchter und hatte zur selben Zeit Schule aus. Aber wir teilten den Schulweg nicht. Ich hielt Abstand, tat so, als sei ich mit mir selbst beschäftigt und trödelte herum. Schließlich gingen sie durch die Vordertür ins Haus, ich nahm den Seiteneingang. Sie gingen nach oben in ihre Zimmer. Ich ging ins Souterrain.
Alleinstehende Frauen mit Kindern waren damals infam, Schwulsein ein Verbrechen und Deutschland in zwei Teile geteilt. Die Jugendlichen heute wissen nichts mehr davon. Es gab Regeln, die heute keiner mehr kennt. Leute in meinem Alter scheinen die offziellen Lebensbedingungen von früher verdrängt zu haben, und selbst ich muss mich manchmal disziplinieren, um nicht zu vergessen, woran niemand mehr denkt. Mit den persönlichen und privaten Vergangenheiten ist das anders. Zwar vergisst man die auch, aber sie bleiben eingeschrieben in den eigenen Körper, als Tattoo, als Knochendeformation oder Allergie. Sie prägen die Perspektive, das Denken, das Fühlen, egal ob wir uns bewusst erinnern oder nicht. Der ursprüngliche Verschaltungsmodus, das innere Bild, ist oft überlagert, mitunter sogar getilgt. Aber es hat für den weiteren Weg gesorgt, und sich dessen nicht bewusst zu sein, kann unangenehme Folgen haben.
Ich habe Glück gehabt, dass meine Kindheit unmissverständlich war. Ich kann sie nicht vergessen. So wenig wie ich meine Mutter, eine blasse Erscheinung mit strähnigem Haar, zu wenig Gewicht und zu kurzgeschnittenen Fingernägeln vergessen kann. Sie starb vor ein paar Jahren an Knochenkrebs.
Dass meine Mutter mich mit in diese Häuser nahm, war ein heikles Arrangement. Sie war unsicher, durchlöchert von Angst. Ständig besorgt, dass wir lästig sein könnten, dass ihre Arbeit den Preis ihrer Anwesenheit nicht aufwiegen, dass ich etwas anfassen und kaputt machen könnte, verhielt sie sich, als seien wir verseucht. Mehr noch als die Bewohner, die nur in Ausnahmefällen in Erscheinung traten, schüchterten die Dinge in diesen Häusern sie ein. Die Gerätschaften, Utensilien, Dekorationsstücke waren Zeugen und Markierungen anderer Welten, die sie verunsicherten. Sie blieben ihr nicht nur fremd: Sie schienen beseelt von ihren Eignern zu sein, übermächtig in ihrer Erscheinung, lauernd in ihrer Stellvertreterschaft. Nie verlor meine Mutter den Dingen gegenüber ihre ohnmächtige Furcht, obwohl sie sie täglich säubern musste.
Ich, das kleine Mädchen, sah indes mit Staunen, dass es Leute gab, die andere für die Beseitigung des täglichen Drecks bezahlten. Ich fragte mich, woher das kam. Ich bin ein altkluges Kind gewesen. Während meine Mutter die Erniedrigung zu ignorieren schien, empfand ich die Würdelosigkeit für uns beide. Natürlich gab es Dreck und Dreck. Der Dreck auf der Terrasse war schlichter Schmutz, bröcklige Erde, feuchter Sand, nicht aufgeladen von privaten Handlungen wie die ungenießbaren Reste von Speisen oder der heikle Unrat, den intime Verrichtungen hinterlassen. War Mutter stumpf oder tapfer? Oder war es Demut, mit der sie das Nötige tat, ohne ein Wort darüber zu verlieren? Ich weiß nicht, ob sie je in Erwägung zog, etwas anderes zu tun, als anderen auf der niedrigsten Stufe zu dienen. Zu einer Zeit, in der ich alt genug gewesen wäre, es herauszufinden, lief ich davon. Ich wollte nicht das Kind dieser Mutter sein, kein Kind einer Frau für den Dreck, egal welches ihr Motiv gewesen war oder ob sie überhaupt eines hatte. Wie Annie Johnson in Sirks Imitation of Life wollte ich eine richtige Tochter sein, eben wie die da oben, kein verstümmelter Bastard mit nur einem Elternteil.
Bis zu meinem fluchtähnlichen Aufbruch in eine neue Welt, der noch einige Jahre auf sich warten ließ, war ich fremdem Reglement unterworfen. Bei schlechtem Wetter wurde ich in die Küche gesetzt, bei gutem Wetter durfte ich nach draußen. Dann huschte Mutter lautlos davon. Sie glich in ihrer verschämten Schnelligkeit einer Kakerlake, die das Licht flieht, obwohl sie über ihrer zitternden Furcht einen festen Panzer trägt. Ich schämte mich für ihr Schlottern, ihre hastigen Bewegungen, ihr devotes Gebaren.
Als ich bereits in die Schule ging, fand ich eine Lösung für meine immer unerträglicher werdende Scham. Ich begann, meinen Widerwillen gegen die pompösen Häuser, meine Abneigung gegen ihre Bewohner und meinen Ekel vor ihrem Dreck zu kultivieren. Ich arbeitete mich durch ihre Kloaken hinauf in den Olymp – nicht nur bildlich gesprochen.
Meine analytischen Lehrjahre begannen im Keller, in den Räumen des Personals. Ich kann nicht mehr zurückverfolgen, wie ich auf die Idee kam, die Fährten und Spuren dieser Leute zu verfolgen. Heute mutmaße ich, dass sie dem Wunsch entsprang, eine Ohnmacht in eine besondere Meisterschaft zu verkehren. Am Anfang kostete es mich große Überwindung. Zuweilen grenzte sie an Brechreiz. Noch bevor Mutter ihre Straßenkleidung in Putzklamotten tauschen konnte, hatte ich die Toiletten und Badezimmer im Keller (Personal), dann die im Parterre (Gäste), dann die der oberen Etage (Hausbewohner) inspiziert. Nach einigen Monaten konnte ich die Leute am Geruch erkennen. Ich wusste, welche Frau menstruierte oder (heimlich) schwanger war, und der in den Männerklamotten hängengebliebene Schweiß sagte mir, wer am Wochenende Polo oder Tennis gespielt hatte. Nach den Gerüchen machte ich mich an die Gegenstände, nützliche Dinge wie schöne Objekte. Ich fand heraus, was neu gekauft, was ersteigert, was vererbt oder was unrechtmäßig angeeignet war. Schließlich kam ich bei den privaten Besitztümern an, der Kleidung, den Schuhen und Kopfbedeckungen, der Kosmetik, den Toilettewässern, dem Schmuck. Bald vergaß ich, wie riskant meine Stöbereien waren, so fasziniert war ich von dem scheinbar überflüssigen, immer umfangreicheren Wissen, das ich über die Bewohner und ihre regelmäßigen Gäste sammelte. Ich wusste zum Beispiel, dass die Dame des Hauses brustamputiert war. Ihre Krebserkrankung lag mehrere Jahre zurück, und sie hatte sich wohl nie dazu überwinden können, sich ein Implantat legen zu lassen. Sie schlief von ihrem Mann getrennt und hatte (offenbar seit ihrer Erkrankung) eine panische Verklemmung entwickelt, eine Abneigung gegen den eigenen Körper, als gäbe sie sich selbst die Schuld an ihrem Leid. In den Schubfächern einer kleinen französischen Kommode aus dem XVI. Jahrhundert bewahrte sie einige Dinge auf, die sie wohl in einsamen Stunden trösten sollten: Vibratoren verschiedener Größe, schlüpfrige Bücher, Schlafpillen, Amphetamine, aber auch Photographien von Leidensgenossinnen sowie Brustprothesen und Reizwäsche aller Art. Die Schubladen der Kommode waren abgeschlossen, der Mechanismus aber leicht mit einer großen stabilen Haarnadel zu knacken. Original restaurierte Antiquitäten können jenseits ihres Wertes durchaus Vorteile haben. Begriff ich damals die Trauer dieser Frau? Ich weiß es nicht. Ich glaube, selbst wenn ich sie begriffen hätte, wäre sie mir egal gewesen. Die Bewohner dieser Häuser waren Feinde für mich, und ich sammelte Material, das ich gegen sie verwenden konnte.
Der Hausherr wusste vermutlich, was ich tat, und dass meine Spionage ihm zugute kam. Eines Tages war ich unerlaubt und ohne jede Vorsichtsmaßnahme aus dem Garten gekommen, um Mutter zu suchen. Ich ging die Treppe hinauf und rief im oberen Stockwerk nach ihr. Auf Antwort wartend, verharrte ich vor einer Tür, die einen Spalt breit offen stand. Ein merkwürdiges Geräusch drang von dort in den Gang, und eine Männerstimme gebot mir, ruhig zu sein.
»Hör auf zu rufen«, zischte die Stimme, die ich als die des Hausherrn erkannte. »Bleib, wo du bist. Erst wenn ich dir sage, dass du weggehen kannst, darfst du gehen.«
Neugierig blieb ich stehen und wartete, was passieren würde. Durch den Türspalt stöhnte und wimmerte es, als sei jemand kurz vor seinem Ziel und fürchte, es nicht zu schaffen. Dazwischen schoss in regelmäßigen Intervallen die streng klingende Frage hervor, ob ich noch da sei. Als ein tiefer und, wie mir schien, erlösender Schrei dem merkwürdigen Geschehen im Zimmer ein Ende machte, kam Mutter den Flur entlang. Sie wollte eben den Mund öffnen, wohl um zu schimpfen und mich zu fragen, was ich hier täte, da sagte die erschöpfte Männerstimme hinter der Tür, ich dürfe jetzt gehen. Mutter starrte auf den Türspalt, dann auf mich.
»Stehst du noch da, kleines Fräulein? Ich hab dir doch gesagt, du kannst jetzt gehen. Aber komm wieder, hörst du? Du sollst immer wieder kommen.«
»Ficken Sie sich ins Knie.« In einem Anschwall von Mut platzte ein Satz aus mir heraus, den ich irgendwo aufgeschnappt hatte, ohne zu wissen, was er bedeutete.
Erschrocken hielt mir Mutter den Mund zu. Dann griff sie nach meiner Hand und zerrte mich weg. Weder fragte sie nach dem, was ich gesagt hatte, noch verlor sie über den Rest der Situation ein Wort. In der folgenden Woche brachte sie mich bei einer Nachbarin unter, während sie putzen ging, und als sie mich das nächste Mal mitnahm, fuhren wir statt nach Büderich in einen anderen Vorort von Düsseldorf. Das Haus mit dem stöhnenden Mann habe ich nie wieder betreten.
Im nächsten Haus begann ich mit meinen Recherchen von Neuem. Mit der Zeit gewöhnte ich mir an, Notizen zu machen und Register über die erforschten wie zu erforschenden Leute anzulegen. Photographien, die mir interessant erschienen, entwendete ich aus privaten Schubladen, in Papierkörben fand ich Rechnungen, persönliche Noten, Theaterkarten und selbstklebende Zettel. Ich erbeutete genug, um winzige Akten anzulegen. Später kamen Dinge hinzu, ein Handschuh, ein Ring, ein Füller, ein Etui … Ich hortete die Dinge nicht nur, ich lernte von ihnen und erkannte intuitiv, dass die Dinge von Menschen handeln.
Da in diesen Häusern viele Personen ein- und ausgingen und die Häuser viele Zimmer hatten, fiel nie auf, dass das eine oder andere fehlte. Und wenn es aufgefallen wäre, hätte man nicht mich verdächtigt. Die sogenannten Herrschaften übersahen mich, solange ich keine sichtbaren Katastrophen entfachte, ein Nichts zwischen kostbaren Möbeln und Gegenständen.
Als ich dreizehn oder vierzehn war – inzwischen ging ich, der Empfehlung einer Lehrerin entsprechend, der sich meine Mutter nicht hatte entziehen können, auf das Gymnasium –, trat Mutter eine neue Putzstelle an. Sie wurde eine unter vielen Angestellten eines riesigen Haushalts in einem noblen, alteingesessenen Wohnviertel zwischen Krefeld und Düsseldorf. Das protzige Anwesen lag in der Hindenburgstraße von Meererbusch. Jeder, der diese Gegend ein bisschen kennt, weiß, was diese Adresse einmal bedeutet hat. Alte Platanenalleen führten ins Herz eines stillen Terrains, das damals noch so unerbittlich gediegen war, dass Spaziergänger vom Rhein es nicht wagten, sich hier zu verlaufen. Fremde Gesichter in den Straßen wurden von Hausangestellten scham- und wortlos angestarrt, jede Neugier, als handele es sich um einen Infekt, im Keim erstickt. Hinter schmiedeeisernen Toren gab es großzügige Auffahrten durch parkähnliche Gärten zu Portalen, welche die Ausmaße von Kirchentüren hatten. Die Häuser selbst waren wirklich das, was man Villen nennt. Jahre später erst sah ich dergleichen in Dahlem wieder.
Viele Leute, die in Meererbusch wohnten, gehörten zur deutschen Hochfinanz. Sie hatten sich den Kriegsschutt von den Kleidern gebürstet und auf wunderliche Art dort weitergemacht, wo sie 1945 aufgehört hatten. Manche Familien hatten eine Menge Dreck unter ihre Teppiche gekehrt, die Mutter klopfen musste. Aber bevor sie anfing zu klopfen, hatte ich schon recherchiert.
Auch wenn mir damals die Einschlägigkeit und das Ausmaß der Informationen, die ich sammelte, nicht bewusst waren, so hatte ich doch eine außerordentliche Feinfühligkeit entwickelt, Wichtiges von Nebensächlichem zu unterscheiden. In jedem Fall war ich angestachelt von den neuen Reizen, der Ausdehnung des Terrains, seiner abscheulichen Prächtigkeit samt all dem Unbekannten, das es für mich bereithielt. Ich fühlte nur die unwiderstehliche Lust zu schnüffeln, zu sammeln und zu besitzen.
Die Dame des Hauses, in dem Mutter nun als zweite Putzfrau beschäftigt war, besaß eine bewundernswerte, bis zur Steifheit perfekte Haltung und einen überwältigenden begehbaren Kleiderschrank. Inmitten dieses so intimen wie eleganten Boudoirs stand ein Tresor in Form eines überdimensionierten Eis. Die Oberfläche war mit zerstampften, Schellack polierten Eierschalen beschichtet. Ins Innenleben führte ein geheimer Mechanismus. Einmal geknackt, ergaben sich Schubladen, Fächer und Nischen der unkontrollierten Penetration. Für mich war sowohl das Boudoir als auch der Tresor ein Mekka, und niemand ahnte auch nur, dass ich mir Zugang dorthin hatte verschaffen können.
Frau Beer selbst mochte ich nicht. Ich sollte sie Tante nennen, nicht Tante Cornelia, sondern Tante in Verbindung mit dem Nachnamen, also Tante Beer. Sie war mildtätig im schäbigen Sinn. Von Tante Beer bekam das Personal abgelegte Kleider, ausgetretene Schuhe und abgewetzte Mäntel, Pullover, an denen die Motten gefressen, Lippenstifte, die sich als Fehlkäufe erwiesen hatten. Die Frau, die in einer warmen Brühe ununterbrochener Sattheit schwamm, merkte nicht einmal, wie herablassend, wie entlarvend ihre großmütigen Gesten waren. Sie wurde zernagt vom Geiz. Auf mich machte sie den Eindruck, als hätte sie ihre Angestellten nur, weil sie Beifall brauchte. Täglich. Stündlich. Dauernd. Dazu gehörte auch die Titulierung Tante Beer. Ich weigerte mich. Frau Beer war für mich Frau Beer, oder, wenn ich wegen eines besonderen Fundes gute Laune hatte, die Gnädige Frau.
Ich ging den Hausbewohnern aus dem Weg. Ich vermied es, jemandem die Hand zu geben. Ich mochte den Leuten nicht in die Augen sehen. Ihre Fragen glitten an mir ab. Schlimmer noch als Frau Beer fand ich die Haushälterin, eine in jeder Hinsicht schwergewichtige Person, die von allen Gerda genannt wurde und sich benahm, als gehöre der ganze Laden ihr. Sie war verantwortlich für die Stimmung unter dem Personal, und die Stimmung war schlecht. Gerda kreischte, als seien ihre Stimmbänder aus Blech. Ständig und grundlos kritisierte sie die Leute, die sich gegenseitig Missgeschicke in die Schuhe zu schieben versuchten. Der einzige, der sich abseits hielt, war der Chauffeur. Ihn bekam man selten zu Gesicht, da er morgens mit Herrn Beer aufbrach und ihn erst spät am Abend wieder nach Hause brachte. Selbst der Gärtner stand unter Gerdas Fuchtel. Ich fand ihn nett, für Gerdas Augen zu offensichtlich. Wann immer ich im Garten auftauchte, schickte sie ihn for...