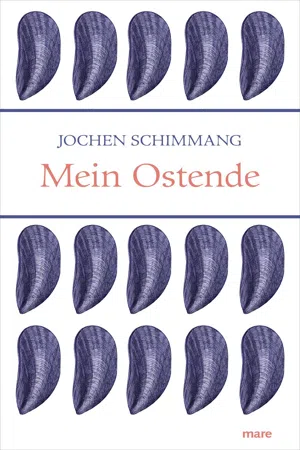![]()
PHANTASIEN IM GLÄSERNEN BUNKER (1)
Als ich vor Kurzem, auf einer Rückreise aus Südengland, zum ersten Mal mit meiner Frau in Ostende war, sagte sie: »Sei mir nicht böse, aber für mich sieht das hier aus wie Wilhelmshaven.« Überflüssig zu erwähnen – und bei allen Wilhelmshavenern vorauseilend Abbitte leistend –, dass das nicht als Kompliment gemeint war.
Zweifellos hat meine Frau irgendwie recht, obwohl sie an diesem Abend gar nicht viel von der Stadt gesehen hat, weil kurz nach unserer Ankunft ein sehr unangenehmer, kalter Dauerregen einsetzte. Niemand, der bei ästhetischem Verstand ist, könnte das heutige Ostende als eine rundum schöne Stadt bezeichnen. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Strandpromenade von prachtvollen Bauwerken gesäumt, die von damaligen Reisebroschüren als unvergleichlich gepriesen wurden. Auch in der Zwischenkriegszeit verlor Ostende nichts von seinem Glanz. Es mag sogar sein, dass nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs noch eine Zeit lang die Chance bestanden hat, die Eleganz der Stadt zu erhalten und zu transformieren, sie gewissermaßen in die Moderne zu retten. Doch schon in den Sechzigerjahren haben sich fast alle Städte an der belgischen Küste dafür entschieden, nicht mit sich selbst zu wuchern, sondern Kapital aus dem freien Blick aufs Meer zu schlagen – möglichst für alle. Zora del Buono, die 2009 die 68 Kilometer mit der Küstenstraßenbahn von Knokke bis De Panne abgefahren ist und zu Beginn ihrer Reportage über diese Fahrt ihr Entsetzen über die dort aufgetürmten architektonischen Verbrechen nicht verbirgt, kommt am Ende zu dem Schluss: »Ein jeder hat seinen Blick aufs Meer verdient, egalitäre Architektur thront vor den Gründerzeitvillen: Besser, es können tausend Menschen neben- und übereinander gestapelt das Meer genießen als nur ein Villenbesitzer mit seiner Apanage. Glückliches Belgien.«
In der Tat kann man die gläserne Skyline, die den belgischen Küstenstreifen säumt, mit viel gutem Willen als den Sieg des demokratischen Gedankens in der Architektur ansehen, was beweist, dass das demokratische Prinzip, wenn es architektonische Gestalt annimmt, durchaus brutale Ergebnisse zeitigen kann: Égalité – Fraternité – Brutalité. Ist andernorts die exzellente Aussicht das Privileg der Reichen und Schönen, etwa am Zürichsee oder am Starnberger See, so muss der Käufer oder temporäre Mieter eines Glasbunkers in einem der sechs- bis zehnstöckigen Hochhäuser an der Ostender Promenade noch keine Phantasiepreise zahlen, um jeden Morgen nach dem Aufwachen den Blick aufs offene Meer zu genießen.
Ich selbst träume seit vielen Jahren davon, für ein paar Wochen ein Appartement in einem dieser Glaskästen als Ferienwohnung zu mieten. Bisher war das nur einem Helden meiner literarischen Phantasie namens Gregor Korff vorbehalten, weil ich selbst nie länger als drei oder vier Tage hintereinander in Ostende zugebracht habe, wogegen mein Protagonist sich mehrfach über Monate im gemieteten Ferienappartement versteckte und niemand wusste, wo er war.
Sich hier wirklich zu verstecken, ist übrigens so einfach nicht. Der Bewohner eines direkt an der Promenade gelegenen Appartements setzt sich, wenn er die Sicht aufs Meer wirklich genießen will, unweigerlich selbst der Sichtbarkeit aus. Auch, wenn er nicht auf den kleinen Balkon tritt, den viele dieser Wohnungen haben, sondern an der Fensterfront seiner Behausung verharrt, ist er den Blicken der draußen Promenierenden preisgegeben. Denn die Fenster der Seeseite reichen in dieser gläsernen Treibhausarchitektur von der Decke bis zum Fußboden. Vor dem fremden Blick sind deshalb höchstens die obersten Stockwerke geschützt, bei denen die Kauf- und Mietpreise entsprechend nach oben klettern dürften. Das kennt man: Penthouse kostet extra. Wer weiter unten wohnt, kann nur sehen, wenn er zugleich gesehen wird, was ihn, stelle ich mir vor, anfangs nach der richtigen Art suchen lässt, sich zu präsentieren, nach der richtigen Haltung also. Die Bandbreite der Möglichkeiten reicht von der Scheu, fast Scham, über die eingeübte Lässigkeit und die Prahlerei bis zur demonstrativen Nichtbeachtung derjenigen dort draußen und dort unten, der Arroganz. Und natürlich kann man auch einfach die Vorhänge zuziehen.
Hier wäre eine klassische Grundsituation für den Beginn eines Kriminalfilms oder Kriminalromans gegeben, habe ich immer gedacht, etwa in der Konstruktion von Hitchcocks Rear Window, wobei vermutlich der Täter draußen zu finden wäre und der Zeuge drinnen in einem dieser Appartements und wobei noch nicht ausgemacht wäre, ob die Blicke beider sich treffen oder zunächst nur der Zeuge den oder die Täter sieht, wie in Simenons Der Mann aus London. Auf jeden Fall, so habe ich mir ausgemalt, würde diese Eingangsszene – soll man sagen: die Urszene? – entweder an einem frühen, aber strahlenden Sommermorgen stattfinden, während die Promenade noch beinahe menschenleer ist, oder aber in der frühen Abenddämmerung, der blauen Stunde. Einen solchen Kriminalroman, so habe ich weiter phantasiert, könnte man am besten in einem dieser Appartements selbst schreiben.
Das ist selbstverständlich der Kern der ganzen Phantasie: dass ich persönlich es bin, der da etwa in der zweiten oder dritten Etage überm Meer sitzt und an diesem Roman schreibt. Gemietet habe ich das Appartement für drei Monate, von Mitte Juni bis Mitte September, im Gegensatz zu meinem früheren Helden Gregor Korff, der bevorzugt das Winterhalbjahr in Ostende zubrachte. Keiner weiß, wo ich bin, niemand kommt mich überfallartig besuchen: der ausreichende Schutz, den jeder Schriftsteller braucht und verdient hat. Das Appartement ist möbliert, viel Gelb bei den Polstermöbeln, man hat sich bemüht, alles aufeinander abzustimmen, was nicht immer gelungen ist, weil die als Ergänzung gedachten hier und da verteilten Hellbrauntöne das Wohlbehagen dämpfen. Küche, kleines Bad mit Wanne, winziger Balkon, bester Blick, rechts in der Ferne die orangerot leuchtenden Metallskulpturen von Arne Quinze. Die Menschen, die ich von hier aus auf der Promenade sehe, sind entfernt genug, aber noch nicht so winzig, dass man keine Details erkennen könnte. Bald nach meiner Ankunft entdecke ich unten einen Mann Anfang dreißig, der jeden Vormittag etwa zur selben Zeit langsam die Promenade hinunterschlendert, zuweilen stehen bleibt und sich umsieht. Am vierten Tag fahre ich mit dem Lift nach unten und hefte mich an seine Fersen, in gebührendem Abstand. Er ist groß, trägt Jeans und ein weißes Hemd, hält sich sehr aufrecht und macht einen durchtrainierten Eindruck, wirkt aber nicht militärisch, sondern eher lässig. Ich folge ihm, fast stolz darauf, wie gut es mir gelingt, ihn unauffällig zu beschatten, bis er ein Restaurant am Visserskaai, Ecke Nieuwstraat betritt. Dort nimmt er nicht etwa Platz, sondern verschwindet in der Tiefe des Raumes, während ich feststelle, dass das Restaurant noch gar nicht geöffnet hat, er also entweder als Koch oder Kellner hier arbeitet. Ich entscheide mich für die erste Option. Am nächsten Tag sehe ich ihn wahrhaftig etwa zur selben Zeit und folge ihm erneut auf demselben Weg mit demselben Ziel. Der Fall ist jetzt also klar, und ich habe für meinen Roman die erste Figur. Alles andere ergibt sich schnell: die Kellnerin eines anderen Restaurants, in dem ich bald Stammgast werde und die mit dem Koch des Restaurants am Visserskaai in eine Liebesgeschichte verwickelt ist, und dann der geheimnisvolle ältere Gast, der eines Tages mit der Fähre aus Dover kommt – der Roman ist in den späten Achtzigern angesiedelt –, sich im Hotel Louisa einmietet und das Unheil mitbringt … Das Zentrum dieser Phantasie ist selbstverständlich nicht der Roman selbst, sondern die Situation des Autors, der, geschützt in seinem Appartement, daran arbeitet. Je länger diese Arbeit dauert, desto mehr entzieht er sich den Blicken. Die Vorhänge bleiben lange geschlossen, erst nach der ersten langen Phase der Arbeit am Morgen werden sie geöffnet und geben immer aufs Neue den überraschenden Blick auf eine belebte sommerliche Promenade frei, und auf einen Strand, an dem das Badeleben schon Fahrt aufgenommen hat. Erst gegen Mittag taucht der Autor selbst in das Leben der Stadt ein und geht essen, bevorzugt in einem der beiden Restaurants, in denen seine Romanfiguren arbeiten. In solchen Phasen, dazu noch an einem Ort, an dem man nur temporär zu Hause ist, ist es wichtig, ein Korsett fester Gewohnheiten zu haben, die das Nachdenken über den Alltag auf ein Minimum reduzieren. Ein kleiner Teil des Nachmittags gehört noch einmal der Arbeit, von besonders schönen Sommertagen vielleicht abgesehen, die zu einem direkten Ausflug an den Strand verlocken. Nach einem leichten und frühen Abendessen (Muscheln, Seezunge etc.) und einem anschließenden Gang über die Promenade oder über den Strand zieht unser Autor sich wieder in seinen Glaskasten zurück. Nur manchmal streift er noch später abends durch die Stadt, um etwa ein Bier im ’t botteltje oder anderswo zu trinken.
Von nun an wird unser Autor häufiger auftreten und braucht deshalb einen Namen. Ich werde ihn Gregor Korff nennen, der Einfachheit halber, weil ich mit dieser Figur schon länger vertraut umgehe und ihr endlich ein ganzes Quartal im Sommer gönnen möchte, denn immerhin hat Korff einmal behauptet, Ostende sei unter den Städten seine spröde, verhärmte Geliebte.
Eines Tages, so höre ich natürlich nicht auf zu hoffen, muss diese Phantasie, wenigstens über einen Zeitraum von vier Wochen, einer Realitätsprüfung unterzogen werden. Es versteht sich, dass sie zugleich auch ein flammendes Plädoyer dafür ist, die zahllosen Aufenthaltsstipendien, die es für uns Schriftsteller gibt und die manchen in sehr entlegene Orte unseres Landes verschlagen (nichts gegen die Ränder und versteckten Winkel!), um das dringend notwendige Ostende-Stipendium zu erweitern.
![]()
»DIE ANZAHL DER BADEGÄSTE NIMMT MIT JEDEM JAHR ZU«
Das Ostender Badeleben im Sommer ist heutzutage ein absolut demokratisches Vergnügen. Soll heißen, es ist kein Privileg der Superreichen, die, wenn sie sich an der belgischen Küste aufhalten, das nördlicher gelegene Knokke-Heist vorziehen. Schon lange ist es nicht mehr die Aristokratie, sind es nicht mehr die Kaiser und Könige, die das sommerliche Bild der Stadt prägen.
Wie diese Küsten überhaupt entdeckt wurden und das Meer sich langsam vom Inbild des bedrohlichen Chaos und der Zerstörung zu einem Element entwickelte, das unter Umständen heilende Kraft haben konnte, hat der französische Historiker Alain Corbin in seinem Klassiker Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste ausführlich beschrieben. Der Titel des 1988 erschienenen französischen Originals ist noch etwas präziser: Le territoire de vide. L’Occident et le plaisir du rivage 1750–1840, was sich wie folgt übersetzen ließe: »Das Territorium der Leere. Das Abendland und die Freude an der Küste 1750–1840«, wobei es statt der Leere auch noch die Alternativen »Territorium des Abgrunds« oder gar »des Nichts« gäbe. Denn jahrhundertelang – nach der Antike, für die die Küste ein Revier des Rückzugs, der Muße und des Gesprächs war – war das Bild vom Meer mit dem von der Sintflut und den damit einhergehenden Verwüstungen verbunden.
Es ist hier nicht der Ort, den allmählichen Wandel im Blick aufs Meer und auf die Küstenregionen im Einzelnen so nachzuzeichnen, wie Corbin es tut, aber eine etwas ausführlichere Skizze braucht es schon, damit deutlich wird, wie der heilsame Aufenthalt am Meer gleichsam erfunden und wie die Grundlage für die Entstehung der klassischen Badeorte des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts gelegt wurde.
Eine wichtige Rolle spielte dabei die (Wieder-)Entdeckung des Meeres als mögliche Heilquelle. Bis dahin dominierten die bedeutenden Thermalkurorte im Inneren der einzelnen Länder, allen voran Bath in England. Die streng ritualisierten Formen der Geselligkeit, die mit dem dortigen Aufenthalt verbunden waren, kennen wir unter anderem aus einigen Romanen Jane Austens. Der Thermalkurort war so lange den Orten an der Küste gleichsam zivilisatorisch überlegen, wie die Küste das Territorium der Leere und das Meer das Element der Zerstörung bildete. Mit der medizinischen Aufwertung des Meeres und des Aufenthalts an der Küste etwa ab der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurde die Vorherrschaft der Thermalkurorte immer mehr infrage gestellt. Zu den segensreichen Wirkungen, die von bestimmten Ärzten dem Aufenthalt am Meer zugeschrieben wurden, zählte unter anderem der Sieg über die Melancholie, oder, um es britisch zu spezifizieren, über den spleen. Das kalte, auch ein wenig erschreckende Bad im Meer, für das nach und nach genaue Vorschriften entwickelt wurden, sollte außerdem gegen Unfruchtbarkeit in der Ehe, die Pubertätsnöte junger Mädchen oder bei der Stabilisierung eines zerrütteten Nervensystems helfen. Später wurde auch die Güte der Luft ein Indikator dafür, wie heilsam der Aufenthalt in welchem Küstenabschnitt war. Während die Küsten des Mittelmeers eher mit dem Verfall, dem Fauligen und ungesunden Winden (Bora, Scirocco) assoziiert wurden, wurde der frischeren Luft der nördlichen Küsten Heilwirkung zugesprochen.
Für diese Strömung der damaligen Medizin stand vor allem der Name Richard Russell. Der 1687 geborene Arzt ging 1747 nach Brighton, um dort als Badearzt seine bis dahin entwickelten Theorien praktisch umzusetzen. Drei Jahre später veröffentlichte er seine Dissertation über den Gebrauch von Meerwasser bei Drüsenleiden, die kurz nach der lateinischen Fassung auch auf Englisch vorlag und so erste Breitenwirkung entfalten konnte. Einige Jahre danach folgte ein zweites Buch zum gleichen Thema, diesmal gleich in englischer Sprache. Unter anderem wird darin die These aufgestellt, dass Meereskuren denen in den binnenländischen Thermalbädern deutlich überlegen seien. Dass Russell insbesondere das Meer bei Brighton empfahl, wo er Grundbesitz erworben und eine Klinik errichtet hatte, versteht sich von selbst.
Der Aufstieg Brightons von einem Fischerdorf zu dem englischen Seebad des Königshauses und der Aristokratie nach Russells Tod 1759 begann mit der jahrzehntelangen Förderung des Ortes durch George IV., der schon als Prinzregent das Bad besucht hatte und ihm als König treu blieb. »Die aufmerksame Gegenwart des Prinzen, dann Prinzregenten und schließlich Königs verwandelt das Thermalbad in einen Ort der Sommerfrische und Vergnügungen«, schreibt Corbin. »Kurz, in Brighton vollzieht sich zum ersten Mal die Wende vom Therapeutischen zum Hedonistischen, ein Prozess, der im Lauf des 19. Jahrhunderts alle großen Seebäder des Kontinents charakterisiert.«
Begonnen hat er trotzdem auf der britischen Insel, weil sie auch in dieser Beziehung, um mit Marx zu sprechen, »der Demiurg des bürgerlichen Kosmos« war. Es ist zunächst die königliche Familie selbst und dann die Hocharistokratie, die sich für bestimmte Orte entscheidet und im Fall der königlichen Familie teilweise von sich aus verfügt, hier sei ein Seebad zu errichten. Sobald dieses den entsprechenden Glanz gewonnen hat, werden der Landadel und bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens angezogen. Erst später wendet sich auch das Bürgertum, in Kopie des aristokratischen Lebensstils, dem Seebad zu. Am Ende haben Brighton und Weymouth die Partie gegen Bath gewonnen. Das aus Jane Austens Romanen bekannte Personal zieht gewissermaßen vom Binnenland an die Küste. Für den Anfang aber gilt, um noch einmal Corbin zu zitieren: »Jedes Seebad braucht die Präsenz eines Mitglieds der Königsfamilie, um die vornehme Gesellschaft anzuziehen.«
Dasselbe gilt auch für den Kontinent und Ostende, nur, dass hier alles einige Jahrzehnte später stattfand. Die Rolle des führenden Thermalkurortes, die Bath in England einnahm, spielte in Belgien bekanntlich ein kleines Städtchen in den Ardennen namens Spa. In der englischen Sprache und im heutigen Wellness-Jargon ist spa, wie man weiß, das Synonym für ein Heilbad oder für entsprechende Einrichtungen in Hotels gehobener Klasse geworden. Die mineralischen Heilquellen von Spa sollen angeblich schon in römischer Zeit und später im frühen Mittelalter genutzt worden sein, zu einer Zeit also, als noch nicht einmal die Besiedlung der Insel Testerep begonnen hatte, geschweige denn, dass es dort einen Ort namens Ostende gegeben hätte. Durch kaiserlichen und hocharistokratischen Besuch geadelt, war Spa lange Zeit das maßgebliche, wenn nicht einzige Thermalbad Belgiens. Einen kaiserlichen Besuch besonderer Art gab es dort übrigens auch in der Endphase des Ersten Weltkriegs, denn von März bis November 1918 war Spa der Sitz des Hauptquartiers der Obersten Heeresleitung des Deutschen Reiches, während weiter westlich in den Schützengräben die Untertanen Seiner Majestät zu Hunderttausenden krepierten. Genützt hat das schöne Ambiente den Generalstabsplanungen nichts mehr.
Schon ab Mitte der Dreißigerjahre des neunzehnten Jahrhunderts aber erfuhr Spa eine ernsthafte Konkurrenz durch die Küste. König Leopold I. und Königin Louise-Marie, das erste Herrscherpaar des frisch aus der Opernrevolution von 1830 geborenen neuen Staates Belgien, verbrachten ab dieser Zeit »die Saison« in dem zögerlich aufstrebenden Seebad. 1837 wird dort eine Spielbank eröffnet; erst danach werden die Ostender Badeeinrichtungen auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Welche enorme Heilkraft das Meer gerade bei Ostende hat, darüber lernte das Publikum viel aus der 1845 in Frankfurt am Main erschienenen Abhandlung Das Seebad Ostende. Ein Buch für Kurgäste, von Dr. Hartwig, praktischem Arzte in Antwerpen, Mitgliede der medicinischen Gesellschaft daselbst, während der Saison in Ostende, Hôtel d’Allemagne.
Das Buch ist ganz im Geiste des Fortschritts und der Beförderung der allgemeinen Gesundheit geschrieben. Es singt eingangs das Loblied der Eisenbahn, weil durch sie »so vielen Kranken die Möglichkeiten gegeben ist, ohne bedeutende Kosten, ohne der Ermüdung einer längeren Reise ausgesetzt zu seyn, irgendeine heilsame Quelle oder eine gesündere Luft aufzusuchen! Wo früher Hunderte Badereisen machten, werden es bald Tausende können.« Da die ursprüngliche Eisenbahnverbindung von Ostende nach Lüttich nun nach »Aachen und Cöln« verlängert ist, rückt die »kleine flamändische Seestadt« mehr und mehr ins Blickfeld der Deutschen, insbesondere auch der Süddeutschen, denen sie nun näher liegt als »die Ostseebäder, (…), Norderney, Scheveningen und die französischen Seebäder«. Gelobt wird vorab die Qualität des Strandes, zu vergleichen allerhöchstens noch mit dem von Norderney. Zudem ist die Reise nach Ostende »eine der angenehmsten, die man sich denken kann«. Dass die deutschen Seebäder den Konkurrenzkampf wegen ihrer abseitigen Lage für viele Deutsche gegen das flämische Seebad langfristig verlieren werden, daran kann, so Hartwig, kein Zweifel bestehen, »wenn man einen Blick auf die Karte wirft und bedenkt, dass Cöln nur noch 16 Stunden von Ostende entfernt ist – eine Thatsache, die man vor zwanzig Jahren ohne Weiteres ins Reich der Fabel verwiesen hätte«. Die Lage der Stadt selbst sei allerdings durchaus nicht malerisch, schreibt Hartwig, flaches, baumloses Land, so weit das Auge reicht, dazu die Dünen, die das Land vom Meer trennen. Die Stadt selbst aber, über die Dünenlinie hinaus dem Meer entgegengebaut, »ist gegen die Gewalt der Wellen durch einen starken steinernen Damm beschützt«, auf dem man den »angenehmsten Spaziergang« machen kann. Dem kann bis heute nicht widersprochen werden. Da Hartwig offensichtlich den fortschrittlichen Tendenzen seiner Zeit verpflichtet ist – jetzt können nicht mehr Hunderte, sondern Tausende am Badeleben teilnehmen, siehe oben –, geht er auf die sogenannte elegante Welt und auf das Herrscherpaar, das hier den Sommer verbringt, nicht ein. Eine Ahnung davon liefert dennoch die folgende Beschreibung: »An einem Ende des Dammes steht ein eleganter Pavillon, wo sich gewöhnlich des Nachmittags die Gäste versammeln; dicht gedrängt, alle Zungen Europas redend, umlagern sie auf Stühlen und Bänken das zierliche Gebäude …« Damit ist die Internationalität, die das Seebad Ostende seit 1834 gewonnen hat (dem Jahr, da das Herrscherpaar zum ersten Mal die Sommersaison hier verbrachte), hinreichend dargestellt.
Nicht lange nach der Veröffentlichung von Hartwigs Buch, im Sommer 1846, war auch Karl Marx hier zu Gast, der bekanntlich von 1845...