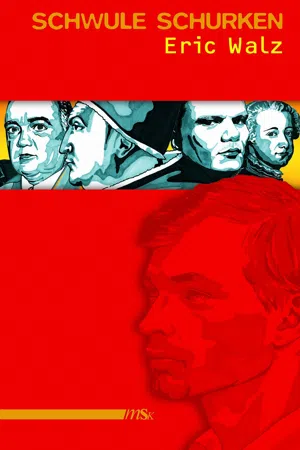![]()
MAXIMILIEN ROBESPIERRE: DER TERRORIST
(1758 – 1794)
Es gibt Menschen, die nach ihrem Tod nichts als Abscheu hinterlassen. Man kann suchen, wo man will, nirgendwo findet sich nach dem 27. Juli 1794 ein gutes Wort über Maximilien Robespierre und seinen Gefährten Antoine Saint-Just. Die entthronten Bourbonen nennen sie «Teufel», ihren Revolutionskameraden gelten sie als «Todesengel» oder «Ungeheuer», die Historiker bezeichnen sie schlicht als «Terroristen».
Und tatsächlich, wohin man diesen beiden Gestalten der Unterwelt anhand der Originaldokumente auch folgt, läuft man einer Spur von Terror hinterher, von Dogma, Gewalt und Blut. Zehntausende von Verhaftungsbefehlen tragen ihre Unterschrift, tausende von Hinrichtungsdekreten, hunderte von totalitären Gesetzen, dutzende von Entwürfen für eine straffe, lieblose Welt, in der nur die Vernunft herrschen darf. Vergeblich fahndet man nach rührenden Anekdoten, die jeden noch so brutalen Tyrannen sonst überdauern, oder nach trauernden Nachrufen, die auch der unsympathischste Politiker noch von seinem Klüngel erhält. Doch kein anerkennendes Wort, keine wehmütige Beschreibung, kein sentimentales Erinnern findet sich in den Schriften, nirgendwo verleiht ein gnädiger Zeitgenosse diesen beiden unheimlichen Gefährten ein menschliches Antlitz. Wer immer ihrer gedenkt, schüttet kübelweise Dreck über sie aus; und nur ein oder zwei Memoirenschreiber lassen sich nach großer zeitlicher Distanz herab, ihnen solche neutralen Attribute wie «rätselhaft» oder «aufrecht» zuzugestehen.
Geht man dann daran, ihre Briefe zu sichten, ihre persönlichen Notizen, ihre literarischen Hinterlassenschaften, bietet sich zunächst dasselbe Bild: Politik und Dogma, Strenge und Kälte, Vernunft und Tugend. Kein herzliches Wort für andere in ihren Briefen, kein warmer Gedanke in den Notizen.
Mit einer Ausnahme: Sobald Maximilien und Antoine einander schreiben, sobald sie miteinander reden, sobald sie ihre Zweisamkeit beschreiben, ändert sich alles. Plötzlich ist Maximilien, der Reife, verletzlich; und Antoine, der Junge und Schöne, mild. Und während man noch staunt über diese unerwartete Änderung des Tons, fällt einem dieses eine, dieses einzige Dokument wieder ein, das ein Zeuge ihres Untergangs niedergeschrieben hat, und das man fast vergessen hat, weil es nur eine knappe Momentaufnahme ist, eine Sache von Sekunden. Als schließlich alle Kräfte sich gegen Robespierre und Saint-Just verbünden, als der Konvent rebelliert und sie von rechts und links beschimpft werden, als die Verhaftung droht, alles verloren ist und nur noch Minuten sie von ihrem Ende trennen, da erinnert sich dieser Zeuge eines liebenden Blicks, den Maximilien und Antoine inmitten des Tumults um sie herum tauschen, und eines stummen Lächelns, das sie sich schenken. Schon besiegt und dem Tod gewiss, spenden sie dem anderen, dem Freund und Gefährten, Gefühl und Trost. In diesem Augenblick sind sie nur mit sich allein, mag die Welt sie auch am Kragen packen und dem Schafott entgegenschleudern.
Nirgends findet sich eine zweite, eine ebenso kuriose Freundschaft zwischen zwei Terroristen wie diese zwischen den beiden führenden Männern der französischen Revolution. Die mönchischen Inquisitoren, die Rassenfanatiker Deutschlands und die zahllosen Diktatoren des zwanzigsten Jahrhunderts in Armeeuniformen, sie alle bleiben immer mit sich allein, den Verrat, das Gift und den Dolch fürchtend. Terroristen haben keine Freunde, denn zur Freundschaft gehört Vertrauen, und wer täglich das Vertrauen Hunderttausender mit Füßen tritt, bringt seinerseits keines mehr auf. Politisch gewalttätige Menschen dulden allenfalls Bündnispartner neben sich, aber auch diese nicht für lange: Ein Che Guevara hat einem Castro ebenso weichen müssen wie ein Röhm seinem Hitler. Jeder Terrorist kennt daher jene, die ihm zu Diensten sind, aber niemanden, der sich ihm aus reinem Herzen anschmiegt, jene, die ihn achten, aber keinen, der ihm Wärme gibt. Große Terroristen kennen nur ein Licht, nämlich sich selbst, ein anderes darf nicht neben ihnen strahlen. Umso außergewöhnlicher erscheint diese fast anrührende Liebe, die auf den Trümmern des «ancien regime», der alten Monarchie entsteht. Es ist die aufrichtige Zuneigung eines kalten Herzens zu seinem Zwilling, Maximiliens zu Antoine.
Der 26. Juli 1794, vorletzter Tag im Leben Maximilien Robespierres: Maximilien Robespierre wacht auf. Schweißperlen rinnen ihm von der Stirn die knochigen Wangen hinab. Er sieht sich um, ohne den Kopf zu bewegen, nur seine Augen rollen nach rechts und links. Er ist wieder heimgekehrt aus dem Reich der schlimmen Träume, heim in seine große Stube mit dem Schreibtisch, dem voll gestopften Regal, den paar Stühlen, der kleinen Chaiselongue an der Wand und dem Cembalo gegenüber. Hier wohnt er, isst er, arbeitet er, hier träumt er schlimm, der Herr und Henker Frankreichs, der Präsident des Konvents, der Führer des Wohlfahrtsausschusses, graue Eminenz des Jakobinerklubs und kalter Verwalter einer Nation. Stumm liegt er einige Minuten da, dann taucht er ein Leintuch in die neben dem Bett bereitgestellte Waschschüssel, wringt es aus, breitet es über das Gesicht und bleibt weitere Minuten liegen.
Nervöse Störungen, nennt sein Arzt das Leiden, das Maximilien periodisch durchmachen muss. Wenn er den Arzt nach der Ursache fragt, wirft der ihm nur einen Blick zu, hinter dem Robespierre Angst erkennt, und stammelt etwas von Überarbeitung. Maximilien lächelt dann immer verächtlich. Er ist nicht überarbeitet, die Terrormaschine funktioniert von selbst, so wie jene fremdartigen Dominosteine, die er als kleines Kind vom Vater geschenkt bekam und unter dem Weihnachtsbaum ausprobierte. Er legte sie nicht mit ihren Zahlen aneinander, sondern stellte sie in immer neuen Mustern aufrecht hintereinander auf. Das war zunächst mühsam, aber war es einmal getan, brauchte er nur eine unbedeutende Bewegung mit dem Zeigefinger zu tun, und schon fielen die Steine in herrlichen Figuren um. Nein, überarbeitet ist er nicht. Würde noch einer jener Pfarrer des alten, königlichen Regimes leben und nun bei ihm sitzen, dann würde dieser es wohl schlechtes Gewissen nennen. Und stimmt es etwa nicht, dass er, Maximilien, diese nervösen Störungen immer dann hat, wenn ein großes Ereignis bevorsteht? Als die Abstimmung über die Verurteilung des Königs anstand hatte er diese Beschwerden ebenso wie vor dem Sturz der Girondisten und dem Prozess gegen Danton.
Jedoch, so einleuchtend diese Theorie auch ist, sie hat den Nachteil, dass keiner der alten Pfarrer noch lebt und sie aufstellen kann. Und daher tut Maximilien lieber so, als schließe er sich Antoines Meinung an, wie so oft. Der schöne, junge Antoine Saint-Just hat nämlich kein Gewissen und bestreitet darum, dass es eines gibt; für ihn sind Maximiliens Gebrechen nichts anderes als die Anspannung des Kriegers vor der Schlacht. Auch die kennt Antoine zwar nicht, wie er immer behauptet, aber immerhin räumt er ein, dass andere sie verspüren könnten. Armer Antoine, denkt Maximilien, seine Jugend macht ihn bisweilen arg unlogisch, aber das darf man ihm nicht sagen, denn sonst ist er verärgert, und das will Maximilien nicht. Er liebt Antoine.
Schließlich steht der nervös Gestörte doch auf. Zum einen geht es ihm nicht besser, wenn er einfach nur daliegt und grübelt, und zum anderen sieht sein Tagesplan das vor. Und an den hält er sich penibel. Aufstehen acht Uhr. Also bitte. Waschen. Maximilien taucht sein Gesicht in die Schüssel, reibt es. Er hebt den Kopf und blickt in den Spiegel. Zwar hat er den Fensterladen noch nicht geöffnet, aber er erkennt dennoch sehr gut, was er sieht. Wieder muss er lächeln, wie er einst den Arzt anlächelte. Niemand hat diesem Gesicht je zugetraut, Angst verbreiten zu können. Die Nase ist die eines Schelms, nicht eines Terroristen, sie ist spitz und schmal, durchgebogen wie eine Schanze; die hellgrauen Augen können nicht scharf blicken, nur aufmerksam; die Stirn ist nicht stark wie eine Mauer, sondern fliehend, als hätte ein dauernder Wind sie platt gedrückt. Maximilien sieht trotz seiner sechsunddreißig Jahre eher weich aus, feminin sogar. Fast wie die Mutter, meinen seine Schwestern.
Das kann Maximilien nicht beurteilen, denn seine Mutter ist gestorben, als er fünf war. Und der Vater, ein kleiner, unbedeutender Adeliger, gleich mit ihr. Zwar ist er nicht wirklich gestorben, aber er war so deprimiert über den Tod seiner lieben Frau, dass er es nicht mehr aushielt, Hals über Kopf die Familie verließ und nie wieder zurückkam. Die Kinder bedeuteten ihm wohl nichts, sonst wäre er geblieben, meint Robespierre. Dass er und seine Geschwister dann zusammen mit den Möbeln unter der Familie aufgeteilt wurden, fand er anfangs sogar spannend. Als er aber merkte, dass der Bier brauende Großvater ihn zwischen Gerstensäcken schlafen ließ und wie einen Spatz fütterte, und dass die Großmutter nur an ihm herummäkelte und ihn als Hilfskraft für ihre blöden Häkelarbeiten einsetzte, fühlte er sich gar nicht mehr glücklich.
So trist und streng wie die beiden Greise war auch die Gegend, dieser französische Nordosten, der weder das Licht der Provence noch die Sonne Burgunds kennt, weder die Heiterkeit der Loiretäler noch den Charakter der Bretagne. An die häufigen Nebel erinnert er sich und an die Tristesse der Menschen, deren Hauptbeschäftigung es tagein und tagaus war, genügend Holz für den Ofen zu sammeln. Ach, wäre er bloß in Marseille geboren worden und nicht in einer Gruft namens Arras! Dort also, im Vorhof der ewigen Starre, wuchs er auf, wurde groß, schmal und knochig, wurde engherzig und humorlos, und nichts hätte für ihn gesprochen, wenn nicht sein Adelsprädikat gewesen wäre, dieses altehrwürdige, dieses zauberhafte, glückbringende «de». Maximilien de Robespierre. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte sich wohl kaum ein Bischof der Provinz seiner erbarmt und ihm eine freie Stelle als Schüler der berühmten Pariser Schule Louis-le-Grand ermöglicht. Da hatte dieses alte, überkommene Feudalsystem mal etwas Gutes, denkt Robespierre. Aber er spricht es nicht aus, denn das wäre ja Verrat an der Idee, die er selber propagiert, und außerdem klopft der Friseur an seine Stubentür. Pünktlich um acht Uhr dreißig.
Er rasiert ihn täglich und richtet ihm die Haare, kräuselt zwei große Locken zur linken, zwei zur rechten, ganz im alten Stile. Acht Uhr fünfzig drückt Robespierre dem Barbier eine Münze in die Hand und kleidet sich an, auch im alten Stile: ein weißes, vorne gerüschtes Hemd, darüber eine rotschimmernde Weste, darüber ein blauer Gehrock mit hochgestelltem Kragen. Und unten eine elegante hellgraue Pufferhose, die bis zu den Knien reicht; darunter weiße Seidenstrümpfe und schließlich die schwarzen Schuhe, die auf dem Pariser Pflaster klacken wie Pferdehufe. Zuletzt der feierliche Hut, den mit den Federn, aber er trägt ihn zumeist nur unter dem Arm, da er sonst die Frisur zerstören könnte. Fertig. Noch einmal prüft er, ob der Kragen auch makellos weiß ist. In Ordnung. Jetzt erst fühlt Robespierre sich wohl in seiner Haut, jetzt darf der Tag beginnen.
Er öffnet den Fensterladen und lässt das Licht herein. Gleich über seinem Fenster haben Schwalben ein Nest gebaut und er beobachtet sie eine Minute. Vögel hat er immer geliebt. Unten, im Hof seines Wirtes, des wackeren Schmiedes Duplay, herrscht schon ein wenig Betriebsamkeit. Ein paar Gesellen schrauben an irgendwelchen Konstruktionen herum, es wird vermessen, gebogen, gestreckt und geschliffen, aber nicht gehämmert, nein, darauf achtet Monsieur Duplay. Kein Hämmern vor neun Uhr fünfzehn. Da nämlich öffnet Monsieur Robespierre gewöhnlich seinen Fensterladen, sieht sich um, blickt nach unten und ruft: «Madame Duplay.» Mehr braucht es nicht. Sie sitzt immer da unten, wenn Robespierre im Hause ist und achtet darauf, dass kein Unbefugter ihn in seiner Wohnung stört. Der Barbier darf durch, ein paar Jakobinerkameraden und natürlich Antoine Saint-Just, sonst niemand. Es soll Robespierre schließlich nicht ergehen wie dem armen Marat, der im Bade von einer Konterrevolutionärin erstochen wurde, in Wirklichkeit einer Adelstochter, deren Eltern unter der Guillotine starben. Einmal kam auch so eine zu Robespierre in die Rue Honoré 398, aber die schimpfte und beschimpfte nur, rief irgendwas über beschränkte Freiheit und ballte ihre Fäuste. Die robuste Madame Duplay hielt sie unsanft fest und übergab sie ohne Zögern und auf eigene Initiative dem Revolutionstribunal, das immerzu nur eine Strafe verhängt, den Tod. Nie ist einer freigesprochen worden. Anklage ist gleich Verurteilung. Auch so eine Erfindung des genialen, des wunderbaren Antoine Saint-Just.
«Madame Duplay», ruft Robespierre und weiß, dass die Getreue ihr Schälmesser samt Kartoffel auf der Stelle von sich werfen wird und sofort heraufkommt, das Tablett mit dem Spatzenfrühstück darauf. Er isst nie viel, hat es damals beim Großvater abgewöhnt bekommen und nie wieder damit angefangen. Und da ist sie auch schon, die Madame. Wenn sie ihn anblickt, dann nie wie einen Gast, auch nicht wie einen Mann, sondern ein bisschen wie einen Knaben, der immer brav ist und gerade eine gute Note mit nach Hause gebracht hat. Aber vielleicht bildet Robespierre sich das auch nur ein. Denn als er damals gute Noten schrieb, in der ehrwürdigen Louis-le-Grand, brachte er sie nirgendwohin und empfing kein gutmütiges Lächeln, sondern immer ein verächtliches – vielleicht jenes, das er heute selber benutzt. Er war eben der Ärmste unter den fünfhundert Sprösslingen der vornehmen Schule und musste jahrelang den Hochmut des Reichtums über die Armut erdulden. Feudalsystem, ungeschminkt, denn wo Kinder sind, gibt es wenig Verstellung. Sie brauchten keinen Finger zu rühren und wussten doch, dass ihnen die Karriere gewiss ist, und dass selbst die Dümmsten, Verschwenderischsten und Flegelhaftesten unter ihnen noch tausendmal größere Chancen haben, eine wohlgenährte und hochdekorierte Zukunft zu erleben als die Klügsten und Tugendhaftesten unter den Bürgerlichen.
Die einzige Möglichkeit, solchen Pubertierenden ihre Unzulänglichkeit vor Augen zu führen und sie damit ein bisschen zu ärgern, war, sie ihre Dummheit selbst spüren zu lassen. Wie kein anderer lernte Maximilien darum in diesen Jahren. Gingen die Jungen spielen, saß er in seiner Stube und lernte Latein oder Philosophie, machten die einen ein Späßchen, blieb er ernst, blickten die anderen auf ihre Lehrer herab, sah er zu ihnen auf, gönnten jene sich irre Eitelkeiten, knauserte er mit jeder Münze. Oh, wie raste sein Herz vor Stolz, als er in fast allen Fächern Primus wurde, als er Bestnoten erhielt in Geschichte, in Philosophie und Literatur, als er Gedichte schreiben konnte für ein Journal, als er als einer der Gebildetsten seines Alters von der Schule abgehen konnte, während die anderen dumm und dumpf blieben und beleidigt auf ihre Châteaus kutschierten. Oh, wie hasste er sie, diese Attrappen der Würde, wie sehr missgönnte er den Mutlosen die Lorbeeren und den Faulen das Lob. Wo in diesem Land hatte sich die Gerechtigkeit versteckt, wo das Gewissen? Robespierre glaubte es bald zu wissen: in Ermenonville.
Dort nämlich lebte Rousseau, der Autor des «Gesellschaftsvertrages». Jedes Wort seiner Werke hatte Robespierre verschlungen, jeden Satz zum Heiligtum erhoben. Eines Tages konnte Robespierre nicht mehr an sich halten, nahm die Kutsche und pilgerte zu ihm hin, dem alten Philosophen in seinem einfachen Häuschen. Der Halbwüchsige und der Greis, sie unterhielten sich eine Weile über Politik und Theorien. Natürlich freute sich der fast vergessene Rousseau, dass sich überhaupt noch jemand für seine Arbeiten interessierte, und zum Abschied klopfte er seinem Jünger vor Dankbarkeit sogar auf die Schulter. Ob der Alte wohl geahnt hat, dass er dem Tod nachwinkte, dem Beil, das eines Tages jede Silbe seiner niedergeschriebenen Ansichten rücksichtslos in die Tat umsetzen würde?
Es ist ein Tag für Wahrheiten, denkt Robespierre, während er den Rest seines Hörnchens verspeist. Man muss auch einmal neben sich treten können und alles betrachten, was man tut. Nein, natürlich hat Rousseau es nicht geahnt, denn hätte er, dann würde dieser müde, harmlose Rousseau seine Schriften genommen und dem hungrigen Kamin überantwortet haben. Oh ja, Rousseau besaß viel: Geist, Interesse, Fantasie. Nicht aber Konsequenz. Er konnte sich bis zum Schluss nicht entscheiden, ob er den Menschen das Eigentum entreißen oder belassen soll, ob er den Umsturz oder die Romantik will. Nein, man darf es ihm nicht verübeln, denn das Wort findet so selten den Mut für die Tat, stattdessen bedarf es der Vollstrecker. Mit einem Gefühl des Aufbruchs verließ das Schwert, verließ Robespierre damals seinen ahnungslosen, geistigen Befehlshaber.
Nach der Schule änderte sich erst einmal nichts. Während Robespierre als Advokat in seine Heimatstadt Arras zurückkehrte, um dort Erbschaftsangelegenheiten zu klären, Besitzfragen zu regeln und kleine Verbrecher zu verteidigen, gingen die anderen auf die Jagd, während er nachts noch über seinen Plädoyers für den nächsten Tag saß, tanzten die anderen auf den rauschenden Hofbällen in Versailles. Jahre der Bitterkeit. Und es wäre immer so weitergegangen, wenn nicht – ja, wenn nicht zu viel getanzt worden wäre, zu viel geprasst. Denn 1789 war der Staat nicht nur pleite, sondern nicht einmal mehr kreditwürdig, und der dicke und einfältige Ludwig XVI., König der Dummen und Dumpfen, berief die seit Jahrhunderten nicht mehr herbeizitierte Nationalversammlung nach Versailles ein, Vertreter des Adels, der Geistlichkeit und des Bürgertums, um über Lösungen zu beraten.
Er ahnte ja nicht, dass er sich damit die Revolution ins Haus holte – und unter anderem auch den Mann, der ihn einmal den Kopf kosten würde – Maximilien Robespierre, einen der Abgeordneten des dritten Standes, der Bürgerliche...