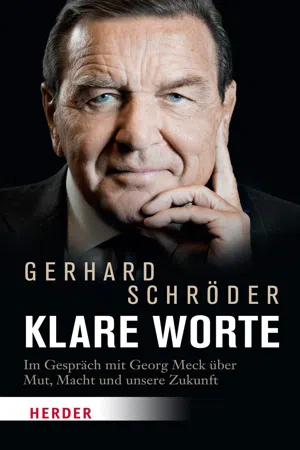![]()
KAPITEL 1
Die Agenda 2010 und der Primat der Politik
Herr Schröder, in der Reihe der sozialdemokratischen Kanzler steht Helmut Schmidt für das Effiziente, Technokratische, Willy Brandt für die Ostpolitik und „Mehr Demokratie wagen“. Was ist der bleibende Kern Ihrer Ära?
Das zu beurteilen will ich anderen überlassen. Professionelle Beobachter wissen jedenfalls zu würdigen, dass wir unser vereinigtes und damit wieder vollständig souveränes Land mit angemessenem Selbstbewusstsein auf seinen Platz in der Weltpolitik geführt haben. Und das Zweite ist die Agenda 2010, durchgesetzt gegen massive Widerstände und eine der Grundlagen dafür, dass wir besser durch die wirtschaftliche Krise von 2008/09 gekommen sind als andere Staaten in Europa. Diese beiden Handlungsfelder werden im späteren Urteil ganz sicher eine wichtige Rolle spielen. Hinzu kommt, dass Rot-Grün das Land innenpolitisch verändert hat.
Zum Beispiel?
In der Migrationsdebatte etwa. Heute spricht selbst die CDU von der Notwendigkeit der Einwanderung. All das musste hart erkämpft werden. Man durfte ja nicht mal sagen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, obwohl wir Millionen Einwanderer im Land hatten. Dabei waren und sind wir in einer Situation, in der Einwanderung objektiv notwendig ist. Dass wir sie steuern, dass wir Kriterien festlegen müssen, ist klar. Wir können nicht nur die Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen, sondern müssen uns auch um die ökonomischen und wissenschaftlichen Eliten kümmern. Wir haben damals die Greencard eingeführt, um Computerexperten ins Land zu holen, die wir dringend brauchten. Es kamen fast 20.000 Menschen. Unsere Initiative wurde im nordrhein-westfälischen Wahlkampf von der CDU mit dem platten Slogan „Kinder statt Inder“ bekämpft. Dass die Union sich heute als Integrationspartei präsentiert, zeugt von einem bemerkenswerten Sinneswandel. Er ist mindestens so spannend wie ihre Pirouette in der Atompolitik.
Was ist denn Ihrer Meinung nach die Aufgabe einer zeitgemäßen Integrationspolitik?
Zunächst einmal: Deutschland braucht Zuwanderung. Denn wir haben ein Demographieproblem, das nur mit Hilfe von Zuwanderern gelöst werden kann. Aber mehr und mehr Menschen verlassen unser Land wieder, gerade qualifizierte türkischstämmige Deutsche, die in der Türkei beste Aussichten haben, in Deutschland aber ebenso dringend benötigt werden. Zurzeit haben wir noch einen sogenannten Wanderungsüberschuss: Es bleiben mehr, als gehen. Aber das wird nicht reichen. Wissenschaftler haben errechnet, dass wir pro Jahr etwa 400.000 Zuwanderer brauchen, um unsere Wirtschaftskraft und unseren Lebensstandard halten zu können. Was ist zu tun? Erstens: Wir sollten dafür sorgen, dass sich bei uns ein entsprechendes Klima ausbreitet, das Zugewanderten das Gefühl gibt, willkommen zu sein. Wir müssen erklären: Wir sind ein Einwanderungsland. Wir brauchen die Zuwanderer nicht nur, wir wollen auch, dass sie zu uns kommen. Und wir sollten dann dafür sorgen, dass sie bleiben und nicht zurückkehren oder in andere Länder weiterwandern. Schon jetzt leben in Deutschland über sieben Millionen Menschen mit ausländischem Pass. Mehr als 16 Millionen Menschen haben einen Migrationshintergrund, ein Fünftel unserer Bevölkerung. Also stünde uns Gastfreundlichkeit gut zu Gesicht. Zweitens brauchen wir die doppelte Staatsbürgerschaft, damit niemand gezwungen ist, eine seiner Identitäten aufzugeben. Diese alte Forderung der SPD stieß bisher immer auf Ablehnung bei CDU und CSU. Es ist nun höchste Zeit, den Doppelpass einzuführen.
Einen ersten Schritt hat die Große Koalition unternommen: Zumindest Kinder, die hier geboren werden, können problemlos zwei Pässe besitzen. Das betrifft vor allem Türken, aber auch Bosnier, Serben, Russen, Afghanen. Zufrieden?
Wenn die Optionspflicht abgeschafft wird, ist dies ein wichtiger Schritt zur doppelten Staatsbürgerschaft – aber nur ein Zwischenschritt. Die Endstufe muss sein: die völlige Akzeptanz der doppelten Staatsangehörigkeit. Dass in der neuen Großen Koalition nicht gleich Nägel mit Köpfen gemacht worden sind, ist bedauerlich, aber man darf der Gegenseite, vor allem der CSU, vielleicht nicht sofort den zweiten Schritt zumuten. Die Bereitschaft muss sich ergeben. Und sie wird sich auch ergeben – aus politischen wie ökonomischen Gründen.
Die lautesten Warner vor den Gefahren einer Überfremdung sind zwei prominente Sozialdemokraten: Thilo Sarrazin und Heinz Buschkowsky, der Bezirksbürgermeister aus Berlin-Neukölln.
Das sind Positionen der Vergangenheit, mit den aktuellen Debatten in der Partei wie in der Gesellschaft haben diese Ansichten nichts zu tun. Die SPD war immer die Partei für Menschen, die an staatsbürgerliche Gleichheit und Gerechtigkeit geglaubt haben. Als Partei hat uns die Sarrazin-Debatte außerordentlich geschadet. Immer mehr Migranten haben gefragt: Warum sagt er das? Die SPD ist doch unsere Partei. Daher war es ausgesprochen klug von Sigmar Gabriel, Aydan Özoguz zur Staatsministerin für Integration zu machen – ein Novum: Zum ersten Mal ist im Bundeskabinett jemand mit Migrationshintergrund. Für die SPD ist die Berufung von Frau Özoguz eine wichtige Rochade. Sie ist sehr tüchtig, und ihre Arbeit ist für die SPD von besonderer Bedeutung, weil es noch immer so ist: Von den Menschen türkischer Herkunft, die wählen dürfen, stimmt die Mehrheit für die SPD.
Lassen Sie uns zurückkommen zur Agenda: Wie viel von dem Erfolg nehmen Sie für sich in Anspruch, dass Deutschland wiedererstarkt und allseits bewundert aus der Krise gekommen ist?
Die Agenda 2010 allein war es nicht. Drei Dinge haben wir besser gemacht als andere: Zum Ersten haben wir noch eine sehr wettbewerbsfähige Industriestruktur, die sich sehen lassen kann und die einmalig in der Welt ist. Der Anteil der Industrie an der wirtschaftlichen Leistung in Frankreich und Großbritannien liegt bei etwas über zehn Prozent, bei uns immer noch bei fast 25 Prozent. Und dann haben wir ein überlegenes System zum Aushandeln der Arbeitsbedingungen. Diese Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften funktioniert auch in der Krise. Ich habe großen Respekt davor, dass die Gewerkschaften während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und den nachfolgenden Verwerfungen gesagt haben: In Ordnung, wir akzeptieren Lohnzurückhaltung für eine gewisse Zeit, danach wollen wir unseren Anteil haben. Und der dritte Punkt waren dann unsere Strukturreformen.
Um es ein für allemal zu klären: Das Label, der Name für die Reform stammt von Ihrer Frau, richtig?
Das stimmt. Ich kam mit der Rede nach Hause und bat meine Frau, sie durchzusehen, vor allem sprachlich. Als Erstes hat sie den Titel der Rede in Angriff genommen. Sie sagte: Du brauchst einen Begriff, und den Namen muss man sich merken können. Und dann kam sie mit der Idee „Agenda 2010“. Meine Leute fanden den Vorschlag viel zu abstrakt, zu kalt und zu technokratisch. Aber meine Frau hat mich überzeugt, und sie hat recht behalten. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international wurde der Name rasch zu einem Gütesiegel. Auf die Agenda 2010 werde ich weltweit angesprochen, die kennt man in Paris, Seoul, Peking oder Washington. Jetzt diskutiert man über eine Agenda 2020 oder 2030. Das heißt, der Name war ein Glücksgriff, weit über die Kanzlerzeit hinaus.
Bevor wir über eine „Agenda 2020“ reden, mögen Sie kurz erzählen, wie es zur Agenda 2010 kam. Warum haben Sie gerade im Frühjahr 2003 die Sozialreformen angepackt?
Die Debatte über Reformen lief ja schon länger. Wir hatten eine steigende Arbeitslosigkeit, alle Welt redete von einem Reformstau und von Deutschland als dem kranken Mann Europas. Wir haben als Bundesregierung versucht, gemeinsam mit den Sozialpartnern im „Bündnis für Arbeit“ im Konsens zu Reformbeschlüssen zu kommen. Aber was hatten Arbeitgeber und Gewerkschaftsvorsitzende beizutragen? Sie kamen regelmäßig ins Kanzleramt, stellten Forderungen an die Regierung – und zwar gegensätzliche Forderungen – und erwarteten dann, dass wir ihre jeweiligen Wünsche erfüllten. Das verstanden sie unter einem Bündnis. Keiner von ihnen wollte etwas preisgeben, alle wollten ihre Interessen mit Hilfe der Regierung durchsetzen. Das haben wir uns mehr als drei Jahre angeschaut. Als sie dann immer noch blockierten, haben wir gesagt: Jetzt ist Schluss, jetzt machen wir es selber. Das war die Geburtsstunde der Agenda.
Sie haben mit der Einführung von „Hartz IV“ als Ersatz für die Sozialhilfe den Wohlfahrtsstaat umgekrempelt, den Arbeitsmarkt liberalisiert, dafür erfahren Sie heute international Lob und Respekt, daheim aber war ständig vom „Nachbessern“ die Rede.
Dieser abschätzige Gebrauch des Wortes „nachbessern“ stört mich sehr, weil er im Kern demokratiefeindlich ist: Sie müssen Politikern doch zugestehen, dass sie Fehler korrigieren. Angst haben müssen Sie vielmehr vor Regierungen, die behaupten, sie würden nie Fehler machen. Ich habe immer gesagt: Die Agenda 2010 sind nicht die Zehn Gebote. Und ich bin nicht Moses. Wenn Sie so ein komplexes Reformwerk wie die Agenda 2010 entwerfen, quasi am grünen Tisch, haben Sie eine Vorstellung, wie die Welt sich entwickelt. Wenn sich dann herausstellt, dass sich die Wirklichkeit an der Konzeption stößt, dann müssen Sie nachjustieren. Dann müssen Sie die Konzeption verändern dürfen, ohne sich anhören zu müssen: „Die bekommen ja nichts auf die Reihe.“ Das Nachbessern beinhaltet die Erkenntnis, dass man sich irren kann. Und gute Politik zeichnet sich dadurch aus, dass man auf nicht geplante und nicht planbare Auswirkungen angemessen reagiert. Das kann bei komplexen Reformvorhaben in hoch entwickelten, dynamischen Gesellschaften wie unserer ein langer, manchmal dauerhafter Prozess sein.
Was waren aus Ihrer Sicht die unerwünschten Folgen der Agenda? Was ist zu korrigieren?
Ein negativer Aspekt ist zum Beispiel, dass das Konzept der Leiharbeit missbraucht und ausgenutzt worden ist. Wenn in einigen Bereichen Dumpinglöhne gezahlt werden, dann ist es vernünftig und dient im Grunde der Absicherung des Reformprozesses, dass man über einen Mindestlohn gegensteuert. Oder wenn sich herausstellt, dass sich die Reform negativ auf Alleinerziehende auswirkt, muss man sich über Korrekturen unterhalten und die dann auch ins Werk setzen.
Für einen Mindestlohn sind inzwischen ja fast alle: Die FDP als der letzte, zumindest halbherzige Gegner ist nicht mehr im Parlament vertreten. Union und SPD haben einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde beschlossen – ungeachtet möglicher schädlicher Nebenwirkungen.
Diese Schlachten sind doch geschlagen! In der Debatte wurde lange übersehen, dass wir fast überall in Europa Mindestlöhne haben – und nicht eingetreten ist, wovor Arbeitgeber und Neoliberale immer gewarnt haben: Der Mindestlohn ist kein Arbeitsplatzvernichtungsprogramm, sondern es ist eine Frage der Gerechtigkeit, ja der Legitimation des politisch-sozialen Systems, die Menschen vor Dumpinglöhnen zu schützen. Ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro ist der Versuch, dass die Leute von ihrer Hände und Köpfe Arbeit auch leben können und der Staat nicht gezwungen wird, mickrige Löhne über das Aufstocken auszugleichen. Wenn es so ist, dass Menschen hart arbeiten – etwa in Gaststätten oder in der Fleischverarbeitung –, aber Löhne von nur vier bis fünf Euro in der Stunde bekommen und davon nicht leben können, dann ist das nicht nur ungerecht und unsozial, sondern es stellt auch die Demokratie in Frage. Das kann hier niemand wollen, und deswegen ist die Agenda als Reformwerk ein fortwährender Prozess.
Sie geben aber nicht klein bei gegenüber denen, gerade in der SPD, die das Rad am liebsten komplett zurückdrehen wollen?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Agenda hat etwas für Deutschland gebracht. Nicht zuletzt haben wir bewiesen, dass unser Land reformfähig ist. Nicht alle Strukturen sind so verkrustet, dass Reformen unmöglich sind. Das ist auch ein Erfolg der Agenda. Vielleicht mindestens so wichtig wie die einzelnen Wirkungen, die die Reformen entfaltet haben, war das dahinterstehende Menschenbild. Der wichtige Punkt ist die Philosophie: das, was wir „Fordern und Fördern“ genannt haben. „Fördern“ heißt die Menschen qualifizieren, heißt lebenslanges Lernen, heißt aber auch die Bereitschaft der staatlichen Institutionen, dann Hilfestellung zu geben, wenn der Einzelne nicht in der Lage ist, sich aus eigener Kraft zu helfen. Selbstverständlich ist ein Grundsatz von den Reformen unangetastet geblieben: Der Staat gibt in Situationen, wo Bedürftige zu jung, zu alt, krank oder arbeitslos sind, Hilfestellung für ein selbstbestimmtes Leben. Dem gegenüber steht das „Fordern“, das durch die Reformen verstärkt worden ist: Jeder Mensch muss zunächst das ihm Mögliche selber tun, bevor die Gemeinschaft hilft. Das hat nach meiner Überzeugung mit der Würde des Menschen zu tun. Es ist unwürdig und bevormundend, den Menschen zu signalisieren: Egal, ob ihr eigene Anstrengungen entfaltet oder nicht, der Staat wird schon für euch sorgen. Das geht schief, wie wir wissen. Die Politik des „Forderns und Förderns“ ist für mich immer ureigenes sozialdemokratisches Gedankengut gewesen.
Für Leute wie Sahra Wagenknecht, aber auch für Linke in Ihrer Partei haben Sie die sozialdemokratische Idee mit der Agenda auf einen neoliberalen Irrweg geführt. In einem so reichen Land muss das Vermögen nur umverteilt werden, dann ist genug für alle da, lautet deren Propaganda.
Das sind doch nur Schlagworte. Ich halte diese Kritik an der Agenda für völlig überzogen. Fehlentwicklungen müssen korrigiert werden, das Prinzip aber war richtig und es muss auch beibehalten werden. Es ist ja nicht so, dass wir weniger Herausforderungen hätten in der Zukunft. Denken Sie nur an den demographischen Wandel, die Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund, anstehende Investitionen in die Infrastruktur, den Reformbedarf im Gesundheitswesen, wo sich ein Missverhältnis zwischen Kosten und Leistung entwickelt hat.
Ärzte berichten, dass auch bei uns klammheimlich rationiert wird. Man überlegt, wie viel Zeit und Geld für welchen Patienten einzusetzen ist – was ethisch fragwürdig ist. Wie kann man das ändern?
Das ist nicht akzeptabel. Mag sein, dass in Kliniken zu viel operiert wird, das kann ich nicht beurteilen. Aber zu sagen: Wenn du zu alt bist, dann lohnt sich ein neues Hüftgelenk nicht mehr – diese Diskussion sollte man erst gar nicht aufkommen lassen. Sie ist ethisch nicht durchzuhalten. Denn wo wollen wir als Gesellschaft die Grenze ziehen, und vor allen Dingen: Wer zieht sie? Wenn der Arzt sagt: Das ist medizinisch geboten, kann doch die Krankenkasse nicht sagen: „Aber du bist zu alt, nun leb mal weiter mit den Schmerzen und der eingeschränkten Beweglichkeit.“ Das geht nicht.
Wie lange werden wir künftig arbeiten müssen? Auf jeden Fall bis 67? Oder noch länger?
Bis 67 Jahre mindestens, wahrscheinlich noch länger. Auf längere Sicht werden wir eher eine Diskussion über eine erneute Verlängerung bekommen als darüber, die Grenze wieder herabzusetzen. Die Rente mit 67 Jahren, von uns vorbereitet ...