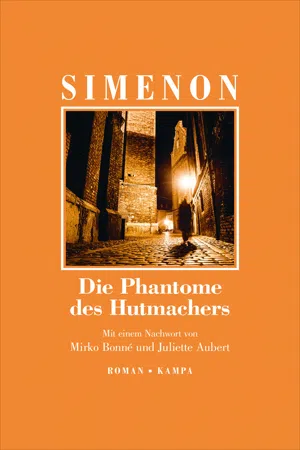
eBook - ePub
Die Phantome des Hutmachers
- 288 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Phantome des Hutmachers
Über dieses Buch
Der angesehene Hutmacher Léon Labbé und der kleine Schneider Kachoudas. Viel haben die beiden nicht gemein, auch wenn sie in der Rue du Minage, einer Geschäftsstraße in der Hafenstadt La Rochelle, dicht beieinander leben und arbeiten. Nur durch einen Zufall findet der Schneider heraus, dass es der Hutmacher ist, der seit Wochen die Stadt in Angst und Schrecken versetzt: In fünf verregneten Nächten hat er, scheinbar wahllos, fünf Frauen ermordet. Die ausgesetzte Belohnung würde dem Schneider einige Sorgen nehmen, aber er weiß, dass man ihm, dem Einwanderer, nicht glauben wird. Und während sein Schweigen ihn zum Komplizen macht, schlägt der Mörder erneut zu.Der Stoff um die komplizierte Beziehung zwischen einem Mörder und seinem Nachbarn ließ Simenon nicht los, er behandelte ihn zunächst in zwei Erzählungen und erst dann in Romanform. Die Erzählung »Der kleine Schneider und der Hutmacher«, die Simenon 1947, ein Jahr vor dem Roman, geschrieben hat, findet sich im Anhang dieser Ausgabe.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
Die Phantome des Hutmachers
1
Es war der 3. Dezember, und immer noch regnete es. Riesig, tiefschwarz, mit einer Art dickem Bauch, hob die Ziffer 3 sich vom grellen Weiß des Kalenders ab, der rechts der Kasse an der dunklen Eichenholztrennwand zwischen Laden und Schaufenster hing. Genau zwanzig Tage waren vergangen – am 13. November nämlich war es passiert, auch da so eine fettleibige 3 auf dem Kalender –, seit bei der Saint-Sauveur-Kirche, nur ein paar Schritte vom Kanal entfernt, die erste alte Frau ermordet worden war.
Ja, es regnete seit dem 13. November. Ohne Unterbrechung regnete es seit zwanzig Tagen, konnte man sagen.
Ein lang anhaltender, platternder Regen war es meistens, und wenn man durch die Stadt rannte, dicht an den Häusern entlang, hörte man in den Dachrinnen das Wasser. Man nahm die Straßen mit Arkadengängen, um wenigstens kurz geschützt zu sein, man zog andere Schuhe an, sobald man zu Hause war. In sämtlichen Hausfluren trockneten nahe dem Ofen Regenmäntel und Hüte, und wer über keine Wechselkleidung verfügte, lebte in einer beständigen klammen Feuchtigkeit.
Schon weit vor vier wurde es dunkel, und in manchen Fenstern war von früh bis spät das Licht an.
Es war vier, als wie jeden Nachmittag Monsieur Labbé aus dem Hinterzimmer seines Geschäfts getreten war, wo hölzerne Köpfe in allen Größen in den Regalen standen. Er war die Wendeltreppe hinaufgestiegen, die ganz hinten in der Hutmacherei nach oben führte. Auf dem Treppenabsatz hatte er kurz innegehalten, einen Schlüssel aus der Tasche gezogen und die Tür des Schlafzimmers aufgeschlossen, um sogleich Licht darin anzumachen.
Ehe er den Schalter umgedreht hatte, war er da bis zum Fenster gegangen, an dem die dicken, verstaubten Spitzenvorhänge immer zugezogen waren? Wahrscheinlich, denn bevor er Licht machte, ließ er für gewöhnlich das Rollo herunter. In diesem Moment hatte er drüben, nur ein paar Meter weiter, Kachoudas, den Schneider, in dessen Atelier sehen können. Es war so nah, zwischen ihnen der Straßengraben so schmal, dass es einem vorkam, als wohnte man im selben Haus.
Kachoudas’ Atelier lag im ersten Stock über seinem Laden und hatte keine Vorhänge. Die kleinsten Details des Zimmers zeichneten sich ab wie auf einem Kupferstich – die Blumen der Tapete, der Fliegendreck auf dem Spiegel, das flache und fettige Kreidestück, das an einer Schnur hing, die an einer Wand befestigten Schnittmuster aus braunem Papier, und Kachoudas, der auf seinem Tisch saß, im Schneidersitz, in Reichweite eine schirmlose Glühbirne, die er mithilfe eines Stücks Draht zu sich heranzog. Die Tür im Hintergrund, die in die Küche führte, stand immer etwas offen, wenn auch meistens nicht so weit, dass man das Innere des Zimmers hätte sehen können. Die Anwesenheit von Madame Kachoudas erriet man trotzdem, denn ab und zu bewegten sich die Lippen ihres Ehemannes. Während der Arbeit redeten sie miteinander, von Zimmer zu Zimmer.
Geredet hatte Monsieur Labbé auch. Valentin, sein Gehilfe, der sich im Laden aufhielt, hatte über seinem Kopf Schritte und Stimmengemurmel gehört. Daraufhin hatte er den Hutmacher wieder nach unten kommen sehen, erst die elegant beschuhten Füße, die Hose, das Jackett, schließlich das ein bisschen schlaffe, stets ernste, nie aber übertrieben strenge Gesicht, das Gesicht eines Mannes, der sich selbst genügt, der nicht das Bedürfnis empfindet, sein Innenleben nach außen zu kehren.
Bevor er an diesem Tag aus dem Haus ging, hatte Monsieur Labbé noch zwei Hüte über Dampf in Form gezogen, darunter den grauen Hut des Bürgermeisters, und in dieser Zeit war auf der Straße der Regen zu hören gewesen, das Wasser, wie es das Fallrohr hinunterbrauste, und im Laden das sachte Gezischel des Gasofens.
Immer war es dort zu warm. Kaum dass Valentin, der Gehilfe, morgens kam, stieg ihm das Blut in den Kopf, und nachmittags, da wurde ihm der Kopf schwer; mitunter sah er dann seine wie vor Fieber blitzenden Augen in den zwischen den Regalen befestigten Spiegeln.
Monsieur Labbé redete nicht mehr als an den anderen Tagen. Er konnte Stunden mit seinem Angestellten verbringen, ohne etwas zu sagen.
Sonst hörte man rings um sie her nur das Geräusch des Uhrpendels und jede Viertelstunde ein Klicken. Zu vollen und halben Stunden wurde der Mechanismus zwar ausgelöst, blieb jedoch nach einer vergeblichen Anstrengung abrupt stehen – die Uhr hatte vermutlich noch immer ein Schlagwerk, das aber kaputtgegangen war.
Wenn der kleine Schneider auch nicht in das Zimmer im ersten Stock sehen konnte – am Tag wegen der Vorhänge, am Abend wegen des Rollos –, so brauchte er sich doch nur vorzubeugen, um einen Blick in das Hutgeschäft zu werfen.
Natürlich lugte er herüber. Monsieur Labbé gab sich zwar keine Mühe, es nachzuprüfen, trotzdem wusste er es. Darum änderte er auch nichts an seinem Zeitplan. Seine Bewegungen blieben bedächtig, akribisch. Er hatte sehr schöne, etwas speckige Hände, die ganz erstaunlich weiß waren.
Fünf Minuten vor fünf war er aus dem Zimmer hinter dem Laden gekommen, das man »die Werkstatt« nannte, wo er erst die Lampe ausgemacht und daraufhin eine seiner ritualisierten Phrasen von sich gegeben hatte:
»Werde mal nachsehen, ob Madame Labbé nicht etwas braucht.«
Von Neuem war er die Wendeltreppe hinaufgestiegen. Valentin hatte seine Schritte über sich gehört, ein gedämpftes Stimmengemurmel, dann wieder die Füße gesehen, die Beine, den ganzen Körper.
Hinten hatte Monsieur Labbé die Tür zur Küche aufgemacht und zu Louise gesagt:
»Werde früh nach Haus kommen. Valentin schließt den Laden ab.«
Dieselben Worte sagte er jeden Tag, und das Hausmädchen antwortete:
»Ist gut, Monsieur.«
Während er seinen dicken schwarzen Mantel überzog, sagte er noch einmal, jetzt zu Valentin, auch wenn der es sehr wohl gehört hatte:
»Sie schließen den Laden ab.«
»Ja, Monsieur. Guten Abend, Monsieur.«
»Guten Abend, Valentin.«
Er nahm das Geld aus der Kassenschublade und wartete noch etwas ab, indem er die Fenster gegenüber nicht aus den Augen ließ. Kein Zweifel, Kachoudas war erst vor Kurzem von seinem Tisch geklettert, in dem Moment nämlich, als er Labbés Schatten über das Rollo im ersten Stock hatte huschen sehen.
Was sagte er zu seiner Frau? Denn er sagte etwas zu ihr. Er brauchte eine Ausrede. Sie fragte ihn nichts. Nie hätte sie sich erlaubt, ihm gegenüber eine Bemerkung zu machen. Schon seit Jahren, ungefähr seit er sich selbstständig gemacht hatte, ging er nachmittags gegen fünf im Café des Colonnes ein oder zwei Gläser Weißwein trinken. Auch Monsieur Labbé ging dorthin, und noch andere, die sich nicht mit Weißwein und auch nicht mit nur zwei Gläsern zufriedengaben. Für die meisten ging dort der Tag zu Ende. Kachoudas dagegen aß, sobald er heimgekommen war, rasch einen Happen inmitten seiner Rasselbande und kletterte daraufhin von Neuem auf seinen Tisch, auf dem er oft bis elf oder Mitternacht saß und arbeitete.
»Ich werd ein bissel an die frische Luft gehen.«
Er hatte große Angst, Monsieur Labbé zu verpassen. Der hatte das begriffen. So war es zwar nicht schon seit der ersten ermordeten alten Frau, aber seit der dritten, also seit die Stadt ernstlich durchzudrehen begann.
Die Rue du Minage war zu dieser Stunde fast immer menschenleer, zumal wenn es so in Strömen regnete. Ja sie war sogar noch leerer, seit es jede Menge Leute vermieden, nach Einbruch der Dunkelheit noch aus dem Haus zu gehen. Die Geschäftsleute, die als Erste unter der Panik zu leiden gehabt hatten, waren auch die Ersten gewesen, die Patrouillen organisierten. War es diesen jedoch gelungen, Madame Geoffroy-Lamberts Tod zu verhindern oder den von Madame Léonide Proux, der Hebamme aus Fétilly?
Der kleine Schneider hatte Angst, Monsieur Labbé aber bereitete es ein boshaftes Vergnügen, auf ihn zu warten, auch wenn nichts danach aussah – war das nicht ein teuflisches Vergnügen?
Er öffnete schließlich die Eingangstür und ließ dadurch deren Glöckchen ertönen. Er schlüpfte unter dem riesigen Zylinderhut aus rotem Blech hindurch, der ihm als Ladenschild diente, schlug den Mantelkragen hoch, versenkte die Hände in die Taschen. An Kachoudas’ Tür gab es ebenfalls eine Glocke, und schon nach wenigen Schritten auf dem Trottoir war sich Monsieur Labbé sicher, sie zu hören.
Es war eine Straße mit Arkadengängen, so wie die meisten alten Straßen von La Rochelle. Es regnete also nicht auf die Trottoirs. Sie waren wie kalte, feuchte Tunnel, wo es nur ab und an Licht gab, mit Toreinfahrten, die in die Dunkelheit führten.
Auf dem Weg zur Place d’Armes richtete Kachoudas sein Schritttempo nach dem des Hutmachers, hatte aber trotz allem eine solche Angst vor einem Hinterhalt, dass er lieber mitten auf der Straße und durch den Regen lief.
Bis zur Ecke begegneten sie niemandem. Dann kamen die Schaufenster der Parfümerie, der Apotheke, des Hemdengeschäfts und schließlich die breiten Glasfenster des Cafés. Jeantet, der junge Journalist, mit seinen langen Haaren, seinem hageren Gesicht, seinen glühenden Augen war auf seinem Posten, am ersten Tisch, dicht beim Fenster, gerade dabei, vor einer Tasse Kaffee seinen Artikel zu schreiben.
Monsieur Labbé lächelte nicht, schien ihn überhaupt nicht zu sehen. Er hörte die Schritte des kleinen Schneiders, wie sie näher kamen. Er drehte den Türknauf, betrat die wohlige Wärme, ging ohne Zögern hinüber zu den mittleren Tischen nah am Ofen zwischen den Säulen und blieb stehen hinter den Kartenspielern, während der Kellner, Gabriel, ihm den Mantel und den Hut abnahm.
»Wie geht es dir, Léon?«
»Nicht übel.«
Sie kannten einander schon zu lange – zumeist seit der Schule –, um noch Lust zu haben, miteinander zu reden. Diejenigen, die Karten in der Hand hielten, machten ein kleines Zeichen oder berührten mechanisch die Hand des Neuankömmlings. Gabriel fragte aus reiner Gewohnheit:
»Wie immer?«
Und mit einem behaglichen Seufzer nahm der Hutmacher hinter einem der Bridge-Spieler Platz, Doktor Chantreau, den er Paul nannte. Mit nur einem Blick hatte er gesehen, wie die Partie stand. Sie dauerte schon seit Jahren und Jahren, hätte man meinen können, weil sie jeden Tag zur gleichen Stunde am gleichen Tisch mit den gleichen Getränken vor den gleichen Spielern mit den gleichen Pfeifen und den gleichen Zigarren fortgesetzt wurde.
Die Zentralheizung war wohl nicht kräftig genug, da Oscar, der Wirt, den großen, schönen, leuchtend schwarzen Ofen behalten hatte, dem Monsieur Labbé die Beine entgegenstreckte, um seine Schuhe und Hosenumschläge zu trocknen. Der kleine Schneider war mittlerweile hereingekommen, war ebenso zu den mittleren Tischen gegangen, wenn auch nicht mit der gleichen Sicherheit, hatte respektvoll gegrüßt, ohne dass ihm jemand geantwortet hätte, und auf einem Stuhl Platz genommen.
Er gehörte nicht dazu. Weder war er auf denselben Schulen noch in denselben Kasernen gewesen. Zu der Zeit, als die Kartenspieler einander bereits geduzt hatten, lebte er noch Gott weiß wo im Nahen Osten, wo Leute von seiner Sorte wie Vieh umhertransportiert wurden, von Armenien nach Smyrna, von Smyrna nach Syrien, nach Griechenland oder sonstwo.
Vor ein paar Jahren hatte er anfangs noch ein Stück abseits Platz genommen, um seinen Weißwein zu trinken, und folgte dem Spiel, das ihm wahrscheinlich völlig fremd war, derart aufmerksam, dass seine Stirn sich in Falten legte. Unmerklich war er von da an näher gekommen, indem er zunächst den Stuhl heranschob, dann einfach den Sitzplatz und schließlich den Tisch wechselte, um sich direkt hinter den Spielern wiederzufinden.
Keiner redete von den alten Frauen, so wenig wie von dem Grauen, das in der Stadt herrschte. Man diskutierte womöglich an anderen Tischen darüber, nicht aber an diesem. Laude, der Senator, nahm die Pfeife vom Mund, um zu fragen, indem er sich kaum merklich zu dem Hutmacher wandte:
»Deine Frau?«
»Immer dasselbe.«
Eine Angewohnheit, die die Leute schon seit fünfzehn Jahren hatten. Gabriel hatte ihm seinen Grenadine-Picon gebracht, dunkel mahagonibraun war er, und er trank einen Schluck davon, langsam, während er einen Blick auf den jungen Jeantet warf, der dabei war, seinen Artikel für den Echo des Charentes zusammenzuschmieren. Eine Pendeluhr mit in Kupfer eingefasstem Zifferblatt hing zwischen dem eigentlichen Café und dem hinteren Teil, in dem in einer Reihe die Billardtische standen. Sie zeigte Viertel nach fünf, als Julien Lambert, ein Versicherungsmensch, der wie üblich verlor, den Hutmacher fragte:
»Machst du für mich weiter?«
»Heut Abend nicht.«
Was nichts Außergewöhnliches war. Sie waren sechs oder sieben, die mal die Karten in der Hand hielten, mal hinter den Spielern saßen. Einzig Kachoudas wurde nie gefragt, ob er mitspielen wolle, und wahrscheinlich war er auch gar nicht erpicht darauf.
Er war klein, schwächlich. Er roch schlecht, und er wusste das – er wusste es so gut, dass er es vermied, den anderen zu nahe zu kommen. Es war ein G...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Bandnummer
- Titelseite
- Die Phantome des Hutmachers
- Der kleine Schneider und der Hutmacher
- Nachwort
- Impressum
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Die Phantome des Hutmachers von Georges Simenon, Mirko Bonné, Juliette Aubert, Mirko Bonné,Juliette Aubert im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Altertumswissenschaften. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.