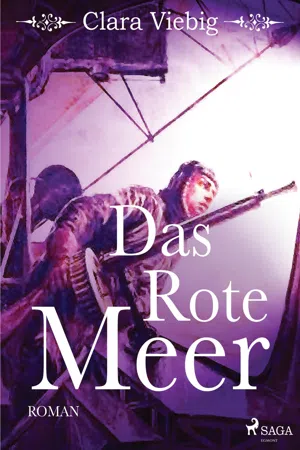III
Sie hatten Rudolf heimbekommen. Seine junge Frau ging nun in Schwarz; ihr Witwenschleier wehte lang, auf dem vollen Haar sass der Schnebbenhut mit dem weissen Vorstoss. Annemaries rundes Gesicht war schmaler geworden; erst hatte sie kaum essen mögen, überhaupt nichts sehen noch hören wollen. So jung noch und schon Witwe! Sie hatte ganz vergessen, was sie und Rudolf in ihrer ersten Verliebtheit sich anscheinend völlig klar gemacht hatten, was sie ihrer Mutter auf deren banges: ‚Wenn er nun fällt?‘ geantwortet hatte: „Wenn ich ihn nur habe, nur ein einziges Jahr!“ So schwer hatte sie sich das Witwesein doch nicht gedacht. Das Leben schien auf einmal aus.
Aber nun waren die ersten schwersten Wochen überstanden. Noch führte ihr täglicher Spaziergang zum Kirchhof. Es trieben schon vereinzelte gelbe Blätter über den Hügel, den man, bevor ein Grabstein gesetzt werden konnte, mit einem Kreuz aus Holz goziert, mit Tannenreisig gedeckt und mit immer neuen frischen Blumen umstellt hatte. Sie fand ein gewisses Genügen daran, da zu ordnen und zu schmücken. „Da liegt dein armer Papa,“ sagte sie zu dem kleinen Jungen, der sie nicht verstand und ungeduldig an ihrer Hand zappelte.
„Warst du auch so lange unglücklich?“ fragte Annemarie ihre Freundin Lili.
Lili errötete und dann erblasste sie. War sie wirklich lange unglücklich gewesen? Lange genug? Das quälte sie. Auf Stunden, in denen sie voll liebender Sehnsucht an Heinz dachte, in denen ihr Herz in einer seligen Glückshoffnung klopfte, folgten andere Stunden. War sie nicht auch selig gewesen an dem Tage, der sie mit jenem anderen — ihrem ersten Mann — vereinigte? Sie hatte geglaubt, ihn für immer zu lieben — und nun? Nein, Heinz sollte noch nicht fragen, er durfte noch nicht fragen! Noch nicht. Wenn er fragte, was sollte sie antworten? Es war etwas in ihr wie heisses Begehren und zugleich wie verzweifelte Abwehr. Noch immer war es zu früh, es durfte noch immer nicht sein.
Zur Beisetzung seines Bruders war Heinz Bertholdi gekommen, aber nur für den einen Tag. Es war fast so, als hätten sie sich nicht gesehen. Sie standen sich am Sarge gegenüber, tief erschüttert. Wäre es nicht Roheit gewesen, an eigenes Glück zu denken? Er blickte mit einem steinernen Gesicht vor sich hin, die Augen immer starr auf die Erde gerichtet, vor ihm schluchzte die junge Witwe am Arm des Schwiegervaters, auf seinen Arm stützte sich die arme Mutter. Lili hatte gar nicht gewagt, zu ihm hinzusehen, beharrlich blieben ihre Lider gesenkt. Nur als sie herantrat, um in die offene Gruft ihre drei Handvoll Erde zu streuen, noch immer mit gesenkten Lidern, fühlte sie es plötzlich: sie stand hinter ihm. Er wandte sich, trat zur Seite, liess sie heran. Und da sahen sie sich an. Rasch, wie verstohlen. In seinem Blick war bei allem Leid das Aufleuchten des Glücks, sie zu sehen, und eine innige Bitte. Er hatte sich dann über ihre Hand gebeugt, sie geküsst. Ob sie etwas gemurmelt hatte von Beileid, von innigstem Mitgefühl, das wusste sie nicht. Gesprochen hatte sie ihn nicht mehr; am Morgen war er gekommen, am Abend war er schon wieder fort. Sie war zurückgeblieben mit dem peinigenden Gefühl: was hast du versäumt! Und doch mit der Gewissheit: du konntest nicht anders.
Der Tod Rudolf Bertholdis hatte Lili tief erschüttert. Alles, was sie überwunden gewähnt, lebte wieder auf. Von dem kalten Entsetzen, das sie gelähmt, als die Trauerbotschaft eingetroffen, mitten im lustigen Spiel, blieb ihr ein Rest. Es kamen Stunden, die alle Gedanken an Glück wegfegten. Tot, tot — wer sagte ihr, dass nicht auch Heinz bald dem Bruder folgte? Jetzt war nicht die Zeit des Hoffens, jetzt war die Zeit des Entsagens. Aus seinem Grab am Monte Piano, in dem er ruhig geschlafen hatte, von Alpengrün bedeckt, stieg der tote Leutnant Rossi und suchte seine Witwe heim. Nachts trat er an ihr Bett, sprach Worte der Liebe und — Worte der Drohung. Sie warf sich rastlos hin und her, wand sich wie in körperlichen Qualen, und schlief sie endlich ein, träumte sie so lebhaft von ihm, dass sie, vom eigenen Schrei erschreckt, wieder erwachte. — —
Unten schalt Lilis Hauswirtin, die Witwe Krüger: was gab die Frau Leutnant da oben denn an? Die weckte ihr noch den Jungen auf.
Des kleinen Gustav Bett stand neben dem Bett der Grossmutter. Der tat es so gut, seinen Atemzügen lauschen zu können. Wie ruhig das Kind schlief! Sie selber schlief nur wenig. Es ging ihr wie unendlich vielen anderen. Ruhig schlafen? Wer konnte das jetzt?! Die, die einen draussen hatten, bangten um den, und den anderen war es auch bang genug.
Jetzt, in diesen grauen Wintertagen, auf toter, kalter Erde, schien die Welt ganz freudenarm, die Zeit trostlos. Sollte auch das Jahr 1918 herankommen und noch immer kein Friede sein? Es ballte sich heimlich manche Faust — ‚Herrlichen Zeiten führe ich euch entgegen‘ — ei, schöne, herrliche Zeiten! Den ganzen vergangenen Winter hatte man Kohlrüben fressen müssen, immer Kohlrüben; Kartoffeln gab’s nicht. Mittags Kohlrüben, abends Kohlrüben, morgens Kohlrüben wieder aufgewärmt; Kohlrübensuppe, Kohlrübengemüse, Kohlrübenmarmelade, Kohlrüben im Brot. Man wurde den Kohlrübengeschmack überhaupt nicht mehr los. Diesen Winter würde es Kartoffeln geben, dafür aber gar kein Gemüse. Der heisse Sommer hatte alles verbrannt. Keinen Kopf Kohl, kein Pfund Spinat, kein Bündchen Zwiebeln. Kartoffeln, nur Kartoffeln; ohne Fleisch und Fett würgen sie in der Kehle. Fett! Wer hatte wohl Fett gesehen?! So wenig Fett man selber am Leibe hatte, so wenig schien auch das Vieh zu haben. Das Viertelpfund Fleisch, das man pro Kopf zweimal die Woche bekam, war zäh wie Sohlenleder. Es gab nichts Fettes mehr auf der Welt. Ha, nur einmal wieder eine Schnitte Brot essen können mit Butter bestrichen oder mit Schmalz! Und womit sollte man kochen? Das Kleckschen Butter, das jeder auf seine Karte bekam, war so gut wie gar nichts, und das bisschen Margarine stank. Nach Fischtran, nach Petroleum, nach alten Knochen. — — —
„Geh man einholen,“ sagte Frau Müller, bei der die Dombrowskischen Kinder in Pflege waren, zu der kleinen Minna. „Ich kann heut nich selber gehn. Brot-, Fett-, Kartoffel- und da de Lebensmittelkarte. Auf die haste Heringe zu kriegen; wir sind unsre drei, also ein und einen halben. Pass auf, dass du de Karten nich verlierst. Verlierste se, kriegste Dresche. Un du weisst, denn haben wer bis nächste Woche kein Brot, keine Kartoffeln, jar nischt. Denn musste verhungern.“
Mit dem Gefühl ungeheurer Wichtigkeit verliess Minna die Stube. Sie wohnten zu ebener Erde hinten heraus, nun tänzelte sie über den Hof. Das war doch zu schön, dass sie einmal einholen durfte, und so alleine! Der Erich würde staunen, wenn er aus der Schule kam. Zierlich ihr kurzes Röckchen hinten noch kürzer raffend, wie sie’s bei den Damen gesehen hatte, trippelte sie über die Strasse.
Die Strasse war schmutzig, Herbstgüsse hatten den Boden erweicht. Sie wurde auch jetzt längst nicht mehr alle Tage gefegt; die Strassenreiniger waren im Krieg, nur die alten, durch ein langes Leben Ermüdeten und zu fördernder Arbeit nicht mehr Tauglichen, waren zurückgeblieben. Kot, Papier, Überreste, was lag, das lag. Durch die Regenlachen waren viele Füsse gepatscht und hatten Brei gerührt, ein paar Pferde waren durchgetrappelt; sie hatten ihre Äpfel fallen lassen.
Im offenen Körbchen, das Minna am Arme trug, lagen die gelbe, die grüne, die weisse und die rosa Karte. Sie warf ab und zu einen besorgten Blick darauf: alle noch da. Nun war sie bald am Konsumverein. Ach, vielleicht kriegte sie da einen Bonbon zu! Der Erich hatte neulich mal einen gekriegt. Ihre kleine Nase schnupperte, sie leckte sich über die Lippen. Da gab es Bonbons, die färbten die Zunge rot; welche waren auch so hart, dass man sie nicht durchbeissen konnte, und welche schmeckten nach Farbe, aber es gab auch welche, die schmeckten schön süss. Vor ihrer Phantasie gaukelten die Bonbons, die die Mutter ihr in den Mund gesteckt hatte, ehe der garstige Krieg war. Sie hatte lange nichts Süsses gegessen; den Zucker, den man für den Monat bekam, den brauchte die Müllern zum Kochen und tat ihn sich auch in den Kaffee.
Minna stand in Sehnsucht versunken, ihr Körbchen am Arm.
Ein Bollerwagen kam angerasselt, der Schmutz spritzte nach allen Seiten. Der Kutscher, ein halbwüchsiger Bengel, peitschte unvernünftig auf die Pferde, die Hufe schlugen das Pflaster, dass Funken sprühten, Fässer und Kisten hopsten und polterten, — da, ein Fass kollerte vom Wagen. Krach. Das Fass war morsch, es zerbrach, der Inhalt floss auf die Strasse.
Wo kamen nur so schnell auf einmal alle die Kinder her? Und auch die Erwachsenen? Das war ja Sirup, köstlicher Sirup! Wo Wasserlachen zwischen dem holprigen Pflaster gestanden hatten, standen jetzt Siruplachen. Was machte es, dass Füsse gegangen, Wagen gefahren und Pferdeäpfel gefallen waren! Ein Junge kniete nieder, ein anderer stiess ihn weg: „Lass mir ooch mal!“ Bald war ein Gebalge im Gange, die Kinder stritten sich. Und während die Kleinen noch zankten, waren die Grossen schon am Werk. Geschäftige Hausfrauen schöpften mit Löffeln in Töpfe und Krüge. Zum Backen war’s noch ganz schön, und auch wenn man’s den Kindern aufs Brot strich; die assen noch ganz was anderes. Ein Alter besann sich nicht lange, Löffel und Topf hatte er nicht, er schöpfte, sich stöhnend bückend, mit seiner Mütze, der alten Soldatenmütze, die der Enkelsohn auf den Grossvater vererbt.
Minna war zur Seite gestossen worden, die Jungen waren stärker; nun hatte sie aber doch ein Plätzchen erwischt. Sie leckte und schleckte: oh, so schön süss! Ihr Mund war rundum beschmiert und verbreitert bis an die Ohren, ihre Nasenspitze braun, ihre Schürze zeigte vorn eine Traufe. Die blonden Haare hingen ihr tief ins Gesicht, als sie, auf den Hacken kauernd, sich noch tiefer bückte. Sie war heiss und rot — oh, plötzlich war’s alle! Wie sie auch tunkte, nichts mehr, nichts als das nackte Pflaster.
Wie aus einem Traum erwachend, stand Minna auf. Ihr Kleid war schmutzig geworden, ganz nass war’s, bis durch auf die Knie. Sie bekam plötzlich Angst: die Müllern würde schimpfen. Und nun fasste sie nach ihrem Körbchen; es war ihr längst vom Arm geglitten. Das Körbchen war noch da, umgestürzt lag’s auf der Seite, aber die Karten, die grüne, die gelbe, die weisse, die rosa, die waren weg. ‚Wenn du se verlierst, denn musste verhungern —‘ „Mutter, Mutter!“ Minna erhob ein lautes Geschrei.
Warum weinte die Kleine denn so? Die Karten verloren? „Tröste dir man, Kleene,“ sagte eine Frau, deren hohlwangigem Gesicht der Jammer der Zeit seinen ganz besonderen Stempel aufgeprägt hatte: Verbissenheit, Trotz, Verzweiflung, stumpfe Ergebung. „Is ja janz ejal, ob du eene Woche früher verhungerst oder eene später. Krepieren duhn wer doch alle!“
Im Anzeiger wurde die Geschichte vom heruntergestürzten und aufgeschleckten Sirupfass humoristisch wiedergegeben — war das nicht sehr komisch? Aber Hermine von Voigt lachte nicht mit. So traurig waren die Ernährungsverhältnisse schon? Ein unheimliches Gefühl überkroch sie: was sollte werden, wenn der Krieg nun noch länger dauerte? Ihr Mann schrieb, ein Ende sei nicht abzusehen. Was auch die Zeitungen posaunten von hoffnungsvollen Aussichten, vom Frieden, den man sich so heiss ersehnte, auf den man hoffte wie auf eine Seligkeit, ach, und den man so nötig hatte, ja, bitter nötig — man brauchte nur die Augen offen zu haben — vom Frieden redeten sie nicht mehr. Über beispiellose Siege in Italien wurde freilich gejubelt, an eine zugespitzte kritische Lage zwischen Japan und Amerika allerlei günstige Kombinationen geknüpft, über die vergeblichen Anläufe der Engländer in Flandern und die unbesiegliche Abwehrkraft der Deutschen viele Worte gemacht. Der Waffenstillstand an der Ostfront hatte dem Zweifrontenkrieg ein Ende gemacht, alle ihre Kraft konnte die geniale Heeresleitung nun dem Westen zuwenden; die U-Boote fegten den Ozean rein, und doch noch kein Ende.
‚Zur Jahreswende 17!‘ Mit ernstem Blick sah Hermine von Voigt auf das Zeitungsblatt in ihrem Schoss. Wiederum eine Jahreswende! Ein kalter Schauer überlief sie. Und doch war es um sie warm und behaglich.
Es war etwas Altmodisches in diesen Räumen, etwas von Eltern und Grosseltern Überkommenes. Vielleicht waren sie gerade darum schön. Der freihängende Pendel der goldenen Pendule auf dem Kaminsims schwang sich so emsig, wie er vor hundert und mehr Jahren sich für die Familie geschwungen hatte; noch immer war die zarte Glasglocke, die sich über die kostbare Uhr stülpte, die gleiche, mit sorgsamer Hand hatte die jeweilige Besitzerin sie selber abgestäubt, nie hatten rauhe Dienstbotenfinger daran rühren dürfen. Ahnenbilder in breiten goldenen Rahmen sahen von den Wänden herab auf den runden Tisch, das Plüschsofa und die hochbeinigen Sessel. Der klug blickende Herr im hellblauen Frack, dem die weissen Haare lang auf den Kragen fielen, und die blonde Frau im tiefausgeschnittenen, hochgegürteten Seidenkleid, die den schmalen roten Schal anmutig um die weissen Schultern trug, hatten einst aus jenen zarten goldgeränderten Tassen getrunken, die die Generalin wie einen Schatz hinter dem Glas der Servante hütete. ‚Aus Freundschaft‘ — ‚Aus Liebe‘ — ‚Souvenir‘ — ach, sie waren glücklicher gewesen, der Urgrossvater, die Urgrossmutter! Siebenjähriger Krieg, Freiheitskriege, — zur freundlichen Sage waren sie geworden. Was waren vordem Kriege gewesen? Nichts gegen diesen.
Mit einem Seufzer sah die Generalin zu den Bildern hinüber. Dann las sie:
‚Die letzte Jahreswende im Krieg.‘
Schon stutzte sie: war es wirklich die letzte Jahreswende? Wer bürgte dafür? Der Kaiser? Die Heeresleitung? Der Reichskanzler? Die Minister? Immer neue Männer, neue Namen. Nie war so viel gewechselt worden in den höchsten Ämtern. Unruhig sahen die klugen Augen der Frau umher: fand sich denn nicht endlich der rechte Mann? Der Eine, der Einzige? Ihr Geist liess sie alle an sich vorüberziehen. Die anderen, die Feinde, hatten doch den Einen, den Einzigen, der ihr Schicksal lenkte — mochte sein zum Guten oder zum Bösen — es war eine Hand da, die am Steuer lag und das unentwegt festhielt. Haben wir denn keinen solchen Einen, Einzigen?
Sie zwang sich, weiter zu lesen:
‚Der zahlenmässig stärkste unserer Feinde hat die Folgerungen der Kriegslage gezogen. Das Scheitern der englischen Angriffe in Flandern und der Zusammenbruch Italiens musste die Russen vollends überzeugen, dass sie nicht darauf rechnen konnten, die eigene Niederlage durch den Sieg ihrer Verbündeten auszugleichen. Noch sind wir nicht auf der Höhe, noch ist der Trotz der Engländer, der Hass der Franzosen, die Überhebung der Amerikaner ungebrochen, aber wir sehen schon den Gipfel im Sonnenglanz des Friedens strahlen. Die letzten hundert Meter sollen uns nicht schrecken. Das schwere Gepäck auf dem Rücken, den schmalen Proviant im Beutel, aber das Herz gesund, den Blick klar auf den Führer gerichtet, der den rechten Weg weiss, so überwinden wir auch sie noch.‘
Werden wir?! Wie in plötzlicher Erkenntnis schreckte die Lesende zusammen. War denn das Herz gesund, der Blick klar? Wusste der Führer denn auch den rechten Weg? Mit einem verstörten Blick starrte Hermine von Voigt vor sich hin. Was hatte sie nicht alles sprechen hören! Selbst in den Kreisen, die früher voller Patriotismus waren. Waren das noch die Väter, die im Jahr vierzehn ihre Söhne selber zu den Waffen getrieben, die Mütter, die klaglos sie zum Opfer gebracht hatten? Waren das noch die gleichen Männer, die, längst aus der Übung und nicht mehr jung, sich doch in Reih und Glied gestellt hatten? Nicht die Ermüdung durch die lange Dauer des Krieges allein war es, die sie heute so anders gemacht hatte.
Die Frau sprang auf, wie von Angst gejagt eilte sie durch die Zimmer. Vom Wohnzimmer ins Esszimmer, von dort ins Arbeitszimmer ihres Mannes; da stand sie an seinem Schreibtisch und stützte beide Hände schwer auf. Es war ihr, als ströme von dem Platz, an dem er so oft gesessen hatte, etwas auf sie über. Gott sei Dank, er war nie verdrossen, nie kleinmütig!
Vom Osten war General von Voigt fort, es war dort kaum mehr zu tun. Russland trug sich selber zu Grabe, es frass seine Länder, seine Städte, seine Völker auf. Die Revolution war da. Russe gegen Russe, Bruder gegen Bruder, der Untergebene gegen den Vorgesetzten. Aus den Gräben waren sie gelaufen gekommen, hatten die Hände erhoben, hinüber zum deutschen Graben gewinkt: ‚Komm, komm, gut Freund!‘ Hatten Brot mit dem deutschen Landstürmer getauscht, hatten aus einer Flasche Wodki mit ihm getrunken: ‚Gesundheit! Du sollst leben! Warum Feindschaft miteinander, ich bin Mensch, du bist Mensch, unsern Acker wollen wir bauen, Gottes Sonne sehen, nicht im dunklen Graben sitzen. Russland ist gross, Väterchen ist weit, wir wollen nicht länger schiessen mehr.‘ Und sie hatten ihre Tornister hingeschmissen, ihre Flinten — wie Kinder, die hinter die Schule laufen — und hatten den, der sie antreiben wollte so wie einst mit der Knute, gutmütig grinsend zu Boden geschlagen. Nein, Russland war nicht mehr zu fürchten, und doch — wenn das Feuer nun um sich frass? Über die Steppen, über die Brachen, über die flachen Grenzen fegte der Wind, Funken trieb er vor sich her. Die sind gefährlicher als lodernde Flammen, denn unbemerkt kommen sie. Sie fallen aufs Hüttendach, sie nisten sich ein im Stroh; ehe man ihrer recht gewahr wird, lodert die Flamme schon im Nachbarhaus.
Eine heisse Röte stieg der Frau ins Gesicht. Nur keine Angst! Ihre hohe Gestalt richtete sich energisch auf. Nicht verzagen — vom Verzagen ist nur ein Schritt zum Versagen. Verzagte denn ihr Mann? Er hatte es schwer im Westen. Nein, er blieb immer derselbe. Doch konnte man die gleiche Ruhe, die gleiche Unerschütterlichkeit, die gleiche Geduld von denen hier verlangen, die wie Lasttiere ihre Tage hinschleppten, neben der Sorge um das Leben des Mannes gepeinigt wurden von den tausend Nadelstichen der Angst: wovon satt werden? Das Leben war so entsetzlich teuer, wurde es mit jedem Tag mehr. Auch kein Schuh mehr zu bekommen, kein Strumpf, kein wollenes Kleid. Und hatte der, der sich um des Lebens Notdurft nicht in gleich schwerer Weise abängstigen musste, es nicht doch ebenso schwer, vielleicht noch schwerer? Ihm gehen nicht alle Gedanken unter in der Sorge ums tägliche Brot, ihm bleiben noch der Gedanken übrig — ach, zu viele! Die Hände der Frau schlangen sich ineinander.
Horch, die Glocken! Wie sonst an jedem Wochenende den Sonntag, so läuteten sie heute abend den morgenden Neujahrstag ein. Ein dünnes, erbärmliches Gebimmel. Die grosse, feierliche Glocke, die alles übertönende erzene Stimme, wo war sie?! Herminens Augen füllten sich mit Tränen, sie fühlte sich plötzlich hilflos und verlassen.
Das Mädchen kam herein. „Verzeihen Exzellenz! ’s ist ’n Mann draussen in der Küche, er muss ...