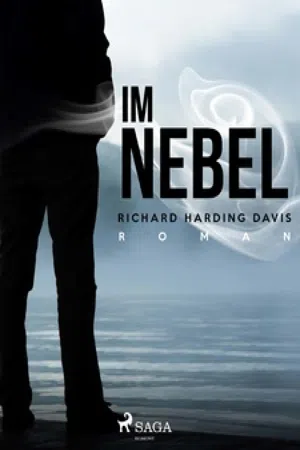Das Halsband war ein Geschenk der Königin von England für die russische Zarin, hob jetzt der königliche Kurier abermals an. Es sollte ihr bei der Krönungsfeier des Zaren überreicht werden. Unser Auswärtiges Amt wusste, dass der russische Gesandte in Paris sich zu dem Fest nach Moskau begeben würde, und ich erhielt den Auftrag, nach Paris zu fahren und ihm das Halsband einzuhändigen. Dort angekommen erfuhr ich jedoch, er habe mich erst eine Woche später erwartet und sei auf einige Tage zur Erholung nach Nizza gereist. Seine Leute schlugen mir vor, das Halsband in der Gesandtschaft aufzubewahren, aber ich hatte Befehl, mir eine eigenhändige Quittung vom Gesandten ausstellen zu lassen und fuhr ohne Aufenthalt nach Nizza ab. Vielleicht trug der Umstand, dass Monte Carlo weniger als zweitausend Meilen von Nizza entfernt ist, dazu bei, dass ich meinen Auftrag so gewissenhaft erfüllen wollte.
Wie es der Prinzessin Zichy gelungen war, etwas von dem Halsband zu erfahren, weiss ich nicht, doch kann ich es mir denken. Von der Zeit her, da sie als Spionin im Dienst der russischen Regierung stand, hatte sie ihre Beziehungen zu vielen russischen Agenten in London aufrecht erhalten. Durch einen von ihnen mochte sie erfahren haben, dass das Halsband nach Moskau geschickt werden sollte und durch wessen Hände es gehen würde. Doch selbst diese Kenntnis hätte ihr wenig genützt, wenn sie nicht noch etwas anderes gewusst hätte, wovon ich glaubte, dass es ausser mir nur noch einem Menschen auf der Welt bekannt sei, der wie ich königlicher Kurier und mein Freund war. Bis zu der Zeit, da jener Raub an mir verübt wurde, pflegte ich nämlich die Depeschen auf meine ganz eigene Art zu verbergen. Den Gedanken hatte ich dem Lustspiel »Ein Blatt Papier« entnommen. Dort wünscht nämlich jemand ein gewisses zweideutiges Dokument zu verbergen. Er weiss, dass man alle seine Zimmer heimlich danach durchsuchen wird und steckt es in ein zerrissenes Kuvert, das er auf das Kaminsims legt, wo alle Welt es sehen kann. Daraus entsteht, dass die Frau, die das ganze Haus durchstöbert um es zu finden, an den unwahrscheinlichsten Plätzen danach sucht und an dem Blatt Papier, das ihr vor der Nase liegt, achtlos vorbeigeht.
Die Briefe und Pakete, die wir oft durch halb Europa tragen müssen, sind manchmal von grossem Wert, manchmal aber auch nichts weiter als eine besondere Sorte Zigaretten oder eine Bestellung beim Hofschneider. Oft sagt man uns, was wir zu überbringen haben und oft wissen wir es nicht. Ist es eine grosse Geldsumme oder ein Staatsvertrag, so wird es uns mitgeteilt, aber meistens lässt man uns über den Inhalt des Pakets im Dunkeln und um sicher zu gehen, befördern wir es natürlich mit derselben Sorgfalt als wüssten wir, dass es die Bedingungen eines Ultimatums enthält oder die Kronjuwelen. Meine Kollegen tragen ihre Dienstsachen meist in einer Depeschentasche bei sich, die ebenso sehr in die Augen fällt wie das Schmuckkästchen einer vornehmen Dame in der Hand ihrer Kammerfrau. Jeder weiss, dass Wertsachen darin sind; man fordert die Unehrlichkeit förmlich heraus. Nachdem ich nun »Ein Blatt Papier« gesehen hatte, beschloss ich, das wertvolle Gut der Regierung immer da zu verbergen, wo man es höchst wahrscheinlich nicht suchen würde. Die Dokumente steckte ich meist in meine Reitstiefel und kleinere Gegenstände, wie Geldsummen oder Edelsteine, trug ich in einem alten Zigarrenetui bei mir. Für meine Zigarren kaufte ich ein genau ebensolches neues Etui, bei dem ich um eine Verwechslung zu vermeiden, meinen Namenszug auf beiden Seiten anbringen liess; so wusste ich immer, auch im Dunkeln, welches von beiden es war, wenn ich nach den erhabenen Buchstaben fühlte.
Ausser jenem mir befreundeten königlichen Kurier wusste, wie gesagt, niemand etwas davon. Wir beide fuhren einmal von Paris im Orient-Expresszug zusammen. Ich ging nach Konstantinopel und er nur bis Wien, wo er, wenn ich nicht irre, unserm Gesandten das Grosskreuz des St. Michael- und St. Georg-Ordens von seiten der Königin überbringen sollte. Mein Freund fand meine Methode sehr komisch und als er einige Monate später mit der Prinzessin zusammentraf, erzählte er ihr die lustige Geschichte im Lauf der Unterhaltung. Er hatte natürlich keine Ahnung, dass sie eine russische Spionin sei und sah in ihr nur die reizende Frau. Es war zwar sehr unbesonnen von ihm, aber er konnte unmöglich annehmen, dass sie jemals Gebrauch von seiner Mitteilung machen würde.
Nach dem Raube fiel es mir ein, dass ich dem jungen Menschen meinen geheimen Versteck verraten hatte, und als ich ihn wieder traf, stellte ich ihn zur Rede. Er geriet ganz ausser sich und sagte, er wäre sich der Wichtigkeit des Geheimnisses garnicht bewusst gewesen und hätte es verschiedenen Personen erzählt, unter andern der Prinzessin Zichy. Auf diese Weise entdeckte ich, dass sie es war, die mich bestohlen hatte; sie muss mir schon von London aus gefolgt sein und gewusst haben, dass sich die Diamanten in meinem Zigarrenetui befanden.
Der Zug, mit dem ich von Paris nach Nizza fuhr, ging um zehn Uhr morgens ab. Wenn ich die Nacht durch fahre, sage ich dem Stationsvorsteher meistens, dass ich ein königlicher Kurier bin und er lässt dann niemand zu mir ins Koupé; bei Tage steige ich aber ein, wo ich gerade Platz finde. An jenem Morgen sass ich in einem leeren Abteil; ich hatte dem Schaffner etwas in die Hand gedrückt, damit er mich allein liesse, nicht etwa der Diamanten wegen, sondern weil ich gern rauchen wollte. Er hatte die Tür verschlossen, und als das letzte Zeichen gegeben wurde, fing ich an, meine Habseligkeiten zu ordnen und es mir bequem zu machen. Das Zigarrenetui mit den Diamanten trug ich in meiner inneren Westentasche. Da es aber ein zu dickes Paket war, nahm ich es heraus, um es in meine Handtasche zu stecken; dies kleine lederne Reisetäschchen trage ich an einem Riemen über der Schulter und lege es nie ab, weder im Sitzen noch im Gehen.
Das Etui mit dem Halsband nahm ich aus der Westentasche, und das Etui mit den Zigarren aus der Handtasche, und während ich darin nach der Zündholzschachtel suchte, legte ich die beiden Etuis neben mich auf den Sitz.
In diesem Augenblick setzte sich der Zug in Bewegung, aber zugleich knarrte das Schloss meines Abteils; zwei Schaffner hoben und schoben eine Frau durch die Tür und schleuderten ihre Decken und Schirme hinterdrein.
Unwillkürlich griff ich nach den Diamanten, warf sie rasch in den Handsack, schob das Etui ganz nach unten und liess das Federschloss einschnappen. Die Zigarren steckte ich in meine Rocktasche, dachte jedoch dabei, dass ich mir wohl den Genuss des Rauchens würde versagen müssen, weil ich nun eine Dame zur Reisegefährtin hatte.
Eins ihrer Gepäckstücke war mir dicht vor die Füsse gefallen und die zusammengerollten Decken waren neben mir auf dem Sitz gelandet. Ich beschloss die Dame nicht merken zu lassen, wie unwillkommen mir ihre Gesellschaft sei; wenn ich von Anfang an höflich wäre, würde sie mir vielleicht erlauben zu rauchen. So hob ich denn ihre Reisetasche vom Boden auf und fragte, wohin ich sie legen sollte. Dabei sah ich sie zum erstenmal an und fand, dass sie eine Schönheit ersten Ranges war.
Mit einem reizenden Lächeln bat sie, ich möchte mich ja nicht stören lassen; dann ordnete sie ihre Besitztümer und nahm ein goldenes Zigarettenetui aus ihrem Toilettenkasten.
„Erlauben Sie, dass ich rauche?“ fragte sie. Lachend versicherte ich ihr, ich sei in grosser Angst gewesen, dass sie selbst etwas gegen meine Zigarre einwenden könne.
„Wenn Sie Zigaretten rauchen mögen, so versuchen Sie doch einmal ein paar von diesen hier,“ sagte sie. „Mein Mann lässt sie in Russland ganz besonders für sich präparieren und sie finden allgemeinen Beifall.“
Ich nahm ihr Anerbieten mit Dank an und fand die Zigarette so viel besser als meine eigenen, dass ich die ganze Fahrt über nur noch ihre Zigaretten rauchte. Wir vertrugen uns überhaupt sehr gut zusammen; sie machte einen feingebildeten Eindruck und da ihr Zigarettenetui eine Adelskrone trug, hielt ich sie für eine hochstehende Persönlichkeit. Ob sie nicht fast zu hübsch schien für eine makellose Vergangenheit, kümmerte mich wenig. Vielleicht war sie als vornehme Dame ihrer Stellung so sicher, dass sie sich keinen Zwang anzutun brauchte. Zuerst las sie ihren Roman, dann liess sie ein paar Bemerkungen über die Gegend fallen und schliesslich sprachen wir über die Tagespolitik. Sie schien alle Hauptstädte Europas und die angesehensten Leute zu kennen. Ihre eigenen Angelegenheiten überging sie mit Stillschweigen, bis auf Aeusserungen wie: „Als mein Mann in Wien stand,“ oder: „Als mein Mann nach Rom berufen wurde.“ Einmal sagte sie: „Ich habe Sie schon oft in Monte Carlo gesehen, zum Beispiel, als Sie bei dem Tauben-Preisschiessen den Meisterschuss taten.“ Ich erwiderte darauf, ich sei kein Taubenschütze, was ihr einen Ausruf der Ueberraschung entlockte. „O, entschuldigen Sie, ich dachte Sie wären Morton Hamilton, der englische Preiskämpfer,“ rief sie. Zwar sehe ich Hamilton wirklich recht ähnlich, aber ich weiss jetzt, dass ihr Zweck war, mir vorzuspiegeln, sie habe keine Ahnung, wer ich wirklich sei. Sie hätte übrigens die Komödie garnicht zu spielen brauchen, denn ich hegte nicht den geringsten Verdacht gegen sie und war nur zu froh, eine so angenehme Reisegesellschaft zu haben.
Ein Umstand hätte allerdings meinen Argwohn erregen können, nämlich, dass sie bei jeder Station nach irgend einem Vorwand suchte, um mich zu bewegen, das Koupé zu verlassen. Sie behauptete unter anderm, dass ihre Dienerin in einem Wagen zweiter Klasse hinter uns sässe und sie nicht begreifen könne, warum das Mädchen sich garnicht um sie bekümmere. Vielleicht würde ich die Güte haben, wenn die Person sich auch beim nächsten Haltepunkt nicht zeigte, auszusteigen und ihr dies oder jenes zu bringen.
Ich hatte meinen Handkoffer aus dem Netz gehoben, um meine Reiselektüre herauszunehmen, und ihn mir gegenüber am andern Ende des Koupés auf dem Sitz stehen lassen. Als sie mich auf einer Station bat, ihr eine Tasse Schokolade zu besorgen, fand ich sie bei der Rückkehr mit beiden Händen auf dem Koffer, an meiner Seite des Koupés. Ohne eine Miene zu verziehen, sah sie mich an und schob den Koffer vorsorglich in die Ecke. „Er war heruntergefallen,“ sagte sie; „wenn Sie Flaschen darin haben, sehen Sie doch lieber nach, ob auch keine zerbrochen ist.“
Und ich Esel öffnete faktisch den Koffer, um alles genau zu untersuchen. Sie muss mich wirklich für recht grün gehalten haben; mir läuft jetzt noch die Galle über, wenn ich nur daran denke. Aber trotz meiner Dummheit und ihrer Pfiffigkeit nutzte es ihr doch garnichts, wenn sie mich fortschickte, denn was sie haben wollte, steckte in dem Ledertäschchen, das mich stets begleitete, wenn ich ausstieg.
Nach dem Zwischenfall mit dem Handkoffer änderte sich plötzlich ihr Benehmen. Entweder hatte sie in meiner Abwesenheit Zeit gehabt ihn gründlich zu durchsuchen oder alles gesehen was er enthielt, als ich ihn öffnete. Sie war nunmehr überzeugt, dass sich das Zigarrenetui, in welchem ich, wie sie wusste, die Diamanten verwahrte, in der Umhängetasche befand, die ich trug, und plante vermutlich von da ab, wie sie ihrer habhaft werden könne.
In sichtbarer Aufregung vergass sie die Rolle der vornehmen Dame weiter zu spielen, gab ihre liebenswürdige Herablassung auf, brach ihrerseits die Unterhaltung ab und beantwortete meine gelegentlichen Aeusserungen nur aufs Geratewohl und in gereiztem Ton. Ohne Zweifel war sie ganz in ihren Plan vertieft. Wir näherten uns schon dem Ende unserer Fahrt und die Schnelligkeit des Eilzugs liess ihr nur noch wenig Zeit zum Handeln übrig. Trotzdem ich keinen Argwohn hatte, konnte ich doch nicht umhin zu bemerken, dass es mit ihr nicht ganz geheuer war. Ich glaube wirklich, sie würde mir, noch ehe wir Marseille erreichten, ein Messer in die Brust gestossen und mich auf die Schienen geworfen haben, hätte ich ihr nicht in meiner Dummheit selbst die Gelegenheit geboten, auf die sie lauerte. Da ich glaubte, die lange Reise habe sie ermüdet, äusserte ich, dass die Fahrt recht anstrengend sei, und fragte, ob ich ihr nicht einen Schluck Kognak anbieten dürfe. Erst schüttelte sie den Kopf, aber plötzlich besann sie sich und sagte mit leuchtenden Augen: „Ja, bitte, wenn Sie so freundlich sein wollen!“
Der Kognak war in meiner Umhängetasche, die ich nach vorn zog und mit dem Daumen auf die Feder drückte. Es ist mir zu viel Mühe, sie jedesmal zu verschliessen, weil ich mein Billett und den Fahrplan darin habe und sie häufig öffnen muss. Dass ich die Tasche am Riemen trug, hatte sich bis jetzt als genügender Schutz bewährt. Ich kann mir vorstellen, welche Befriedigung und zugleich welche Qual die Frau empfunden haben mag, als sie sah, dass sich die Tasche ohne Schlüssel öffnen liess.
Solange wir über das Gebirge fuhren, hatte ich meinen Ueberzieher angehabt, weil mich fröstelte; aber nachdem die Lampen angesteckt waren, wurde es heiss und dumpfig im Koupé. Ich stand auf, hob den Riemen über den Kopf, legte die Tasche neben mich auf den Sitz und zog den Ueberzieher aus. Dass dies leichtsinnig von mir war, kann ich nicht finden, da ich nur die Hand nach der Tasche auszustrecken brauchte; auch wäre nichts geschehen, wenn nicht der Zug im selben Augenblick in Arles angehalten hätte. Dass wir gerade auf der Station ankamen, als ich die Tasche abgenommen hatte, verschaffte der Prinzessin Zichy die Möglichkeit, den geplanten Diebstahl auszuführen.
Es versteht sich von selbst, dass sie die Gelegenheit geschickt benutzte. Der Zug, der in rasendem Lauf im Bahnhof einfuhr, hielt mit einem plötzlichen Ruck. Ich hatte soeben den Ueberzieher ins Netz geworfen und die Hand nach der Tasche ausgestreckt, im nächsten Moment würde ich sie umgehängt haben. Aber da riss die Prinzessin auf einmal die Wagentür auf, rief hinaus und winkte mit beiden Händen. „Natalie,“ schrie sie, „Natalie, hier bin ich. Komme her, so komm doch!“ In höchster Aufregung wandte sie sich zu mir. „Es ist meine Jungfer, die mich sucht,“ rief sie. „Eben ist sie am Wagen vorbeigegangen, ohne mich zu sehen. O bitte, eilen Sie ihr nach, bringen Sie sie her!“ Die Prinzessin deutete noch immer auf den Bahnsteig und winkte mir mit der anderen Hand. Das muss ich sagen, die Frau versteht es, sich Gehorsam zu erzwingen, wenn sie Befehle erteilt; es liegt etwas im Ton ihrer Stimme, das keinen Aufschub duldet. So sprang ich denn hinaus, um ihr den Willen zu tun und kam gleich wieder zurückgestürzt mit der Frage, wie die Jungfer aussähe.
„Ganz schwarz gekleidet,“ rief sie, die Koupétür verstellend. „Sie hat einen Damenhut auf.“
In den drei Minuten, während der Zug in Arles hielt, bin ich wohl mehr als zwanzig Frauenzimmern nachgelaufen mit der Frage: „Sind Sie Natalie?“ Vermutlich hielten sie mich für übergeschnappt, sonst wären sie mir wohl mit den Schirmen zu Leibe gegangen oder hätten mich von der Polizei festnehmen lassen.
Als ich wieder in den Wagen sprang, sass die Prinzessin an ihrem alten Platz, aber ihre Augen strahlten vor Freude. Sie legte die Hand fast zärtlich auf meinen Arm und sagte in lebhafter Erregung: „Sie sind wirklich sehr gütig. Es tut mir leid, dass ich Sie unnütz bemüht habe.“
Ich versicherte, dass sämtliche Frauen auf dem Bahnsteig schwarz gekleidet gewesen seien; darüber lachte sie hell auf und fuhr fort zu lachen, bis ihr Atem plötzlich so schnell ging, dass ich glaubte, sie wäre einer Ohnmacht nahe.
Die letzte halbe Stunde der Fahrt muss wahrhaft schrecklich für sie gewesen sein. Das Zigarrenetui hatte sie zwar in Sicherheit gebracht, aber sie selbst war in grosser Gefahr. Wenn ich die Tasche im letzten Moment noch öffnete und das Etui vermisste, so musste ich sicher sein, dass sie es gestohlen hatte. Gerade in dem Augenblick, als sie einstieg, hatte ich die Diamanten in die Ledertasche gesteckt und ausser uns beiden war seitdem kein Mensch in dem Koupé gewesen. Entweder war sie bei unserer Ankunft in Marseille um zwanzigtausend Pfund reicher als bei der Abfahrt von Paris, oder sie wanderte ins Gefängnis. Dieser Lage der Dinge musste sie sich vollkommen bewusst sein und ihr Seelenzustand während der letzten halben Stunde kann wirklich nicht beneidenswert genannt werden. Es war die reine Hölle.
Ich sah, dass etwas mit ihr los sein müsste und dachte sogar in meiner Unschuld, ob nicht der Kognak zu stark gewesen wäre. Denn plötzlich begann sie die lebhafteste Unterhaltung zu führen, sie bewunderte alles was ich sagte, lachte und überschüttete mich mit Fragen, so dass ich keine Zeit behielt, an etwas anderes zu denken. Sobald ich mich rührte, stockte ihr Redefluss, dann beugte sie sich vor und beobachtete mich, wie die Katze ein Mauseloch. Ich begriff nicht, wie ich ihre Gesellschaft hatte angenehm finde...