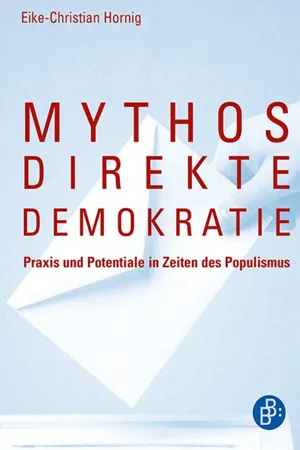
eBook - ePub
Mythos direkte Demokratie
Praxis und Potentiale in Zeiten des Populismus
This is a test
- 169 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Angaben zum Buch
Buchvorschau
Inhaltsverzeichnis
Quellenangaben
Über dieses Buch
Die Debatte um direkte Demokratie in Deutschland wird von einem Mythos beherrscht. Besonders Rechtspopulisten und Bürgerproteste propagieren das Bild einer elitenfreien, sachlichen und demokratischeren Politik durch Volksrechte. Tatsächlich aber ist direkte Demokratie eng mit Interessengruppen und Parteien verbunden und auch die Schweiz taugt nicht als Vorbild. Das Buch zeigt wie direkte Demokratie jenseits des Mythos funktioniert. Passgenau konstruierte Referenden könnten Reformfreudigkeit, Transparenz, Verantwortlichkeit, Politisierung und Legitimation der repräsentativen Politik erhöhen – wenn direkte Demokratie, dann richtig.
Häufig gestellte Fragen
Gehe einfach zum Kontobereich in den Einstellungen und klicke auf „Abo kündigen“ – ganz einfach. Nachdem du gekündigt hast, bleibt deine Mitgliedschaft für den verbleibenden Abozeitraum, den du bereits bezahlt hast, aktiv. Mehr Informationen hier.
Derzeit stehen all unsere auf Mobilgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Mit beiden Aboplänen erhältst du vollen Zugang zur Bibliothek und allen Funktionen von Perlego. Die einzigen Unterschiede bestehen im Preis und dem Abozeitraum: Mit dem Jahresabo sparst du auf 12 Monate gerechnet im Vergleich zum Monatsabo rund 30 %.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja, du hast Zugang zu Mythos direkte Demokratie von Eike Christian Hornig im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Demokratie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
[66][67]Kapitel II – Die Praxis repräsentativer und direkter Demokratie
Das vorherige Kapitel hat gezeigt, dass die öffentliche Auseinandersetzung zum Thema Volksabstimmungen in Deutschland durch den Mythos direkte Demokratie in eine verkehrte Richtung läuft und dringend korrigiert werden muss. Dies ist zur Wahrung und Wertschätzung der Parteien in ihrer Funktion notwendig. Dies ist aber auch notwendig, um uns die Optionen für mehr direkte Demokratie in Deutschland nicht zu verbauen. Übereifer und Maximalforderungen helfen hier wenig, sondern es ist ein nüchterner Blick auf die Realität gefragt. Dafür braucht es Fakten und Argumente aus der Praxis repräsentativer und direkter Demokratie. Wurde aber nicht in der Einleitung gesagt, dass an einem Mythos auch immer etwas Wahres dran ist? Gilt nicht auch hier die einfache Regel: Wo Rauch ist, ist auch Feuer? Und in der Tat gehört es zur angemessenen Auseinandersetzung auch die tatsächlichen Probleme im Verhältnis von Regierenden und Regierten zu thematisieren. Denn einige Erosionserscheinungen der repräsentativen Demokratie, insbesondere der politischen Parteien, sind unverkennbar und eine Revitalisierung ist ohne Zweifel angebracht.
Dimensionen der Parteienkrise
Es ist kein Geheimnis, dass wenige Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit den Regierungsleistungen zufrieden sind. Umfragedaten4 zeigen immer wieder, dass bis kurz nach der Wiedervereinigung noch eine grundsätzliche Zufriedenheit in der Bevölkerung vorherrschte, diese dann aber sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland in den negativen Bereich abrutschte (Gabriel/Neller 2010). Es handelt sich also zweifellos um ein veritables Krisensymptom, auch wenn wir keine gradlinige Entwicklung feststellen können. Deutlich erkennbar wird in der [68]Abbildung 4 vielmehr der Einfluss des Wahlzyklus. Das heißt Wahlen haben einen wiederkehrenden positiven Einfluss auf die Zufriedenheit – zum Glück (Gabriel/Neller 2010: 104). Besonders dramatisch ist allerdings der Absturz der Zufriedenheitswerte im Übergang der Jahre 2001 zu 2002, als die Bundesregierung unter der Führung von Bundeskanzler Gerhard Schröder die sogenannte Agenda-2010-Reform einführte. Trotz dieser und anderer Schwankungen zeigt die Tendenz aber insgesamt nach unten.
Abbildung 4: Zufriedenheit mit dem Regierungsleistungen in Ost- und Westdeutschland zwischen 1977 und 2008 (Datenquelle: Gabriel/Neller 2010: 103).5

[69]Die Deutschen sind nicht nur unzufrieden mit den Leistungen ihrer Repräsentantinnen und Repräsentanten in Parlament und Regierung, sondern sie finden auch, dass ihre Anliegen in der politischen Klasse kein Gehör finden. Es mangelt also offenkundig an einer Responsivität der Politik gegenüber den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger. Dazu liegen Daten für den Zeitraum von 1969 bis 2008 vor, also von knapp vierzig Jahren. Diese Daten können uns ein gutes Bild von der Entwicklung der Responsivität vermitteln. Für Ostdeutschland beginnt die Datenaufzeichnung mit dem Jahr 1992. Gefragt wurde in verschiedenen Varianten, ob die Politikerinnen und Politiker sich darum kümmern, was der sogenannte kleine Mann auf der Straße so denkt. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Oscar Gabriel und Katja Neller schreiben hierzu:
„Zu keinem Zeitpunkt war eine Mehrheit der Bundesbürger der Auffassung, die Politiker kümmerten sich um ihre Meinungen und Bedürfnisse.“ (Gabriel/Neller 2010: 108)
Auch wenn in den Zahlen wieder die Zyklen der Wahl erkennbar werden, ist seit dem Jahr 2002 ein Abwärtstrend im Hinblick auf die Responsivität unverkennbar. Da dürfte es auch wenig beruhigen, dass es uns in Deutschland dabei so geht, wie in anderen Ländern Europas auch. Es hat sich auch andernorts ein Gefühl der Abgehobenheit der Politik bei den Bürgerinnen und Bürgern breit gemacht, das sich immer mehr zu verfestigen scheint. Nicht zuletzt das schon erwähnte Aufkommen von Protest- und Anti-Establishment-Parteien in Europa ist hierfür ein starkes Indiz. Im Kontrast zur verbreiteten Unzufriedenheit steht allerdings die große Wertschätzung der Demokratie als Regierungsform. Eine solche Kluft in den Einstellungen wurde ja bereits oberhalb im Zusammenhang mit den Aktivisten bei den sogenannten Bürgerprotesten festgestellt. Eine Mehrheit der Deutschen in Ost- und Westdeutschland hält die Demokratie für eine grundsätzlich gute Idee. Zudem gibt es eine hohe Unterstützung demokratischer Grundwerte in Deutschland (Gabriel/Neller 2010: 111).
[70]Abbildung 5: Responsivität: Vertrauen zu den Politikerinnen und Politikern in Ost- und Westdeutschland in den Jahren 1969 bis 2008 (Quelle: Gabriel/Neller 2010: 109).6

Neben diesen allgemeinen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Demokratie als Regierungsform und ihrem Funktionieren, lassen sich auch konkrete Tendenzen der Abwendung der Bürgerinnen und Bürger von den politischen Parteien erkennen. Der erste Punkt bezieht sich dabei auf das Vertrauen. Seit dem Jahr 1991 vertrauen die Deutschen in Ost und West den politischen Parteien mehrheitlich nicht mehr7. Ein ähnliches Schicksal trifft auch den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung als Kerninstitutionen der repräsentativen Demokratie. Als Handlungsraum der Parteipolitik kommen auch sie schlecht weg. Zwischen den Jahren 1984 und 2008 sahen die Zufriedenheitswerte [71] für das Parlaments nicht so schlecht aus, doch Mitte der 1990er Jahre ändert sich dies abrupt. Im Jahr 1997 war dann der erste Tiefpunkt erreicht. Schwankungen, wie der Anstieg der Werte von 1997 zu 1998, hängen wieder mit dem Wahlzyklus zusammen.
Ein zweiter Punkt hinsichtlich der gesellschaftlichen Verankerung der politischen Parteien bezieht sich auf ihre Mitgliedschaft. Es werden auch immer weniger Menschen in Deutschland Mitglied in einer politischen Partei. Wenn von Kurzzeiteffekten, wie nach der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD im Januar 2017, abgesehen wird, sinken seit Jahren die Mitgliederzahlen relativ konstant. Damit schwindet auch die gesellschaftliche Verwurzelung der Parteien. Besonders deutlich wird diese Entwicklung seit der Wiedervereinigung. Den größten Rückgang hat die Linke bzw. ehemals PDS zu verzeichnen. Gegenüber dem Jahr 1990 ist ihre Mitgliedschaft um 79% gesunken, von 280.000 auf 59.000 Mitglieder im Jahr 2015. Ebenfalls deutlich verloren haben die FDP (-68,4%) und die Sozialdemokraten. War die SPD nach der Wiedervereinigung mit 943.000 Mitgliedern noch die größte Partei in Deutschland, hat sie seitdem über eine halbe Million Mitglieder verloren und liegt nun hinter der CDU. Diese wiederum muss einen Verlust von immerhin 43,7% über die Jahre verzeichnen; ihre Schwesterpartei CSU von nur 22,5%. Zugelegt haben seit der Wiedervereinigung allein die Grünen und zwar um sagenhafte 43,8%. Wenn nun noch berücksichtigt würde, dass der Großteil der Mitglieder in den Parteien faktisch gar nicht aktiv ist, dann verdüstert sich das Bild noch weiter. So können laut der Potsdamer Parteimitgliederstudie von 1998 etwa 47% der Mitglieder einer Partei als inaktiv und damit als sogenannte Karteileichen bezeichnet werden (Klein 2006: 54). Zwar lag in den 1990er Jahren das Mobilisierungspotential aus dem die Parteien theoretisch schöpfen könnten, immerhin bei 22% aller Wahlberechtigten. Allerdings scheinen die Parteien immer weniger in der Lage zu sein, dieses Potential auch tatsächlich auszuschöpfen. Einer der Gründe ist die sich verändernde Anreizstruktur für eine Mitgliedschaft. Während der Nutzen einer passiven Mitgliedschaft scheinbar geringer wird, spielt die Ämterorientierte Mitgliedschaft eine zunehmende Rolle. Da diese Gruppe aber gegenüber der ersten Gruppe absolut betrachtet kleiner ist, sinkt auch die Mitgliedschaft insgesamt (Klein 2006: 54).
[72]Abbildung 6: Entwicklung der Parteimitgliedschaften zwischen 1990 und 2005 in Prozent (Quelle: Niedermeyer 2016).

Auch wenn die Mitgliedschaft einem Wandel und in der Summe einer Schrumpfung unterlegen ist, identifizieren sich noch viele Menschen in Deutschland mit den Parteien. Diese scheinen nach wie vor die politischen Einstellungen der Menschen ganz gut abzubilden. Die Abbildung 7 fasst die Ergebnisse einer entsprechenden Umfrage zusammen (Gabriel/Neller 2010: 96). Die Frage war, ob die Bürgerinnen und Bürger sich einer Partei nahe fühlen (Wert 1) oder nicht (Wert 0). Trotz der insgesamt positiven Werte ist allerdings auch hier, nach einer Hochphase in den 1980er Jahren, ein Abwärtstrend zu erkennen.
[73]Abbildung 7: Stärke der Parteiidentifikation 1975–2009 (Quelle: Gabriel/Neller 2010: 97).8

Anhand der Punkte Zufriedenheit, Vertrauen und Parteimitgliedschaft lässt sich also für das Verhältnis von Regierenden und Regierten ein nicht unerhebliches Auseinanderdriften festhalten. Formal hat sich an der institutionell privilegierten Stellung der Parteien im politischen System der Bundesrepublik praktisch nichts geändert. Ausdruck dieser Stärke ist es, dass nach wie vor aus Parteiprogrammen auch Regierungsprogramme werden, Parteien alle Schlüsselämter des Staates mit ihren Leuten besetzen und sie alleine die Auswahl der Personen bestimmen. Dennoch ist ihre Funktion als Transmissionsriemen von der Gesellschaft zum Staat unter erheblichen legitimatorischen Druck geraten. Ihr Modell der Interessenvermittlung erfährt immer weniger Wertschätzung bei den Menschen. Dementsprechend wird seit Jahren in der Öffentlichkeit und der Politikwissenschaft über eine Krise der Parteien, der Parteiendemokratie oder der repräsentativen Demokratie insgesamt diskutiert. In jüngster Zeit hat sich besonders der Begriff der Postdemokratie als Zustandsbeschreibung für die politische Krise der westeuropäischen Demokratien etabliert.
[74]Der These der Postdemokratie von Colin Crouch zu Folge haben die konsolidierten demokratischen Systeme in Westeuropa ihren Zenit überschritten. Ihre demokratischen Institutionen sind zwar präsent und funktionieren formal auch, doch findet faktisch ihre Aushöhlung statt (Crouch 2004). Diese geht auf die Macht von großen Wirtschaftsinteressen und die politische Apathie vieler Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Politik zurück. Auch wenn die Postdemokratie-These von Crouch ursprünglich als Provokation gemeint war, ist tatsächlich bei vielen Menschen in Westeuropa und Nordamerika ein verbreitetes Unbehagen mit der Entwicklung der Demokratie zu erkennen. Von einer Krise der Demokratie zu sprechen wäre zwar übertrieben9, aber es machen sich Erosionserscheinungen im Verhältnis von Regierenden und Regierten bemerkbar (Merkel 2015). In der Folge gibt es in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zahlreiche Überlegungen, Anstrengungen und Versuche, der repräsentativen Demokratie wieder etwas mehr Leben einzuhauchen. Die Erweiterung der Möglichkeiten der politischen Beteiligung steht hierbei ganz oben auf der Agenda. In Deutschland und anderen etablierten Demokratien hat sich eine große Bandbreite an Möglichkeiten der direkten Beteiligung entwickelt, von denen die direkte Demokratie nur eine ist. Darüber hinaus gibt es insbesondere auf kommunaler Ebene eine Vielzahl an Instrumenten, um mehr Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungen zu beteiligen und die demokratische Legitimation der Politik zu erhöhen. Auch die Parteien selbst versuchen wieder attraktiver zu werden, z.B. durch die Auswahl von Spitzenkandidaten durch die Parteibasis. Dies stärkt die Rolle der Parteimitgliedschaft und schafft zugleich mehr Transparenz innerhalb der Partei. Das Instrument der Schnuppermitgliedschaft, wie es die FDP mal eingerichtet hatte, hat sich dagegen nicht durchgesetzt.
Es wird also viel unternommen, um die Bürgerinnen und Bürger wieder in die Politik zurückzuführen, was an sich komisch klingt, aber offenkundig notwendig ist. Die direkte Demokratie ist hier das Königsinstrument. Mit keinem anderen Instrument können mehr Menschen involviert werden. Kein anderes Instrument erfreut sich zudem einer solchen Unterstützung in der Bevölkerung. Direkte Demokratie ist in größeren geografischen Kontexten anwendbar, während deliberative [75]Verfahren eher an die kommunale Ebene gebunden sind. Dem Wunsch nach mehr direkter Beteiligung sollte entsprochen werden. Allerdings wird eine vernünftige Diskussion über die realen Möglichkeiten direkter Demokratie unter dem Mythologisierungs-Druck immer schwerer. Deswegen ist es unabdingbar, dem Mythos direkte Demokratie entgegenzutreten. Erst danach kann nüchtern analysiert werden wo und wie uns direkte Demokratie auf Bundesebene helfen kann.
Direkte Demokratie und politisches Establishment
Zentraler Teil des Mythos direkte Demokratie ist die Vorstellung, dass mit der direkten Demokratie eine Politik frei und unbehelligt von den politischen Eliten möglich ist. Versprochen wird die uneingeschränkte Selbstregierung des Volkes, die angesichts der Verkommenheit der Eliten auch dringend nötig sei. Besonders die Volksgesetzgebung wird in dieses Licht gerückt, da allein schon ihre Bezeichnung unverdächtig ist. In Wahrheit ist dieses Bild der direkten Demokratie aber eine Verklärung der Realität.
Das erste grundlegende Gegenargument gilt für alle direktdemokratischen Instrumente und Länder gleichermaßen. Verschiedene Modelle über das Abstimmungsverhalten der Wählerinnen und Wähler bei direkter Demokratie belegen, dass ausgerechnet politische Parteien ein zentraler Einflussfaktor auf das individuelle Abstimmungsverhalten sind (Uleri 2002; Le Duc 2002; Wagschal 2007). Parteien geben vor einer Abstimmung ihre inhaltlichen Positionen zum vorliegenden Gegenstand bekannt, was als Empfehlung an ihre Anhänger verstanden werden kann. In der Schweiz ist in diesem Zusammenhang von Parteiparolen die Rede. Und in der großen Mehrheit der Abstimmungen überschneiden sich die Ergebnisse der Volksabstimmungen mit diesen Positionierungen der Parteien (Hornig 2011a; Hornig 2013). Dies zeigt eine Auswertung von 228 Volksabstimmungen in 13 westeuropäischen Ländern. Einbezogen wurden dabei alle drei Haupttypen von direkter Demokratie. Die Logik ist dabei folgende: Wenn alle diejenigen Wählerinnen und Wähler, die bei der vorherigen Parlamentswahl für eine Partei A, eine Partei B usw. gestimmt haben, auch bei der Volksabstimmung den Abstimmungsempfehlungen dieser Parteien folgen, kann eine Prognose für das Abstimmungsergebnis erstellt werden. Vereinfacht[76] gesagt wäre das dann so: Partei A hat bei der Parlamentswahl 60% der Stimmen bekommen und ist für Ja bei der Abstimmung. Partei B hat dagegen nur 40% der Stimmen bei der Parlamentswahl bekommen und ist für ein Nein bei der Abstimmung. Wenn nun alle Wählerinnen und Wähler den Vorgaben „ihrer“ Parteien folgen, müssten 60% mit Ja stimmen und 40% mit Nein. Das wäre dann eine einhundertprozentige Übereinstimmung mit den Positionen der Parteien und ein Zeichen einer ausgeprägten Partyness der direktdemokratischen Entscheidung.
In der Praxis verhalten sich immerhin noch durchschnittlich 85% der Wahlberechtigten bei den direktdemokratischen Abstimmungen so, wie es nach den Vorgaben der Parteien zu erwarten wäre. Im Durchschnitt haben also nur 15% der Wahlberechtigten bei den untersuchten Volksabstimmungen anders gestimmt als erwartet. Ausgerechnet die Schweiz weist mit 92% Übereinstimmung den zweithöchsten Durchschnittswert im internationalen Vergleich auf. Währen...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelblatt
- Urheberrecht
- Inhalt
- Einführung
- Kapitel I – Mythos und Gegenmythos in Zeiten des Populismus
- Kapitel II – Die Praxis repräsentativer und direkter Demokratie
- Kapitel III – Direkte Demokratie auf Bundesebene – so funktioniert’s
- Ran an die Demokratie, aber richtig
- Literatur