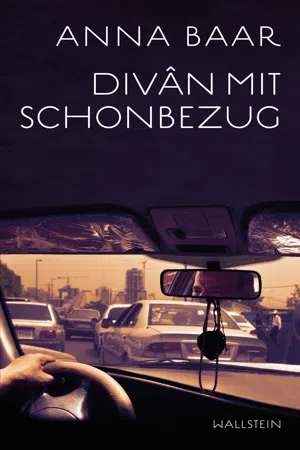![]()
Sonst nicht
Du bist zu trotzig, um abzutreten, erwiderte ich, als ich sie im Herbst 2014 im Altersheim besuchte und sie in einem seltenen Anfall von Schwäche klagte, dass es wohl bald vorbei sei mit ihr. Und sie? Gleich genickt und gegluckst, während ich, einmal mehr, tausend Tode um sie starb, hintenherum natürlich, um sie nicht zu beirren. Alle meine Tode blieben doch überflüssig. Sie hat sie überlebt. Lebt immer noch. Immer. Noch. Vielleicht vergisst sie aufs Sterben und begnügt sich auf ewig mit ihrem Zwischenreich.
Dass sie lebt, grenzt an ein Wunder. Wäre alles mit rechten Dingen zugegangen, müsste sie längst tot sein, gestorben am Alter, an Typhus, Tetanus oder Hunger. Oder am Magengeschwür. Oder an ihrer Wut auf mich bockiges Kind – Du bringst mich noch ins Grab, das hat sie oft gesagt.
Auch andere Sterbensarten schienen angezeigt: die oft kühn dosierten Angsttabletten, die vielmals aufgewärmten Brudettos und Hühnersuppen, oder die Tagesration von zwei Päckchen Zigaretten. Oder die Operation, die sie herunterspielte, solange wir unter uns waren, damit ich unbesorgt sei, aber, sobald wir einmal unter anderen und unverschämt andere waren, den schweren Eingriff nannte, als wäre ich nicht zugegen. Meine Gegenwart galt nicht, wenn sich Gelegenheit bot, flüchtigen Bekannten und entfernten Verwandten lustvoll zu beschreiben, wie ihr der Arzt das Brustbein der Länge nach aufgesägt, den Brustkorb aufgespreizt und das während des Stillstands durch die Herzlungenmaschine vertretene Pumporgan mit drei zuvor aus der Wade entnommenen Venen wieder flottgemacht hatte. Manchmal knöpfte sie mitten im Erzählen ihre Samtbluse auf und entblößte die Brüste, auf dass man die Narbe bewundere, während sich die Flüchtigen und zum Teil weit Entfernten die Hände auf die Münder klatschten und das gaukelten, was sie für angebracht hielten.
Sie hätte auch gleich sterben können, als die Hebamme sie, die viel zu früh Geborene, mehr zum Hinübergehen als um zu Kräften zu kommen, in eine Schuhschachtel legte. Aber eine wie sie: zu trotzig, wie gesagt, um einfach so abzutreten.
Ich besuche sie alle fünf, sechs Wochen. Vielleicht ist das zu selten. Nach außen hin trennt uns nicht viel, viereinhalb Zugfahrtstunden, nach innen hin aber eine beschwerliche Weltenreise, und jedes Mal die Unlust, mir wieder ein Herz zu fassen, mich endlich aufzumachen, sie wieder aufzusuchen. Ich weiß, dass ich sie nicht finde, jedenfalls nicht die, die sie mir früher war. Wann hört man auf zu suchen? Immer waren wir uns nur zu Besuch. Früher seltener, aber dafür zumeist länger. Und in den Zwischenzeiten alle paar Wochen telefoniert, immer darin einig, dass es schnell gehen musste bei sechzehn Schillingen und ähnlich vielen Dinar für jede Gesprächsminute, also umgerechnet 40 Stück Zigaretten, wenigstens die billigen, die mit dem Filter nach unten in der Verpackung steckten, damit die Straßenkehrer, Fischer, Matrosen, Knechte oder Fabrikarbeiter das Mundstück nicht zu berühren, also zumindest die Lippen nicht zu beschmutzen brauchten.
Die Zigarettenlänge, seit jeher ihr heiliges Zeitmaß, jetzt hundertfach gestaucht im Zählereinheitentakt, der, wäre es hundertprozentig nach ihrem Wunsch gegangen, wie ein Metronom das Tempo festgelegt hätte, in dem wir einander Worte und Sätze zuschanzen mussten, um in kürzester Zeit möglichst viel zu sagen, denn wozu fürs Schweigen bezahlen, für die Nachdenkpausen, die auch nichts zutage brächten als unser Wettergerede. Im Grunde wollten wir voneinander nichts wissen, einander nur vergewissern, dass der andere noch lebe: Nona wollte nur kurz deine Stimme hören. Sie blieb die dritte Person, hatte nie aufgehört, zu jenem Kind zu reden, das ich in den Trümmern meiner Jugendexzesse lange verschüttet glaubte. Jedes Anrufannehmen ein Außerkraftsetzen des Raum-Zeit-Kontinuums durch ferngesprächige Nähe.
Über die Jahre ist es uns zur Gewohnheit geworden, am Abend zu telefonieren, hauptsächlich, weil ab sechs der billige Nachttarif galt: eine Gesprächsminute für wohlfeile 20 Kippen.
In den letzten Jahren, die Kosten für Telefonate kaum noch der Rede wert, kostete ein Anruf vor allem Überwindung. Der Freiton war Angstton geworden. Ich zählte jedes Läuten im Fünfsekundentakt: Einmal, zweimal, dreimal. Was, wenn sie nicht abhöbe? Was, wenn sie diesmal mehr sagte, als ich erfahren wollte? Was, wenn auf meine Frage, die nur eine Auskunft wünschte, nicht die Erlösung folgte? Besser erst gar nicht fragen! Was aber überhaupt reden? Ihr sagen, dass ich sie liebe und nicht verlieren möchte? Dass ich vieles von dem, was sie so beinhart behauptet, dass ich es trotzig bestreite, insgeheim bejahe? Oder ihr alles gestehen, die Lügen und Maßlosigkeiten, die Sehnsüchte, Unkeuschheiten, sie nicht dumm sterben zu lassen?
Ihr sagen, dass ich sie eigentlich jetzt schon vermisse?
Du bist doch sonst nicht so … Was? Na, auf den Mund gefallen.
Nie widersprach ich ihr, wenn sie unser Geplauder zuletzt schon nach zwei, drei Minuten abzubrechen versuchte, mit dem Einwand von früher, wir würden doch jedes Mal Geld vertelefonieren. Die Ausrede, die nicht mehr galt – wir waren auf sie angewiesen. Zwei, die sich alles verschweigen, haben sich nichts zu sagen. Sie unterhalten sich, halten sich streng bei Laune, halten einander in Schach, kreiseln, tänzeln, wirbeln um das Eigentliche, leugnen die Angst, schweifen ab, um nur nicht anzustreifen. Keine falsche Bewegung! Sie schnurren sich die Ahnung vom Hals, geben sich gut und zufrieden, sind sich harmlos, zwitschern, wo die Worte versagen. Nur zum Lebewohl seufzen sie ein bisschen und drücken dabei die Lippen auf ihre Apparate, die eine auf den Touchscreen ihres Mobiltelefons, die andere auf die Muschel ihres kohlrabenschwarzen, kartoffelteigverpickten Fingerlochdrehscheibendings, Modell anno 1980, das, wie sie einmal sagte, in Farbe erhältlich war, allerdings nur gegen Aufpreis. Dann schnell, schnell aufgelegt, bevor sie mir zuvorkommt und ich es bin, der nichts bleibt als der verfluchte Besetztton.
Wir telefonieren nicht mehr, seit sie nicht mehr zuhause ist bei ihrem Tischtelefon, auf dessen Plastikwählscheibe zuletzt ein Etikett mit Notfallrufnummern klebte. Mit Handys kommt sie nicht zurecht. Jetzt gilt nur noch mein Besuch im jüdischen Altenheim. Einmal alle paar Wochen – und wenn, dann nur wir zwei allein, seit dem Fiasko im Sommer, als ich sie ein paar Freunden aus Österreich vorstellen wollte, allerdings nicht als erschöpfte, bettlägerige Greisin, sondern als die Schöne und unendlich Tapfere, von der ich immer erzählte.
Man muss sich das einmal vorstellen: Die österreichischen Freunde warten im Anstaltsgarten. Ich bin vorausgeeilt. Die Schwester betritt das Zimmer, hievt meine Schöne vom Bett, wuchtet sie in den Rollstuhl. Dann wird Essen gebracht: Spiegelei mit Spinat. Iss schneller, die Freunde warten! Sie habe nie im Leben Brot zum Essen gegessen, behauptet sie unterdessen. Jetzt mach nicht auf feine Dame, komm schon, iss einfach weiter! Ob es ihr schmecke. Naja. Nach einer Weile beginnt sie, im Eigelb herumzustochern, schiebt es zum Tellerrand. Was sind denn das für Freunde? Dann spießt sie ein Stück auf, hält mir die Gabel zum Mund. Ich habe schon gegessen. Magen knurrt. Handy läutet. Die Freunde fragen geduldig, wann sie raufkommen dürfen. Gebt mir noch fünf Minuten. Jetzt scheint meine Schöne plötzlich doch wieder Esslust zu haben. Nach jedem langsamen Bissen streiche ich ungeduldig mit dem Küchentuch, das man ihr umgehängt hat, über ihr Cremespinatkinn. Die Schwester taucht wieder auf: Sehen Sie zu, dass sie aufisst. Sie isst in letzter Zeit wenig. Es ärgert mich, wie die Schwester von und zu ihr redet, als sei sie ein dummes Kind. Aber ich sage nichts.
Du bist doch sonst nicht so … Was? Na, auf den Mund gefallen.
Die Schwester verlässt das Zimmer. Die Schöne funkelt mich an mit ihren hellen Augen, grüne Gischt um den Mund. Die Beine ragen weit aus ihrem Bademantel. Niemand soll sie so sehen! Ich tupfe mit dem Lätzchen auf ihren Lippen herum, wo, um Himmels willen, ist deine Zahnprothese?, flechte ihr hastig den Zopf. Plötzlich kommt sie mir mit Titos Elefanten, weiß sogar ihre Namen: Sony, sagt sie, und Lanka. Ein Geschenk an den Marschall. Denk nur: Von Indira Gandhi! Ich will sie ordentlich anziehen, kann auf die Schnelle nichts finden, schnappe die Jogginghose von einer Sessellehne, stopfe die nutzlosen Beine durch die schlabbernden Röhren, stemme die Schöne vom Rollstuhl. Wir fallen ins Gitterbett, sie rücklings, ich auf sie drauf, keuchend: Gleich kommt Besuch. Freunde. Sehr gute Freunde. Wir müssen dich anziehen, hörst du! Sie nickt. Ich zupfe und zerre, versuche, sie hochzuheben, lasse nicht locker, reiße, ziehe die Hose höher. Zentimeterarbeit. Wir wälzen uns auf dem Bett, kommen ins Schwitzen, schnaufen. Jetzt erst bemerke ich den Riss in der Jogginghose.
Es klopft an der Tür. Moment! Das passt alles nicht ins Bild, das sich die Freunde machen. Ich rolle mich von ihr ab, werfe ihr geschwind das nächstbeste Bettlaken über, ziehe das Bettgitter höher. Ok, kommt rein! Kommt rein!, rufe ich außer Atem und versuche, zu lächeln, während sich im Mund meiner schönen Geliebten wieder Spinatgischt sammelt.
Vielleicht bemerkt es ja keiner.
Vor wenigen Tagen erst war ich wieder bei ihr. Und nicht etwa aus Sehnsucht, ich will sie so nicht sehen, sondern um mein Gewissen ein klein wenig zu beruhigen.
Der Fernseher lief, wie immer. Sie sagte, sie würde nun ein bisschen weniger lesen, um ihre Augen zu schonen, und ich lehnte lethargisch an ihrem Gitterbett und blickte auf den Nachttisch, auf dem die Hornbrille lag, die sie nie aufsetzen wollte, und dachte: Stürbe sie morgen, hätte sie mit ihrer Sehkraft völlig umsonst hausgehalten.
Was ist mit dir?, fragte sie nach ein, zwei Minuten des Schweigens. Nichts, erwiderte ich, und fragte mich, warum sich niemand darum gekümmert hatte, sie nach dem Sturz vor zwei Jahren auf die Beine zu bringen. In der Dreiviertelstunde, die ich völlig zerknirscht an ihrem Bett zubrachte, weil eine Dreiviertelstunde niemals reichte für zwei, die die Liebe behaupten, wünschte ich insgeheim, sie würde durch meinen Besuch bald genauso erschöpft, wie ich von ihrem Anblick. Ich rieb ihre trockenen Hände mit einer Creme ein, die im Zimmer herumstand. Die teure Pflegecreme, die ich ihr letzten Sommer aus Österreich mitgebracht hatte, war schon beim nächsten Besuch unauffindbar geblieben.
Beim Abschied hielt ich es kurz, tat, als sei ich in Eile, um Minuten später gemächlich zum Bahnhof zu schlendern.
Zeitungsfetzen tanzten über die Straßen und Plätze, Tauben flatterten auf, sobald eine Tramway nahte, und ließen sich gleich darauf seelenruhig nebenan nieder. Ich roch an meinen Fingern, hatte sie nicht gewaschen nach dem Einbalsamieren ihrer lieben Hände, und dachte an unsere gemeinsamen Tramwayfahrten, immer die Ilica-Straße bis zum Republikplatz. Sie hatte freie Fahrt mit ihrem Versehrtenausweis, den sie dem Straßenbahnschaffner unaufgefordert zeigte – Kriegsinvalide sein war eine Frage der Ehre, je mehr Prozent, desto besser –, wie all die anderen alten vom Freiheitskampf Ramponierten, die sich mit Plastiksäcken und quietschenden Karijolas humpelnd, schlurfend, bucklig über die steilen Treppen hinauf zum Marktplatz schleppten, vorbei an rußgeschwärzten, verwitterten Hausfassaden, deren frühere Pracht man noch erahnen konnte, vorbei an Hofeinfahrten, Verstecken für Liebende, Lumpen, lachenden jungen Frauen, die ihre Finger in Springbrunnenfontänen hielten, um ein paar Burschen zu necken, vorbei am Drehorgelspieler neben dem Jelačić-Denkmal, der samstags im Sonntagsgewand Und der Haifisch, der hat Zähne, Greensleeves und Für Elise spielte, vorbei auch an den Knaben mit den Matrosenmützen und Lederimitatjacken, die qualmend an den Brettern einer Wurstbude lehnten und Zigarettenstummel in die Baumscheiben schnippten. Vorbei, vorbei, vorbei, wie das Klack-klack auf den engen, abschüssigen Bürgersteigen, ähnlich dem schnellen Klack-klack, wenn wieder ein Telefonschloss in einem Fingerloch steckte, damit die Kinder nicht heimlich Freunde anriefen, wenn sie Hausarrest hatten, und die gewieften Kinder die Wählmechanik umgingen, indem sie im Nummerntakt aufs Gabelschlagknöpfchen klopften. War die Sperre erst im Loch 3 angebracht, konnte man wenigstens noch die Feuerwehr rufen.
Am Bahnhof angekommen, gespiegelt im schmierigen Glas der Bäckereivitrine, kam mir in den Sinn, wie meine Schöne erschrak, als wir zwecks Rollstuhlausfahrt den verspiegelten Lift des Seniorenheimes benutzten. Entsetzen als Spiegelreflex. Das bin nicht ich, hat sie gesagt. Nein, das ist bloß die Wahrheit. Und früher? Immer penibel blondiert, fast immer schön frisiert, überhaupt schön, so sehr, dass man sich erzählte, die Zikaden würden ihr Lied selbst im Dunkel anstimmen, wenn sie sich am Fenster ihres Schlafzimmers zeigte, so schön, dass ich als Kind heimlich ihr Wangenrot auftrug, bis zu dem einen Tag, da sie mich mit Rotlaufverdacht in ihr Ehebett steckte, wo sie mir mit ihrem angespeichelten Daumen über die Backen wischte, bis die Heimlichkeit aufflog.
Und wie gut ich mir vorkam, als ich ihr bei einer unserer viel zu seltenen Rollstuhlexkursionen einen Schluck Baileys-Likör aus dem Papiersack reichte. Womöglich der letzte Geburtstag. Später aßen wir die mitgebrachte Torte, darauf zwei Zahlenkerzen. Sie setzte die Drei vor die Neun – für ein hauchdünnes Lächeln. Anzünden, singen, pusten. Dann schoss ich ein Selfie mit ihr, ein vielleicht letztes Foto, denn wer weiß. Wer weiß.
Zehn, fünfzehn letzte Fotos habe ich schon geschossen. Alle nur für den Fall.
Ich lösche die Festnetznummer nicht aus meinen Kontakten, obwohl dort keiner mehr abhebt. Und nie mehr die lange Nummer auf meinem Handydisplay, wenn es zur Unzeit klingelt. Ich schäme mich, zuzugeben: In den früheren Zeiten erfasste mich ihretwegen bei jedem Telefonläuten ein solches Unbehagen, dass ich in den Jahren als Josefstädter Studentin einen Anrufbeantworter samt Lautsprecher installierte, und nicht, damit er mir bei jedem Nachhausekommen durch ein blinkendes Lämpchen verpasste Anrufe melde, was mich immer beklemmte, sondern um sicher zu sein vor Überraschungsanrufen, nicht abheben zu müssen, sobald es wieder schrillte, stattdessen abzuwarten bis zur Bandansage, bei der ich jedes Mal stillhielt, als könne der Anrufer meine Anwesenheit anderenfalls bemerken. Sie aber dachte nicht daran, auch nur einen einzigen Satz auf das Tonband zu sprechen, rief immer nur meinen Namen, mehrmals, eindringlich, flehentlich, manchmal auch vorwurfsvoll, als wüsste sie, dass ich sie hörte. Und wenn sie dann doch auflegte, vielleicht, weil ihr eingefallen war, dass auch das Rufen des Namens nicht gebührenfrei bliebe, fühlte ich mich so schuldig, dass ich eilig zurückrief.
Als sich der Zug Richtung Wien in schnelle Bewegung setzte und die Hochstromleitungen der Stadt auseinanderliefen und aus dem Blick verschwanden, und die jetzt kleineren Häuser die nächste Welt ankündigten, Blick durchs andere Fenster, und wie in einem Flashback die Busfahrt durch die Krajina und diese Frau aus München, die so dicht neben mir saß und beim Anblick der tür- und fensterlosen, von Einschusslöchern zersiebten Rohbauruinen meinte, es herrsche in diesem Land rege Bautätigkeit. Und wie ich wieder nichts sagte und an die Erstürmung dachte und daran, wie ...