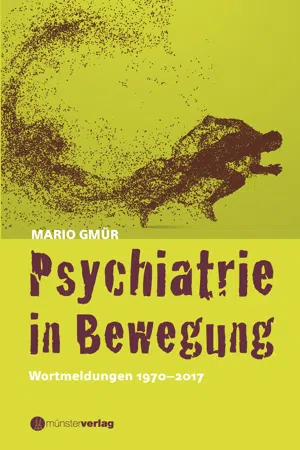
This is a test
- 288 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Angaben zum Buch
Buchvorschau
Inhaltsverzeichnis
Quellenangaben
Über dieses Buch
Dieses Buch vereinigt Aufsätze des Schweizer Psychiaters M. Gmür, die zwischen 1970 und 2017 erschienen sind. Sie reflektieren die progressiven und restaurativen Veränderungen der schweizerischen und weltweiten Psychiatrieszene. Einerseits wegleitende Anregungen und Konzepte zur Behandlung der Drogensucht und Schizophrenie, andererseits pointierte kritische Stellungnahmen zu psychiatrisch relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen wie die Ausbreitung der Glücksspielsucht, die Boulevardisierung der Medien und die repressiv-totalitären Entgleisungen der forensischen Psychiatrie.
Häufig gestellte Fragen
Gehe einfach zum Kontobereich in den Einstellungen und klicke auf „Abo kündigen“ – ganz einfach. Nachdem du gekündigt hast, bleibt deine Mitgliedschaft für den verbleibenden Abozeitraum, den du bereits bezahlt hast, aktiv. Mehr Informationen hier.
Derzeit stehen all unsere auf Mobilgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Mit beiden Aboplänen erhältst du vollen Zugang zur Bibliothek und allen Funktionen von Perlego. Die einzigen Unterschiede bestehen im Preis und dem Abozeitraum: Mit dem Jahresabo sparst du auf 12 Monate gerechnet im Vergleich zum Monatsabo rund 30 %.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja, du hast Zugang zu Psychiatrie in Bewegung von Mario Gmür im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychology & Forensic Psychology. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
BIOGRAFIE
27. Sauber ist, wenn man den Dreck nicht mehr wegbringt
Aus: Tages Anzeiger, 24. Juli 1991
Miami Beach 1991:
Are you from Switzerland?
Yes, I am.
Really, are you?
Why should I not?
Oh, it’s a so lovely country.
I know.
It’s so clean there everywhere.
That’s right.
I have been in Lucerne last year, it’s a
lovely city, so clean!
lovely city, so clean!
I agree; our mayor in Zurich comes
from Lucerne, actually.
from Lucerne, actually.
Really?
Why should he not?
In anderen Städten (Basel, Lissabon, Jerusalem etc.) gilt es als indiskret, Mitbürgern durchs Fenster in ihre Wohnung zuschauen. In Zürich aber empfindet man es bereits schon als indiskret, wenn einer/eine aus seinem/ihrem Fenster hinausschaut. Und dass jemand gar Abfall auf die Strasse werfen würde, ist hier schon jenseits von jedem gesund-zürcherischen Vorstellungsvermögen. (eher noch macht einmal eine suizidal oder fremdaggressiv gefärbte Exfenestration mit anschliessender psychiatrischer Notfalleinweisung Schlagzeilen). Zürich ist anständig. Anstand = immer der richtige Abstand. Hände waschen, Gosche halten! – Zürich ist sauber, die Schweiz, die reine Schweiz (nicht der Schweine Reiz). Wenn ich mit Migros-gefüllter Einkaufstasche, die sechsschichtige Klosettpapierrolle zuoberst herausragend – rosarot, weich und saugend –, den Zeltweg heimwärts schlendere, so beschleicht mich ehrlich gestanden zuweilen schon ein etwas peinliches Schamgefühl angesichts so offenkundiger Demonstration mir bevorstehender (als Mediziner mir vertrauter) anaboler (aufbauender) und kataboler (abbauender) Stoffwechselabläufe. Und selten ergreift eine no-future-verheissende Desillusionierung stärker von mir Besitz als auf solchen pflichtgeleiteten und sauberkeitsbewussten Spaziergängen. Quintessenz Klosettpapier. Die Sinnfrage: Ist es das?
Beobachtet wie im Dorf
Zürich ist ein Ort, wo man vereinsamt wie in einer Grossstadt und beobachtet wird wie in einem Dorf. In keiner andern Stadt gibt es diese einzigartige Mischung. Es stimmt natürlich nicht, dass niemand aus dem Fenster guckt. Unsinn! Jeder guckt auf die Strasse. Jeder guckt, aber keiner lässt sich dabei erwischen. Jeder hat geguckt, aber keiner gesehen, wie der andere geguckt hat. Frau Meier weiss immer genau, wenn Frau Müller den Müllsack wieder einmal fünf Minuten zu spät, das sind 71 Stunden und 55 Minuten zu früh (!), vor die Haustüre gestellt hat. Sie sagt’s ihrem Gemahl (ihrem «Chef»), der’s Herrn Müller hinterbringt, dessen angetraute Sünderin (die’s ja bereits aus erster Hand wissen muss) von ihm den Vorfall mit dem Abfall noch ein zweites Mal zu hören bekommt, wenn sie nicht schon von Herrn Meier bereits schon darüber ins Bild gesetzt worden ist. Zürcher sind kontaktfreudig. Besonders im Zusammenhang mit Zürich scheint das Wort «Sauberkeit» mit kritisch-entlarvendem Ton auf das Spannungsverhältnis zwischen Sein und Schein verweisen zu wollen. Nun, wer sich sehr um Sauberkeit bemüht, gesteht ja implizit sein leidenschaftliches Intimverhältnis zum Schmutz schon ein. Der Saubermacher ist der grösste Schmutzli, immer mit Schmutz beschäftigt, den Dreck zu beseitigen, moralisierend (Schmutzli schmatze nicht!), warum? Saubere Geschäfte an der Bahnhofstrasse – schmutzige Geschäfte am Paradeplatz; ist es das? Schmutzige Geschäfte auf dem Platzspitz – saubere Spritzen in der Arztpraxis; oder das? Nein, nein, uns Zürcher irritiert das Neben- und Miteinander von Gewinn und Schmutz mitnichten. Jedes Kind lernt schon in der Schule, dass man nichts erreichen kann im Leben, ohne die Hände schmutzig zu machen. Und auch der bestsituierte Zürcher kommt um die anatomisch verankerte gutnachbarliche Beziehung von kreativem Schaffen und exkrementellen Funktionen nicht herum und hält sich somit ohne Widerspruch an Heine: «Was demMenschen dient zum Seichen, damit schafft er seinesgleichen.» Auch Zürich wächst. Was hat es dann für eine Bewandtnis mit der berüchtigten zürcherischen Sauberkeit? Argwohn schöpft der Zürcher nur gegen jenen Abfall, der ungeschminkt auf Reichtum und Macht verweist, die man ihm neiden könnte. Keinen Prunk anzeigenden Schmutz bitte. Immer schön bescheiden, sauber und anständig. Was tänked ä d Lüüt? Si tänked anüt als was tänked ä d Lüüt. Drum sagt auch Frau Generaldirektor in der Metzgerei: «Es dörf scho es bitzeli mee si, aber nöt zvil, susch git s dänn öppis.» Nicht dass jemand noch auf die fatale Idee verfiele, ihr Bankkonto quelle über. Schliesslich müssen wir in einem Land ohne Rohstoffe alles mühsam erschaffen, im Schweisse unseres Angesichts – sagt ihr Mann. Da kann man nicht einfachso schletzen. «Ein mageres, bitte.» Nur nicht auffallen, immer schön bescheiden Keinen Abfall, der auf Prunk verweist. Am besten umweltschonend -abfallfreies Wachstum: Ein Bankkonto mehrt sich von selbst. Oder abfallfreie Verluste: Die Einfränkler direkt in die Geldspielapparate (die fallen dort ja automatisch ab). Welche Dummheit, dass das Volk diese nun selbst in Abfallverwandelt hat.
Makellos will der Zürcher sein
Irrtum! Nicht sauber will der Zürcher sein, sondern makellos. Denn am schlimmsten ist stets der erste Fleck. Der fällt auf. Eine Attacke auf unsere Exhibitionshemmung. Ein Tolggen im Reinheft: Der Platzspitz! Welche Schande! Er hat inzwischen dem Grossmünster im europäischen und internationalen Bekanntheitsgrad schon längst den Rang abgelaufen. Nicht der Fleck ist uns peinlich, Schwamm drüber, aber bitte etwas diskreter. Und bitte keinen Schmutz, der ein Eigenleben führt, abgekoppelt vom geordneten Geschäftstreiben. Also weg mit der Drogenszene, und bis der Schandfleck weg ist, bitte immer am gleichen Ort konzentriert: überschaubar, kontrollierbar, zugänglich. Drogenpolizei, Drogenkommission, Drogencharta, Drogentherapie, Drogendebatte, Drogenseminar, Drogenprogramm der FDP, SVP, SP, EVP, LdU, Drogenpolitik. Zwanzigjähriges Bemühen hat den Fleck nicht weggemerzt. Zum Verzweifeln, er wird immer grösser. Alles nützt soviel wie ein Frottiertuch im strömenden Regen. Versuchen wir’s doch wieder mal mit der’ Dezentralisierung: Gleichmässig-regelmässige Verteilung der Schande über die ganze Region, und deklarieren wir das ornamentale Netzmuster zum beabsichtigten Kunstwerk. Oder mit der Verwandlung von Ablehnung in Toleranz: Sie dürfen schon hier bleiben, die Drögeler, Asylanten und Emanzen. Aber nicht so auffällig und selbstbewusst. Dass die Presse immer darüber schreiben muss. Es ging ja alles so leicht.
Ohne Grund unterwegs – unmöglich!
Nicht auffallen also, immer schön bescheiden auf seinem Platz. Niemand ist in Zürich unterwegs ohne Grund, niemand. Jeder, der durch Zürich spaziert, hat einen Grund oder eine Rechtfertigung im Mund. «Ich muss noch rasch auf die Post, ein Eingeschriebenes», «Ich komme eben gerade von einer Ozonintensivkur in der Bircher-Benner-Klinik, ist gut gegen Leberentzündung», «Bei dem schönen Wetter muss man doch fast ein Stündchen an die frische Luft, man kann doch nicht immer im Wönigli bliibe», «Ich mache eine Umfrage auf dem Platzspitz, Natiorialfonds». Ohne Grund unterwegs? Das ist das grösste Verbrechen, dessen sich ein Zürcher bezichtigen kann. Die häufigste Eintragung auf Zürcher Fichen, ich wage es zu behaupten, lautet: «… war ohne Grund unterwegs, vom Irchel bis ins Albisgüetli, mit Umweg über Höngg und durchs Niederdorf (zu Fuss und ohne Grund).»
Zürich ist die schönste Stadt der Welt. Aber sie zieht durch ihre Sauberkeit den Verdacht von Schmutz auf sich. Darum muss sie weiter putzen, um diesen Verdacht auf Schmutz wegzufegen. Mit einem grossen Arsenal von Reinigungsmitteln, Fleckenwassern, Holzschutzmitteln, Farben, Lacken, Benzindämpfen. Und da kommt aus dem rot-grünen (nicht etwas zu auffällig?) Stadthaus der Aufruf: Achtμng, verwandelt sich in Sommersmog, Sie wissen, was Sie zu tun haben! Geklagt wird weniger über Ozon als über Ozonwerte. Sauberkeit als Geburtshelferin von Schmutz. Und Schmutz als Auftrag an die Sauberkeit. Wie sagte doch einst mein Bruder: Sauber ist, wenn man den Dreck nicht mehr wegbringt.
28. Weihnachtsferien im Irrenhaus Rosegg
Aus: Meine Mutter weinte, als Stalin starb, Salis Verlag 2013
Mein Großvater stammte aus Russland und er war Jude. Ich war stolz darauf, dass er Arzt war. Einmal bat er mich in sein Sprechzimmer im Parterre, untersuchte meine Warze an der rechten Ferse und machte mit dem Messer, welches ihm die Anstaltsschwester reichte, einen tiefen Schnitt. Das schmerzte unvergesslich. Und ich durfte meine Weihnachtsferien um drei Tage verlängern.
Als ungefähr Zwanzigjähriger ist Opa, so nannten wir ihn, zusammen mit Oma, so war sie genannt worden, aus Rostow am Don in die Schweiz geflohen. In Russland wüteten damals Pogrome gegen die jüdische Minderheit. Juden durften nicht zur Schule gehen. Eine Ausnahme wurde nur für Hochbegabte gemacht. Doch kam höchstens einer von hundert Juden in diesen Genuss staatlicher Schulung. Der Cousin meines Großvaters, Onkel Salomon Rachlin, war ein solches «Genie». Auch er wanderte aus, nach Bern, und studierte Philosophie. Er war ein vollbärtiger Mann mit heiserer Stimme, die sich überschlug, und machte dauernd Sprüche. Diese waren zeitlebens seine einzigen philosophischen Manifestationen. Weder hat er ein Studium bis zum Ende absolviert, noch eine einzige Schrift verfasst. Er war schlicht und einfach Philosoph und hatte in seiner Altstadtwohnung zahlreiche philosophische Bücher im Regal, deren Zeilen, ohne Lineal, mit blauem Farbstift unterstrichen waren, ein weiteres Indiz seiner Gelehrtheit. Es ist nicht auszuschließen, dass er tausende von Zeilen unterstrichen hat, ohne eigentlich zu verstehen, was er las. Unterstreichen als Studierbeweis. Sprüche als Ausfluss von Intelligenz. Jedenfalls, Hut ab, war er zur Schule zugelassen. Mein Großvater und die anderen hingegen lernten heimlich unter Lebensgefahr im Keller. Gelebt hat Onkel Rachlin allein. Gewohnt hat er in einer großen Dreizimmerwohnung. Gegessen in einem Restaurant. Sein Geld hat er in den Nachkriegsjahren verdient, indem er bei verschiedenen Firmen Inserate für die Berner Theater-Zeitung einholte. Als er dreiundsiebzigjährig starb, hinterließ er ein Vermögen von hundertdreißigtausend Franken. Die Hochkonjunktur der Nachkriegszeit hat auch einem verbummelten jüdischen Philosophiestudenten zu einem hübschen Wohlstand verholfen.
Onkel Rachlin war die Karikatur eines alten Juden. Ich war froh, ihn nicht in meiner Stadt, sondern anderswo, meinetwegen in der Bundeshauptstadt, zu wissen. Die Wohnung hat er nie aufgeräumt. Stapelweise lagen Bücher am Boden. Das Geschirr war nie abgewaschen, sondern stand jahraus, jahrein schmutzstrotzend auf dem Küchentisch. Die Socken gab er nie in die Wäsche, sondern warf sie nach einmaligem, aber umso ausgiebigerem Gebrauch in den Müll und kaufte sich neue. Er war ein Pionier der Wegwerfgesellschaft.
Mein Großvater gehörte weder zu den Hochbegabten noch zu den Pionieren. Weil das Lernen für ihn in Rostow versteckt und verboten war, war es umso attraktiver. Das höchste Gut für die jüdischen Bürger war die Bildung, die Wissensaneignung. Und als er zusammen mit seiner ebenfalls noch jungen Frau in die Schweiz kam, begann er, Medizin zu studieren. Da er staatenlos war, war die Legitimationskarte der Universität sein wichtigstes Dokument. Sie ersetzte den Pass. Jahre später noch, als er schon längst eingebürgert war – schließlich war er an einem 1. August zur Welt gekommen, und wie viele Schweizer haben schon am Nationalfeiertag Geburtstag? –, fragte er uns Enkelkinder, die wir eben die Eintrittsprüfung für das Gymnasium bestanden hatten: «Hast du Legitimationskarte? … Und du, hast du Legitimationskarte?» Als Kinder verstanden wir nicht, welche existenzielle Bedeutung die Legitimationskarte für ihn haben musste. Sie war der Ausweis seiner Seinsberechtigung als Emigrant.
Als Medizinstudent wollte er später Gynäkologe werden. Doch erlangte er als Staatenloser ohne eidgenössisch anerkanntes Staatsexamen nicht das Recht, frei zu praktizieren. Auch der Schnitt in meine Warze an der rechten Ferse war somit nie eidgenössisch anerkannt. So hatte er eine Stelle als Assistenzarzt in der Kantonalen Psychiatrischen Klinik Rosegg angenommen. Dort war er eines Tages Oberarzt geworden, irgendwann hieß seine Stellung plötzlich Sekundärarzt und das blieb er bis zu seinem Tod, ein halbes Jahr vor seiner Pensionierung. Vierzig Jahre lang war er Anstaltspsychiater gewesen. Als Jude war er dort umgeben von lauter Katholiken.
Während der Nazizeit, als man den Einmarsch der deutschen Truppen in die Schweiz täglich und manchmal stündlich erwartete, hatte er in seinem Nachttischchen neben dem Ehebett eine Giftspritze aufbewahrt, damit er sich den goldenen Schuss setzen konnte, rechtzeitig bevor die Anstaltswärter ihn aufhängen würden. Damals sprach man noch von Wärtern und nicht von Pflegern wie heute. Wärter waren muskulöse Männer, die, was ihre Mentalität anbelangt, deshalb Wärter geworden waren, weil in der Schweiz die Todesstrafe abgeschafft worden war. Sie waren eigentlich verhinderte Henker, verhinderte Aufknüpfungsbeamte. Heutige Pfleger sind hingegen sensible Burschen, welche die Geisteskranken verstehen wollen.
Bewundert habe ich meinen Großvater auch, weil er zuckerkrank war. Ich beneidete ihn, der ich fürs Leben gerne an Zuckerwatte lutschte, um den Süßstoff im Blut. Und ich beneidete ihn auch, weil er eine Diät einhalten durfte, was für ihn ein qualvolles, einschränkendes Müssen war, mir aber als Privileg vorkam, das ich ihm zwar nicht missgönnte, mir aber ebenso von Herzen gewünscht hätte. Vor allem das Knäckebrot, das er anstelle von gewöhnlichem Brot aufgetischt bekam und das uns Kindern vorenthalten wurde, damit immer genügend Knäckebrot in Reserve für Opa da sei, hatte es mir angetan. Wie enttäuscht war ich jedes Mal, dass ich mit Weißbrot oder dunklem Brot vorliebnehmen musste. Nur nach inständigem Flehen ließ sich Tante Milly ausnahmsweise erweichen und reichte uns, den Kindern, eine einzige Scheibe hartes und zerbrechliches Knäckebrot.
Tante Milly war seine zweite Frau, eine ehemalige Oberschwester der Rosegg. Mit ihr zusammen bewohnte er den Mitteltrakt des wie immer bei Irrenhäusern kasernenartigen und gelbfarbenen Baus, eine Altbauwohnung von geräumigem Ausmaß mit einem langen Korridor. Dieser war auf beiden Seiten abgeschlossen durch eine Tür, die ihn auf der einen Seite von der Männerabteilung, auf der andern von der Frauenabteilung trennte. Nur mein Großvater hatte mit dem Vierkantschlüssel Zutritt zu diesen Abteilungen. Er sagte dann: «Ich muss auf die Visite», oder: «Ich muss noch eine Patientin besuchen.» Von der Männerseite drangen kaum Geräusche in die Oberarztwohnung. Von der Frauenseite her aber waren öfter gellende, kreischende, schrille Geräusche vernehmbar. Wir Kinder wussten dann, dass eine Patientin tobte.»Sie tut wieder so, das hört bald auf.«
Mein Großvater war eine angesehene Person. Im Grunde war er ein armseliger Emigrant, ein Unterhund auf Lebzeiten, der einem schüchternen schweizerischen Anstaltsdirektor und dessen herrischer Ehefrau unterjocht war. Weil dieser Direktor, ganz im Gegensatz zu seiner extrovertierten Frau, geradezu menschenscheu war, mager und blass, ein dürftiges Exemplar Mensch zum Anschauen, kam er bei den Patienten nicht gut an. Mein Großvater aber hatte eine sonore Bassstimme, einen breiten russischen Akzent und war beliebt. Er konnte auch singen. Er war der Herr Doktor im Haus, in der feudalen riesigen Wohnung mit einem Salonzimmer, wo zwei Louis-Salongarnituren aus der Hinterlassenschaft meines Großvaters väterlicherseits standen, der ein Professor für Jurisprudenz an der Universität Bern gewesen war und zur oberen Gesellschaftsschicht gehörte. So wohnte der eine Großvater, der Unterhund, in feudalen Möbeln, die vom anderen Großvater, dem Großbürger aus Bern, stammten. Auch das trug zu seinem Ansehen bei, das er im Kanton Solothurn genoss.
Bis zu meinem zwölften Lebensjahr, als mein Großvater an seinem dritten Herzinfarkt starb, verbrachte ich zusammen mit meiner Zwillingsschwester die Weihnachtsferien gewöhnlich i...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impreesum
- Inhalt
- Vorwort
- Schizophrenie
- Heroinsucht
- Mediengesellschaft
- Gewalt
- Glücksspielsucht
- Überzeugung
- Narzissmus
- Biografie