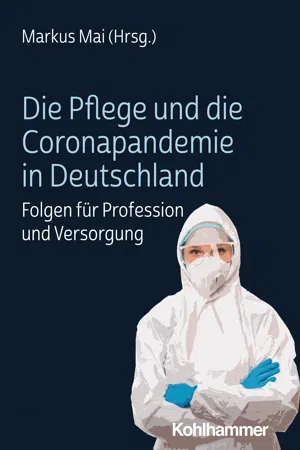![]()
Perspektiven der öffentlichen Gesundheitspflege zur Bewältigung von Gesundheitskrisen – Berufspraktische Lehren für die Versorgung vulnerabler Menschen während COVID-19
Manfred Fiedler & Daniela Schmitz
Einleitung und Fragestellung
Mit der Ausrufung der Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO 3/12/2020) und daraufhin der parlamentarischen Feststellung einer »epidemischen Lage von nationaler Tragweite« (Deutscher Bundestag 2020) im März 2020 befindet sich die Welt, Europa und Deutschland in einer gesundheitlichen Ausnahmesituation. Überraschend dürfte eine durch ein vom Tier auf den Menschen übertragenes (zoonotisches) Virus eigentlich nicht gekommen sein (Palagyi et al. 2019). Nicht nur haben drei größere Ausbrüche (SARS, MERS, Schweinegrippe) gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer pandemischen Ausbreitung eines auf das Atmungssystem, also respiratorisch wirkendes Virus hoch ist (Horby 2018). Zum anderen hat die Weltgesundheitsorganisation wiederholt auf die Notwendigkeit zur Vorbereitung (Preparedness) auf eine pandemische Ausbreitung hingewiesen (WHO 2005; Global Preparedness Monitoring Board 2019).
Wir können heute feststellen, dass die Maßstäbe, die vor der Coronapandemie an die Preparedness der nationalen Gesundheitssysteme angelegt worden sind, zu grob gewesen waren und dass Systeme, die eigentlich gut vorbereitet schienen, es letztlich nicht waren. Zwar reagieren die unterschiedlichen Regelungsebenen – supranational, national, regional, lokal und institutionell – auf die Pandemie, allerdings bestehen Zweifel, ob dies im Sinne einer hierarchisch gegliederten, aufeinander bezogenen Pandemieplanung geschieht. Die Gesundheitsreformen der letzten 25 Jahre haben zudem zu einer Zentralisierung der gesundheitlichen Leistungsplanung und -steuerung geführt. So ist etwa die Zahl der gesetzlichen Krankenkassen seit 1995 um 90 % zurückgegangen (GKV-Spitzenverband 2021), was vor allem die Aufgabe regional orientierter Kranken- und Pflegekassen bedeutete. Die kassenärztlichen Vereinigungen sind in der Regel auf Landesebene organisiert. Auf kommunaler Ebene bleibt daher als wesentlicher Handlungsträger der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) übrig.
Während chronische Erkrankungen in der Pandemie als prinzipielles Risiko angesehen werden, wird die durch die individuelle Krankheitssituation eingeschränkte Fähigkeit der Bewältigung einer Krise zu einem wesentlichen Faktor, wie sich zum einen etwa bei Ausbrüchen in Einrichtungen für Menschen mit Demenz zeigt, zum anderen aber auch in Hinsicht auf den alltäglichen Umgang mit nicht-medizinischen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung.
Der Beitrag versucht mit Fokus auf die Versorgung der vulnerablen Gruppe chronisch eingeschränkter Menschen das Verständnis der Gesundheitskrise auf dieser Basis konzeptionell zu schließen und eine Bestandsaufnahme der Bewältigung der aktuellen Gesundheitskrise vorzunehmen. Damit soll bewertet werden, wie gut die interinstitutionelle und berufspraktische Preparedness auf der kommunalen Handlungsebene ist. Was also brauchen wir, um Gesundheitskrisen aus berufspraktischer Sicht und mit Blick auf das Erleben vulnerabler Gruppen wirksam zu begegnen?
Öffentliche Gesundheitspflege – eine begriffliche Annäherung
In der aktuellen Gesundheitskrise tritt mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) ein institutioneller Akteur in den Vordergrund, der bis dahin eher ein Schattendasein geführt hat. Bisweilen ist er ein vielleicht »nervender Mitspieler«, wenn er vor allem mit seiner hoheitlichen Kraft die Einhaltung von Hygienevorschriften überwacht oder ggfs. die Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften in Krankenhäusern prüft. Hygienekontrolle, Schuleingangsuntersuchungen, amtsärztliche Untersuchungen und ähnliche Untersuchungen sind die Aufgaben, mit denen der ÖGD identifiziert wird. Diese hoheitlichen Aufgaben im Gesundheitswesen werden auch als gesundheitspolizeiliche Aufgaben bezeichnet, also die öffentliche Sicherung der Volksgesundheit.
Die wissenschaftliche Fundierung findet der öffentliche Gesundheitsdienst in der Öffentlichen Gesundheitspflege. Bereits 1869 definierte einer der deutschen Pioniere der öffentlichen Gesundheitspflege, Reclam, es als Wissenschaft, die Kenntnisse zu den »Naturbedürfnissen« der Menschen zu ermitteln, mit denen »die Leistungsfähigkeit der ganzen Bevölkerung« gesichert und gesteigert wird (Reclam 1869, S.1ff). Die öffentliche Gesundheitspflege grenzt sich damit von der prägenden patientenzentrierten Sichtweise in Medizin und Pflege ab. Die öffentliche Gesundheitspflege stellt sich dabei als Transdisziplin dar, die nach heutigen begrifflichen Maßstäben Epidemiologie, Ätiologie, Hygiene, Umweltmedizin, Sozialmedizin, Arbeitsmedizin, Familienpflege, Präventionsmedizin, Ernährungswissenschaft und mehr umfasst. Sie befasste sich also schon früh mit der Sicherung und Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Umweltverhältnisse. Unabhängig davon, aber zeitgleich entwickelte in den USA Lilian Wald Ende des 19. Jahrhunderts das Konzept der Public Health Nurse als die professionelle Verbindung zwischen den sozialen, ökonomischen und Gesundheitsbedürfnissen von vor allem armen Familien und den Leistungen, die notwendig sind, dass sie gesund werden oder bleiben (»become or stay healthy«) (Buhler-Wilkerson 1993). Öffentliche Gesundheitspflege als Wissenschaft hat also schon in ihrer Entstehung praxisimmanente multiprofessionelle und disziplinübergreifende Bezüge.
Diese sozialpflegerischen und sozialmedizinischen Bezüge, die sich wissenschaftlich und professionspraktisch sehr früh in Medizin und Pflege zeigten (Medizin als »sociale Wissenschaft« (Virchow nach Bauer 2005)), haben sich in Bezug auf die öffentliche Gesundheitspflege wenigstens in Deutschland aber nicht als prägend erwiesen. Spätestens mit der Nazidiktatur wurde aus der Sozialhygiene Rassenhygiene (Kuhn & Wildner 2020, S.16). Prinzipiell lässt sich für die Ursprungswissenschaft »Öffentliche Gesundheitspflege« eine Nähe zur Public Health feststellen. Mit Blick auf die wissenschaftliche Ruptur durch die Nazizeit spricht Rolf Rosenbrock für Deutschland daher von »New Public Health« (Rosenbrock 2001).
In dieser spielen sozialpflegerische Aspekte aber eine untergeordnete Rolle. Auch die praxisorientierte Verknüpfung mit dem Aufgabenfeld des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist nicht selbstverständlicher Gegenstand von Public Health.
Die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind im Wesentlichen landesgesetzlich geregelt. So beschreibt das ÖGD-Gesetz NRW in § 2 (Land NRW 1997) die Aufgaben mit sechs Punkten (Walter 2005):
1. Gesundheitsberichterstattung
2. Hygieneaufsicht und Infektionsschutz
3. Beteiligung an der Gesundheitsförderung, vor allem durch die Förderung der Kindergesundheit
4. Überwachung des Verkehrs mit Medikamenten
5. Gesundheitsberatung, Begutachtung
6. Überwachung der Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen
Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt bei den Überwachungsaufgaben. Die rechtliche Bezeichnung als unterste Gesundheitsbehörde macht die gesundheitspolizeiliche, also die Aufgabe staatlichen Handelns zur Gefahrenabwehr im Gesundheitswesen (Hauska 1859) deutlich. Zwar nehmen Gesundheitsämter weitere Aufgaben wahr; in NRW die Moderation der gesetzlich vorgeschriebenen Pflege- und Gesundheitskonferenzen, die Integration des sozialpsychiatrischen Dienstes, auch hier jeweils auf der Grundlage des Landesrechts (Kuhn and Wildner 2020, S.18). Es handelt sich also durchweg um Aufgaben mit gesetzlicher Grundlage, die aber in eigener Verantwortung der Kommunen wahrgenommen werden und deren Bedeutung, Durchführung und Finanzierung von Kommune zu Kommune und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist.
Wir können mit dem schon sehr frühen Verständnis die öffentliche Gesundheitspflege als Transdisziplin (Völker 2004) mit der normativen Orientierung auf die Stabilisierung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung identifizieren. Der öffentliche Gesundheitsdienst wird dabei rechtlich immer noch überwiegend auf seine staatliche Aufgabe der gesundheitlichen Gefahrenabwehr festgelegt. Die »eigenständige Wahrnehmung« (§ 1 ÖGD-G NRW) von Aufgaben im Gesundheitswesen lässt gerade mit Blick auf die Vorbereitung auf Gesundheitskrisen, die Positionierung im Gesundheitswesen weitgehend offen. Im Weiteren soll diese Positionierung mit Blick auf das Beziehungsfeld zu den professionellen Leistungserbringern und vor allem auch im Sinne eines Community-Health-Care-Ansatzes (Goodman et al. 2014) auch zu den Betroffenen und deren Angehörigen in Ihrer Lebenswelt konkretisiert werden.
Der Begriff der Gesundheitskrise
Was eine Gesundheitskrise (engl. Health Emergency) ist, scheint aktuell sehr schnell beantwortet: ein Massenanfall von Infizierten. Dieses allgemein übliche »Verständnis« orientiert sich an der Einmaligkeit bzw. Singularität und gleichzeitig der umfassenden Dimensionalität der gesundheitlichen Bedrohung.
Zwar beinhaltet diese verbreitete Deutung bereits Aspekte einer differenzierteren Kategorisierung, allerdings wird der Begriff meist nicht konkret definiert. Mit Bezug auf unterschiedliche Definitionen (Haffajee et al. 2014; Nelson et al. 2007b) lassen sich folgende Kategorisierungen vornehmen:
a) Zunächst unterscheiden wir zwischen einer öffentlichen und einer privaten oder individuellen Gesundheitskrise,
b) des Weiteren zwischen einer singulären und einer immanenten, schwelenden bzw. fortlaufend sich entwickelnden (»imminenten«) Gesundheitskrise (Herington et al. 2014),
c) und schließlich müssen wir noch unterscheiden nach dem geografischen Bezugsfeld, also ob es sich um eine globale, nationale oder regionale Gesundheitskrise handelt.
Von einer öffentlichen Gesundheitskrise (engl. Public Health Emergency) spricht man, wenn die gesundheitliche Bedrohung große Teile der Gesundheitsversorgung betrifft und diese zu überlasten droht, Burkle spricht sogar von Zerstörung (Burkle 2019). die das gesamte Gesundheits(versorgungs)system betrifft. Sie lässt sich somit auch als Gesundheitssystemkrise benennen. Demgegenüber ist eine individuelle Gesundheitskrise eine die eigene Handlungskompetenz übersteigende gesundheitliche Bedrohung. Dazu werden vor allem schwere Suchterkrankungen gezählt, aber auch schwere psychische Erkrankungen.
Die zeitliche und die regionale Begrenztheit einer öffentlichen Gesundheitskrise sind relevante Kriterien. So sind inzidentell eintretende Gesundheitskrisen zwar mit einer Wahrscheinlichkeit des Ereignens versehen, aber weder Ort noch Zeit ist vorhersehbar. Dazu zählen die gesundheitlichen Herausforderungen aufgrund eines Großschadensereignisses, z. B. eines sehr schweren Zugunglücks oder eines Flugzeugabsturzes, einer Naturkatastrophe, aber eben auch starker Infektionswellen. Während ereignisbezogene Gesundheitskrisen zeitlich begrenzt erscheinen, was nichts über die Schwere der Krise aussagt, sind immanente Gesundheitskrisen sich entwickelnde, man könnte auch sagen sich chronifizierende Gesundheitskrisen, die wissenschaftlich in Hinsicht auf Zeit und Raum und ihre Wirkungen spekuliert werden können.
Die regionale Dimension ist eine abschließende Kategorie. Sie beschreibt die Betroffenheit des Gesundheitssystems bzw. der Gesundheitssysteme von der Gesundheitskrise. Globale kontinentale, natinale oder regionale Gesundheitskrisen verlangen unterschiedliche institutionelle Akteure auf den jeweiligen Regulierungsebenen. Großschadensereignisse haben in der Regel regionale Auswirkungen, während die Ausbreitung einer (neuen) Infektionserkrankung mit hoher Inzidenz meist überregionale bis hin zu globalen Auswirkungen hat. Auch immanente Gesundheitskrisen können unterschiedliche regionale Dimensionen haben. Die Krise der Health Workforce hat in den ersten Entwicklungsphasen zunächst regionale, später nationale Auswirkungen, wie wir es bereits heute in der Primärversorgung strukturschwacher Regionen erleben (Schmacke 2013). Die zunehmende Schwäche der Antibiose durch Ausbreitung multiresistenter Keime hat in der Fortentwicklung globale Auswirkungen auf die Sicherheit der Infektionsbekämpfung (Antão and Wagner-Ahlfs 2018; Abu Sin et al. 2018).
Grundsätzlich haben alle Gesundheitskrisen Auswirkungen auf die regionalen Gesundheitssicherungssysteme. Ohne eine ausreichende Vorbereitung in den Kommunen bzw. Regionen auf potenzielle oder immanente Gesundheitskrisen droht bei einem krisenauslösenden Ereignis oder bei zunehmender Virulenz einer krisenauslösenden Struktur eine Überlastung der Gesundheitssicherungssysteme.
Preparedness als Konzept zur Bewältigung von Gesundheitskrisen
Public Health Emergency Preparedness (PHEP) wird seit dem pandemischen Auftauchen des ersten SARS-CoV 2002/2003 wissenschaftlich vermehrt diskutiert, in den USA belebten zudem die terroristischen Anschläge des 11. Septembers 2001 und des Hurrikan Katrina 2005 die politische Diskussion um das Thema »Disaster Management« (Katz et al. 2006; Lurie et al. 2006). Die wissenschaftlich-theoretischen Fortschritte blieben aber diffus, obwohl die WHO ein aktuelles Framework auflegte (WHO 2017) und zusammen mit der Weltbank aufgrund der Erfahrungen mit den Ebola-Ausbrüchen 2014–2016 das »Global Preparedness Monitoring Board« (GPMB) gründete, das die Aufgab...