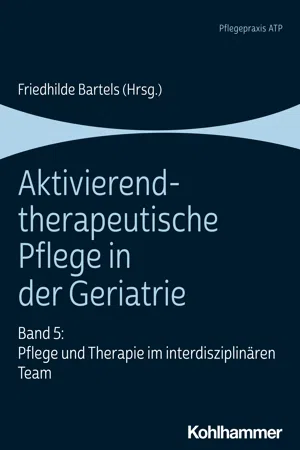![]()
IV Drei Handlungs- und Pflegeschwerpunkte: 1. Aspekte der Beziehungsarbeit
![]()
8 Angehörige in der ATP-G: Störenfriede, Besserwisser oder Mitgestalter?
Friedhilde Bartels
8.1 Einleitung
»Angehörigenbesuche [sind] als Teil der Patientenbehandlung [zu] verstehen[.] Fehlender Besuch hat negative Auswirkungen auf die Genesung« (Millich 2021, o. S.)
Alle kennen sie: schwierige Angehörige oder Patient*innen. Im Gespräch mit Pflegenden und Ärzt*innen stellt sich allerdings heraus, dass sich hinter dem Begriff »schwierig« oft ganz verschiedene Zuweisungen verbergen. Die einen meinen mit schwierig die kritischen Angehörigen, andere empfinden den Umgang mit diesen eher als leicht. Dafür empfinden Sie aggressive oder unzugängliche Menschen als schwierig.
So scheint es kein einheitliches Bild von »schwierigen Angehörigen« zu geben. Vielmehr bezeichnen wir die als schwierig, für die wir noch keinen passenden Zugang haben. Pflegende erkennen, dass der*die Angehörige keine »Schuld« hat bzw. hilflos ist und dass ihm*ihr bisher einfach das passende Werkzeug für einen erfolgreichen Umgang mit der akuten Situation fehlt.
Die Stellung von Angehörigen ist in einer Triade zu sehen: Der*die Patient*in, der*die Angehörige und der*die »Dritte« (Mitzkat 2007). Diese*r Dritte kann der*die Arzt*Ärztin sein, aber auch jeder andere Akteur im Gesundheitssystem – in unserem Falle im MPT. In dem herkömmlichen, uns vertrauten System ist es meistens das »Patient-Arzt-Angehörigen-Bezugssystem«. Angehörige können dort eine Nebenrolle spielen, aber auch den Hauptpart, wenn es um einen nicht mehr entscheidungsfähigen Patienten, z. B. in einem demenziellen Status, geht. Schließlich können Angehörige, wenn sie lange und belastet mit dem Leiden oder der Behinderung Angehöriger konfrontiert sind, selbst zu Patient*innen werden (Geisler 2007)
In diesem Artikel möchte ich mich vorrangig mit dem »Patient-Pflegende-Angehörigen-Bezugssystem« befassen. Pflegende können »99 Mal« mit den Angehörigen professionell agieren. Aber wenn beim »100. Patienten oder Angehörigen« etwas schiefgeht, ist das »schlecht« für die Gesundheit der kranken Person und deren Angehörige sowie auch für die Pflegefachkraft selbst (vgl. Haidar 2018). Es frustriert. Beschwerden sind ernst zu nehmen. Wir erhalten hier eine selektive Chance, die wir uns zunutze machen können, um etwas zu verbessern. Allerdings gibt es nicht immer etwas zu verbessern, manchmal kann nur Freundlichkeit, Gelassenheit, Zuhören und auch ein »deutliches, respektvolles Wort« der Pflegenden oder/und auch der Pflegedienstleitung helfen.
Einige erlebte Situationen:
• Mit der gerade aufgenommenen kranken Person zieht die ganze Großfamilie mit ein: Ehepartner, Kinder usw. Sie alle beschäftigen alle pflegerischen Mitarbeiter*innen der Station.
• Gestern Nacht war der Ehepartner einer Patientin auf der Station und hat die »Klingelwartezeiten« notiert.
• Anruf bei der Pflegedienstleitung: »Meine Mutter wird nicht richtig gepflegt. Sie muss alles alleine machen. Das Essen schmeckt ihr auch nicht.« Die PDL besucht die Patientin und erfährt, dass sie sich sehr wohl fühlt in der Geriatrie und sie keinen Bedarf hat, sich zu beschweren.
• »Mein Vater ist abends schon so aufgeregt, weil er sich am Morgen die Zähne selber putzen muss.«
• »Na, pflegen Sie mich mal. Und Fräulein, bringen Sie mir bitte einen Kaffee. Ich bin ja schließlich hier in einer Rehabilitation, um mich zu erholen. Die Therapien kann ich auch zu Hause in Anspruch nehmen.«
• »Hören Sie: Ich gehe zur Zeitung!«
• Angehörige verlassen die Station, wenn es Essen gibt.
• Angehörige werden aggressiver. Sie gehen hinterher, wenn die Pflegefachkraft in ein anderes Patientenzimmer geht.
Kennen Sie solche Situationen? Es geht einerseits darum, was Sie, die Pflegenden, in täglichen Situationen erleben. Andererseits geht es darum, dass häufig Strukturen, andere Berufsgruppen und auch die eigene Haltung der Pflegenden dazu beitragen, das eine angespannte Situation zwischen Angehörigen und Pflegenden entsteht.
Man liest in Internetforen Reaktionen wie: »Was sollen wir denn noch alles machen«, »Wir haben keine Zeit!« »Wir sind kein Hotel, gehen Sie wieder nach Hause« von Pflegenden, die dazu beitragen können, dass die Situationen/Konflikte eskalieren. Diese Reaktionen sind durchaus nachzuvollziehen. Aber sind solche Erwiderungen, Gegenbemerkungen oder Gegenreden tatsächlich sinnvoll? In dem Konzept ATP-G gehen wir immer auch von einer positiven Haltung gegenüber Patient*innen und Angehörigen aus. Und hier ist im übertragenen Sinne durchaus nicht gemeint: »Der Kunde hat immer Recht.«
8.2 Professionell Pflegende
Für die Berufsbezeichnung von professionell Pflegenden gibt es derzeit viele verschiedene Begriffe. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Pflegefachkräften (3-jährig Examinierte mit und ohne Studium) und Pflegehelfern (mit und ohne Ausbildung). Die Bezeichnungen dafür sind Krankenpflegehilfe und Pflegehelfer*innen. Durch diese vielen unterschiedlichen Bezeichnungen, die auch auf vielen Geriatrien vertreten sind, sind viele Patient*innen und ihre Angehörigen verunsichert und wissen nicht, mit wem und vor allem mit welcher Qualifikation sie es zu tun haben. Die meisten sagen in diesem Kontext »Schwester« und sind dankbar, wenn sich eine Fachkraft auch so bei ihnen vorstellt. Das bedeutet für die Pflegenden auch immer, dass Informationen oder Gesprächswünsche an die adäquate Pflegeperson weitergegeben werden müssen.
Motive für die Berufswahl von Pflegenden sind lt. einer Studie von Jenull et al. (2008) in Wien und Kärnten, die Liebe und der Kontakt zu Menschen, »helfen wollen«, Interesse und ökonomische Gründe. Vorrangig sind dabei die sozialen Aspekte für die Berufswahl und Berufsausübung entscheidend. Professionell Pflegende haben trotz ihrer starken sozialen Motivation die finanziellen und ökonomischen Aspekte zu berücksichtigen. Die Anforderungen der Gesundheitspolitik (DRG), der Kostenträger und Prüfinstitutionen (Medizinischer Dienst) sind zu erfüllen, und die gesetzlichen Vorgaben reglementieren die Leistungen der professionell Pflegenden. Nicht nur die neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern in der Geriatrie auch die der anderen Berufsgruppen im MPT sollen berücksichtigt und umgesetzt werden, obwohl weder für die Auswertung dieser Erkenntnisse noch für deren Umsetzung genügend und qualifizierte Pflegende zur Verfügung stehen. Die Personaluntergrenzen in der Geriatrie sind für eine Aktivierend-therapeutische Pflege für Patient*innen und Angehörige unzureichend!
8.3 Belastungen führen zu Überlastungen
Zu unterscheiden ist zwischen dem objektiven und dem subjektiven Belastungsempfinden der Pflegenden. Zu dem objektiven Belastungsempfinden zählt der Umfang und die Dauer der Pflege, die Schwere der Erkrankung bzw. für die Pflegenden die Ressourcen und Probleme in der Bewältigung der Alltagskompetenzen des Patienten. Der Stellenplan und die Notsituation in der Pflege etc. tun ihr Übriges. Zu berücksichtigen sind hier auch die noch zusätzlich zu bewältigenden Aufgaben/Verantwortungen in der Familie der Pflegenden.
Subjektiv werden Belastungen aber oft deutlich anders – verstärkt – wahrgenommen. Sie hängen von den persönlichen
Bewältigungs- und Bearbeitungsstrategien der Pflegeperson ab, also davon, wie sie mit der Pflegesituation umgeht oder im Leben grundsätzlich mit schwierigen Situationen umgegangen ist. In der Pflege, eben auch in der Geriatrie, werden immer mehr ältere Pflegende beschäftigt. (vgl. Staak & Urban o. J.) Natürlich spielt das Lebensalter eine Rolle, jedem ist klar, dass Pflegehandlings besser in jüngerem Alter bewältigt werden können. Mit zunehmendem Alter zeigen sich bei den Pflegenden häufig viele eigene Einschränkungen (
Kap. 3). Die individuelle psychische und physische Belastbarkeit spielt selbstverständlich eine Rolle. Aus Erfahrung kann ich schreiben, dass die älteren Pflegenden sich dennoch einer großen Verantwortung bewusst sind. Diese möchten sie auch gerne an Jüngere weiterreichen (
Kap. 2).
Die Art der Beziehung zum Erkrankten macht eine Pflege ebenfalls subjektiv einfacher oder aber belastender. Zufriedene Patienten sind pflegeleichte Patienten. Sie sind motivierter und arbeiten entsprechend ihrer noch vorhandenen Ressourcen mit. Also habe ich ein gutes – von Liebe und Zuneigung geprägtes – Verhältnis zum Erkrankten oder ein vorbelastetes Verhältnis mit vielen ungelösten Problemen aus der eigenen Vergangenheit, die in der »Krankheitssituation« zutage treten? Schlussendlich sind auch Art und Erreichbarkeit von Hilfs- und Unterstützungsangeboten, z. B. Stationshilfen oder/und Hilfsmittel (vgl. Eckardt 2019), wesentliche Faktoren für ein Belastungsempfinden. (vgl. Staak & Urban o. J.)
8.4 Pflegende befinden sich oft in einer herausfordernden »Sandwich-Funktion«
Pflegende befinden sich nicht nur in der oben beschriebenen Reglementierung, sondern auch in einer »Sandwich-Funktion« zwischen der Geschäftsleitung, Ärzt*innen, manchmal auch Therapeut*innen, pflegenden Kolleg*innen, den Patient*innen und den Angehörigen.
• Pflegende werden oft übergangen, wenn es darum geht, ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Team kundzutu...