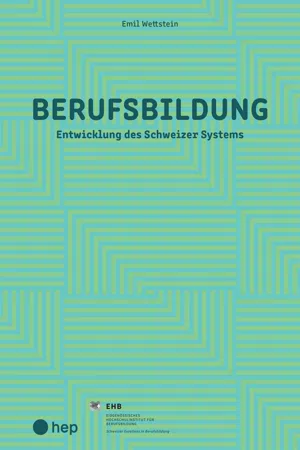![]()
Vertiefung
01 Ausbildungsverhältnisse in den Zünften − Vorläufer der Berufslehren
Die Zünfte (Vereinigungen von Meistern) sind aus Bruderschaften (Meister und Gesellen) hervorgegangen. Oft handelt es sich dabei um Gründungen kirchlicher Autoritäten im 11. Jahrhundert. Es sind berufliche Fachverbände, die die wirtschaftlichen Belange ihres Handwerks regeln; gleichzeitig sind es Gemeinschaften, die sich der sozialen Probleme ihrer Mitglieder annehmen und ausserdem Geselligkeit und Brauchtum pflegen. (Weber 1988, 24 ff.)
Insbesondere regelten sie auch die Ausbildung des Nachwuchses. Es gab sie in vielen Städten und teilweise auch in Marktflecken, unter anderem in Aarau, Bulle, Basel, Freiburg, Konolfingen, Genf, Murten, Luzern, Zürich. (Landolt 1977, 53) Bruderschaften, die auch die Ausbildung von Lehrlingen regelten, gab es u. a. in Bern.
Neben den Zünften existierten auch Gemeinschaften von Gesellen und berufsständische Organisationen von Händlern, Advokaten etc. [1350a 1711a]
Blütezeit
Aufbau und Merkmale der Zünfte unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. Die Berufsausbildung weist im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit oft folgende Eigenschaften auf (nach Landolt 1977):
• Die Ausbildung findet im Betrieb eines Meisters statt, der der Zunft angehören muss, und wird von den Zünften geregelt und überwacht, die teilweise auch Lehrgeld, Lohn und Mindestdauer der Lehre festlegen.
• Der Jugendliche wird mit 14 bis 16 Jahren in die Lehre aufgenommen und hat ein Lehrgeld zu entrichten. Ist er zu arm dazu, so kann er dieses in einer verlängerten Lehre abverdienen. In manchen Städten bestehen auch Fürsorgeeinrichtungen, die das Lehrgeld ausrichten.
• Die Lehre beginnt mit einer in der Regel 14 Tage dauernden Probezeit und mit dem «Aufdingen», der offiziellen Vorstellung des Lehrlings in der Zunftstube.
• Ein schriftlicher Lehrvertrag ist nur in der Westschweiz (Freiburg, Genf) üblich. Aus der Deutschschweiz sind nur wenig schriftliche Lehrverträge bekannt.
• Die Lehrzeit beträgt in der Regel zwei bis vier Jahre, in Ausnahmefällen zwischen drei Monaten und dreizehn Jahren. (Ebd. 122 ff.)
• Der Lehrling lebt in der Hausgemeinschaft des Lehrmeisters, der die väterliche Erziehungsgewalt ausübt und für die Ausbildung verantwortlich ist. Er erhält das Lehrgeld, hat aber für Kost, Logis und Bekleidung zu sorgen und richtet dem Lehrling in der Regel einen bescheidenen Lohn aus.
• Der Lehrling hat für den Meister zu arbeiten. Die Übernahme «berufsfremder» Arbeiten ist teilweise üblich, teilweise durch Zunftbeschlüsse stark eingeschränkt.
• Ab dem 16. Jahrhundert werden durch die Zünfte Lehrabschlussprüfungen abgenommen, die im 18. Jahrhundert allgemein üblich werden und zu dieser Zeit in der Ausführung eines Probestückes in der Werkstatt eines fremden Meisters bestehen.
• Seit dem 14. Jahrhundert wird die Ausbildung in einer Wanderschaft fortgesetzt, ein Brauch, der im 15. und 16. Jahrhundert zur Regel wird. Sie dauert zwischen einem und sechs Jahren und ist die einzige Fortbildungsmöglichkeit, die dieses System kennt.
• Nach der Wanderschaft kann sich der Geselle um eine Aufnahme in die Zunft bewerben. Dazu gehört als Beweis der beruflichen Tüchtigkeit die Herstellung eines Meisterstücks (ab 16. Jahrhundert). [1104a; 1350a; 1680a]
Ziel der Ausbildung ist neben der fachlichen Qualifizierung die Sozialisation in den Berufsstand (Müllges 1979, 15). In der Werkstatt und im Meisterhaushalt, bei der Arbeit und bei der Feier, überall hat sich der Lehrling an die Regeln der Zunftgemeinschaft zu halten. Das handwerkliche Können und die sozialen Einstellungen werden vorzugsweise imitativ (durch Nachahmung) erlernt, das berufliche Wissen aus beiläufigen Erläuterungen gesammelt.
Niedergang
Nach und nach wird die Aufnahme in die Zünfte beschränkt und erschwert, werden Lehrzeit und Wanderschaft verlängert oder das Lehrgeld massiv erhöht, um die Zahl der Ausgelernten (Konkurrenten) zu senken. Produktionsprogramm, Arbeitsweise und eingesetzte Hilfsmittel werden reglementiert. Änderungen bei den Produktionstechniken werden durch Verbote verunmöglicht.
Nicht Wettbewerb ist gefragt, sondern das Vermeiden von Konkurrenz. Das von der Nachfrage generierte Arbeitsvolumen soll gleichmässig verteilt werden, damit alle Meister überleben können. Die Zünfte werden zu «Bewahrungsanstalten für die Mittelmässigkeit». (Bendel 1883, 3)
Diese Abschottung lässt sich auf die Länge nicht aufrechterhalten. Sie verhindert jeden Fortschritt und jede Anpassung an veränderte Verhältnisse. Dabei sinkt durch die Industrialisierung die Nachfrage nach den Produkten des Gewerbes. Die Konkurrenz nimmt zu, umso mehr als das 18. und 19. Jahrhundert ein Zeitalter intensiven Strassenbaus ist, was den Güteraustausch über grössere Strecken ermöglicht. [1740a 1883e]
Die quantitative Bedeutung der Lehrlingsausbildung in den Zünften wird oft überschätzt.
Es ist immer eine Minderheit gewesen, die eine Lehrlingsausbildung im beschriebenen Sinne durchlaufen konnte: Mädchen hatten dazu keine Gelegenheit, ausser im 18. Jahrhundert in Textilberufen. Unehelich geborene Jugendliche sowie Jugendliche aus weniger angesehenen, unfreien und/oder armen Familien wurden nur ausnahmsweise zugelassen. Die Landbevölkerung (vgl. Renfer 1982, 66) war weitgehend ausgeschlossen. Meistersöhne wurden massiv bevorzugt.
Und vor allem: Die grosse Mehrheit der Bevölkerung war in der Landwirtschaft tätig, nicht in einem Handwerk.
Weitere Träger von beruflicher Ausbildung waren die Klöster sowie Herrschaftssitze. Auch die Akademien und Universitäten bereiteten auf Berufstätigkeiten vor. [900a 1460b]
Weiter entstehen neue Gewerbe, die nicht der Zunftordnung unterstellt sind, in Bern beispielsweise Maler, Gipser, Perückenmacher. Nach und nach lösen sich ländliche Gebiete vom Diktat der Städte, was die Ansiedlung von Handwerkern ermöglicht, die keiner Regulierung unterstehen. Sie verkaufen ihre Produkte auf Märkten und bilden so eine Konkurrenz zu den Betrieben in den Städten.
In andern Gewerben bildeten sich grössere Zusammenschlüsse von Arbeitenden, nach französischem Vorbild geschaffene Manufakturen und später Industriebetriebe. Die Obrigkeit fördert die Ansiedlung solcher Betriebe, um Arbeit und damit Brot zu beschaffen und die Armut zu bekämpfen. [1750b]
Der Zusammenbruch der alten Eidgenossenschaft 1798 im Gefolge der Französischen Revolution führt zu einem Zusammenbruch des Zunftwesens, denn die Gesetzgebung der Helvetik förderte die Handels- und Gewerbefreiheit. [1791a; 1776a; 1848d]
Allerdings wird das Rad bald zurückgedreht. Mit der Mediationsakte und ab 1815 mit der Restauration leben die Zünfte in einigen Städten wieder auf als Organisationen mit sozialen und gesellschaftlichen Funktionen, in der Regel ohne wirklichen Einfluss auf die berufliche Ausbildung. [1798a; 1877c]
Im Gegensatz dazu entsteht in Frankreich aus einigen Zünften ein «höchst bedeutungsvoll nachwirkender Organismus des kunstgewerblichen Unterrichtswesens, dessen Wirksamkeit die kunstgewerbliche und kunstindustrielle Produktion Frankreichs ihre bereits länger denn ein Jahrhundert andauernde Überlegenheit zu einem grossen Theile verdankt». (Bendel 1883, 1) Bis heute hat sich in Frankreich hoch entwickeltes Kunsthandwerk in der Luxusindustrie erhalten. Manche Handwerker gehen auch nach wie vor auf Wanderschaft, insbesondere die Mitglieder der französischen Handwerksorganisation «Les Compagnons du Devoir et de Tour de France». (www.compagnons-du-devoir.com [29. 11. 2019])
02 Entwicklung der Volksschule
Voraussetzung für die berufliche Bildung ist das Beherrschen von Basiskenntnissen, mindestens in den Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen, und deshalb ein Schulsystem, das grossen Teilen der Bevölkerung deren Erwerb ermöglicht. Deshalb ist die Entwicklung der Volksschule von grosser Bedeutung für die Entwicklung der Berufsbildung.
Reformation und Aufklärung als Triebkräfte
Im 16. Jahrhundert ist es die Reformation, die sich für die Bildung der Bevölkerung einsetzt, damit diese die Bibel lesen kann. Die katholischen Orte ziehen nach entsprechenden Beschlüssen des Konzils zu Trient (1545−1563) nach.
Im Zusammenhang mit der Aufklärung beginnt Ende des 18. Jahrhunderts eine neue Diskussion über die Bildung der breiten Bevölkerung. Die Einführung eines Obligatoriums, wie es in der Helvetik (1798−1803) vorgesehen war, kommt vorerst nicht zustande. Erst die Pariser Julirevolution bringt 1830 den Durchbruch: In vielen Kantonen werden konservative Regierungen durch liberale ersetzt, denen die Volksbildung als Basis für eine aktive Beteiligung an demokratischen Entscheidungsprozessen ein grosses Anliegen ist. In den 1830er-Jahren wird in vielen Kantonen die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Im Kanton Zürich beispielsweise wird 1832 ein Schulgesetz erlassen, mit dem Zweck, «die Kinder aller Volksclassen nach übereinstimmten Grundsätzen zu geistig thätigen, bürgerlich brauchbaren und sittlich-religiösen Menschen» zu bilden. Der Besuch der «Alltagsschule» (Vollzeit) wird für alle Kinder vom sechsten bis zum zwölften Altersjahr obligatorisch, ergänzt durch eine drei Jahre dauernde Repetierschule (Teilzeit). In den katholischen Kantonen geht es etwas länger. Im Kanton Appenzell Innerrhoden wird der Schulbesuch erst 1858 obligatorisch. (Rothenbühler 2010, 169) [1883j]
Die Bundesverfassung bringt das Obligatorium des Schulbesuchs
Die erste Bundesverfassung, beschlossen 1848, überlässt die Ordnung des Schulwesens weiterhin den Kantonen. Immerhin wird...