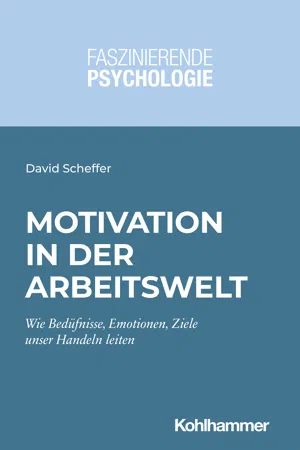![]()
1 Einführung
Motivation ist ein Begriff aus der Alltagssprache, der auf das lateinische Verb movere (bewegen, antreiben) zurückgeführt werden kann. Motivation steht also für Bewegung, was immer auch etwas mit Energie zu tun hat. Aber diese Energie muss auch eine Richtung haben, wenn wir von Motivation sprechen wollen. Motivation gibt uns also Energie und Richtung, deshalb ist sie für uns so wertvoll. Wir brauchen Motivation dringend, auch und gerade in der Arbeitswelt. Wie Motivation entsteht und qualitativ gestaltet wird, damit beschäftigt sich dieser Band.
Dabei werden auch große philosophische Fragen gestreift wie z. B. die nach der Qualität von Motivation: Die Richtung der Motivation kann zu einem motivspezifischen Anreiz hingehen, sie kann aber auch weg von etwas Schädlichem verlaufen (McClelland, 1987). Es gibt also Annäherungs- und Vermeidungsmotivation. Erstere ist auf Belohnungen bzw. Anreize ausgerichtet, letztere auf die Vermeidung von Bestrafung bzw. auf das, was Skinner (1982) mit negativer Verstärkung gemeint hat. Eine Strafe zu vermeiden bzw. eine negative Emotion zu dämpfen (vgl. Kuhl, 2001) stellt nach Skinner eine mächtige Belohnung dar, die das Verhalten von Menschen in der Arbeitswelt seit jeher stark beeinflusst. Kahneman (2012) hat in diesem Zusammenhang auch von der motivierenden Kraft der Verlustaversion geschrieben – wenn etwas Negatives nicht eintritt oder abgewendet werden kann, dann verstärkt dies den Staus Quo, was eine wichtige Erklärung dafür ist, dass Menschen so resistent gegenüber Veränderungen sind bzw. erst andauernde negative Erfahrungen zu einer signifikanten Veränderung der Gewohnheiten führen. Wir werden uns also auch den Fragen stellen, ob wir Motivation in der Arbeitswelt qualitativ so gestalten können, dass sie positive Anreize anstrebt, statt Bestrafung zu vermeiden, und dass die Motivation von innen, aus den eigenen Bedürfnissen und Motiven herrührt, statt von außen bzw. extrinsisch bestimmt zu sein.
Lewin (1926) hatte sich die Repräsentationen dieser Annäherungs- und Vermeidungsgradienten der Motivation als eine Art psychologisches Feld vorgestellt, das durch Vektoren aufgespannt wird. Das war für die damalige Zeit erstaunlich weitsichtig. Heute wissen wir, dass sich Motivation im Gehirn entlang neuronaler Zellverbände abspielt, die räumlich sowohl horizontal als auch vertikal verlaufen. Vertikale »Vektoren« stammen aus den evolutionär alten, tiefergelegenen Schichten des Gehirns, bspw. im Hirnstamm und im limbischen System, die insbesondere Schultheiss (2008; 2013) für Motive nachgewiesen hat. Sie werden von höher gelegenen kortikalen Zentren empfangen, teilweise gehemmt, teilweise verstärkt. Sind solche verstärkenden Annäherungs- und hemmenden Vermeidungsvektoren etwa gleich stark, dann kann es passieren, dass die Person sich entweder gar nicht mehr bewegt oder aber, wie der Esel von Buridian, zwischen zwei Heuhaufen verhungert, weil sie sich nicht entscheiden kann, welcher attraktiver ist. Wenn sich zwei oder mehrere solcher Vektoren im psychologischen Feld gegenseitig auslöschen, und das kann auch horizontal zwischen den beiden Hemisphären des Gehirns geschehen, dann tendiert die gerichtete Energie bzw. Motivation gegen Null. Diesen Zustand hat Kuhl (1994; 2001) als Lageorientierung bezeichnet.
Die damit verbundene Unfähigkeit, sich zwischen Alternativen zu entscheiden, kann unterschiedliche Ursachen haben. Manche Menschen haben keinen guten Zugriff auf ihre in den tiefen Schichten des Gehirns repräsentierten Bedürfnisse, Motive und Emotionen, so dass ihnen nichts wirklich dringlich erscheint, sie also antriebslos sind. Andere haben diesen Zugang zwar, aber sie finden keine Verbindung zu ihrer intuitiven Handlungssteuerung, können ihre Antriebe also nicht in Handlung umsetzen. In beiden Fällen ist gerichtete Energie nicht möglich. Dieser Zustand mangelnder Motivation ist gefährlich und gilt als eine wichtige motivationale Ursache für die Entwicklung einer Depression, die wir als eine Art Nullpunkt der Motivation auffassen können (Kuhl & Helle, 1986).
Aber nicht nur sehr geringe Motivation ist für Einzelne und Organisationen schädlich, sondern auch zu viel Motivation. Bereits 1908 haben Yerkes und Dodson erkannt, dass extreme Erregung bzw. Energie die Performanz motivationaler Prozesse verringert, Motivation und Performanz also in einer umgekehrt U-förmigen Beziehung zueinanderstehen, die der Normalverteilung ähnelt.
Unter Motivation verstehen wir in diesem Buch also gerichtete Energie von Menschen bei der Arbeit und in Organisationen, deren Intensität von sehr gering bis sehr hoch variieren kann, wobei das adaptive Optimum in der Regel im mittleren Bereich der Verteilung liegt. Mit der Methode und den Abbildungen des Wertequadrats, das auf Aristoteles und Schulz von Thun (2002) zurückgeht, werden wir diesen Umstand, dass insbesondere Übermotivation sehr negative Folgen haben kann, immer wieder an konkreten Beispielen verdeutlichen. Vieles, was dazu zu sagen sein wird, lässt sich auch sehr gut auf private Aspekte des Lebens übertragen, aber der Fokus soll hier klar auf gerichtete Energie in der Arbeitswelt gelegt werden.
Motivation muss nicht immer im Verhalten offensichtlich sein. Sie kann sich auch sehr subtil bspw. im mimischen Ausdruck und sogar in nicht beobachtbaren inneren Vorgängen im Gehirn ausdrücken, wenn etwa aktivierende und hemmende Vektoren bzw. Nervenverbände gegeneinander um Einfluss auf das Verhalten wetteifern. Heckhausen und Heckhausen (2018) definieren daher den Prozess von der Wahrnehmung des Bedürfnisses bis zu dessen Erfüllung durch Handeln als Motivation und postulieren, dass Handlungen dann am wahrscheinlichsten sind, wenn das Produkt von der Erwartung, die Handlung umsetzen zu können, und der Wert der Handlung maximal sind. Aber nicht immer muss dieser Prozess schon abgeschlossen sein, so dass wir ihn einfach im Handeln der Akteure beobachten können. Dennoch wollen wir das Phänomen Motivation in diesem Buch aus einer empirischen Perspektive beleuchten, was bedeutet, dass wir Motivation im Verhalten beobachten, durch Tests messen und durch Befragungen erkunden können. Dass die drei Komponenten dieses »diagnostischen Dreiecks« (Schuler, 2002) nicht immer sehr hoch untereinander korrelieren müssen, gehört zum komplexen Phänomen der Motivation dazu. Dennoch wird in diesem Buch viel Wert darauf gelegt, dass die Verfahren für die Diagnostik von Motivation in ihrer Qualität kontrolliert und optimiert werden können, und zwar nach Kriterien, welche sich auch in anderen Bereichen der Diagnostik bewährt haben (Kersting 2006). Dazu gibt es ein eigenes kurzes Kapitel, das interessierte Leserinnen und Leser auf die Möglichkeit der Nutzung von Modellen verweist, die auf Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz beruhen.
Zunächst wollen wir uns der Definition von wichtigen Begriffen zuwenden. Wir wollen Motivation abgrenzen können von häufig in ähnlichen Kontexten oder sogar synonym verwendeten Begriffen wie Volition und Lernen. Auch wollen wir den Unterschied zwischen Motivation und Motiven, Bedürfnissen und Emotionen klären. Als Advanced Organizer soll die Persönlichkeits-System-Theorie (PSI-Theorie, Kuhl, 2001) eingeführt werden. Die PSI-Theorie verschafft einen Überblick über Begriffe, Bilder, Grafiken, Strukturelemente und Prozesse der Motivation, wie sie bspw. im Rubikon-Modell der Handlungssteuerung später ausführlich dargestellt wird.
Zum Schluss werden wir uns ausgewählten Anwendungsfeldern zuwenden. Ich denke, die Implikationen einer rein auf motivationspsychologischen Gesetzmäßigkeiten beruhenden Betrachtungsweise sind überraschend und mögen teilweise sogar radikal anmuten. Dies gilt zumindest für die Themen Vergütung, Veränderungsmanagement, Führung sowie Verkauf und Marketing. Da Motivation an sich betrachtet weder gut noch böse ist, allerdings an beiden Enden der Normalverteilung eine verheerende Wirkung auf Individuen, Organisationen und ganze Gesellschaften haben kann, bedarf es ganz am Schluss noch eines Kapitels zum Spannungsfeld Motivation und Ethik.
Bei allen Kapiteln werden zu Beginn Lernziele formuliert und am Ende weiterführende Literatur, in der Sie diese Themen weiter vertiefen können. Bei der Auswahl der Literatur habe ich darauf geachtet, dass sie auf der einen Seite einen Überblick über die Historie der Motivationsforschung, beginnend mit dem großen Werk von Darwin 1859, liefert, andererseits auch viel aktuelle Literatur enthält, wo möglich auch Metaanalysen, die die empirische Evidenz vieler Studien zusammenfasst.
1.1 Motivation: Definition und Abgrenzung von anderen Begriffen
Lernziele
Sie haben nach dem Lesen von Kapitel 1.1 den Unterschied zwischen den folgenden Begriffen verstanden und Praxisbeispiele kennengelernt.
1. Motivation versus Volition,
2. Motivation versus Lernen,
3. Motivation versus Motive,
4. Bedürfnisse versus Motive,
5. Motive versus Emotionen.
Motivation äußert sich in sehr unterschiedlicher Weise. Mal ist sie deutlich im Verhalten sichtbar, mal äußert sich Motivation aber auch still und von anderen unbemerkt, wobei sich auch diese subtilen Erscheinungsformen der Motivation in Form von Emotionsausdrücken im Gesicht, in Erregungszuständen des Gehirns und in Lernvorgängen messen ließe. Trotz der unterschiedlichen Erscheinungsformen von Motivation gibt es eine allen Formen der Motivation gemeinsame Definitionsgrundlage, die Bischof (1985) und darauf aufbauend Scheffer und Kuhl (2006) vorgeschlagen haben. Lebewesen sind motiviert, wenn sie eine Abweichung eines angestrebten Zustandes, auch Soll-Wert genannt, von einem aktuellen Zustand oder Ist-Wert wahrnehmen und daraufhin durch gerichtete Energie versuchen, diese Diskrepanz zu beseitigen. Motivation ist also das Streben nach einem Gleichgewichtszustand aus inneren Bedürfnissen und äußeren Anreizen, was Murray (1938) als needs und presses bezeichnet und damit den starken Einfluss von Umwelteinflüssen auf Bedürfnisse und Motive betont hat. Die Umwelt erzeugt deswegen einen so starken Druck auf das Individuum, weil Abweichungen vom inneren Gleichgewichtszustand, den Cannon (1932) Homöostase nannte, sogar tödlich enden können und daher zum Einsatz von gerichteter und ausdauernder Energie führen müssen, bis das Lebewesen das Gleichgewicht bzw. die Homöostase wiederhergestellt hat.
Motivation kann als Diskrepanz zwischen einem aktuell wahrgenommen Ist-Zustand eines Organismus und dem wahrgenommenen Soll-Zustand definiert werden, wobei letzterer sich aus den Bedürfnissen, Motiven, Zielen und Werten bewusst oder unbewusst ableitet.
Für Bedürfnisse wie Hunger und Durst leuchtet die Dringlichkeit von Soll-Zuständen unmittelbar ein, denn unbefriedigt endet die Ist-Soll-Diskrepanz für den Organismus tödlich. Aber auch psychologische Bedürfnisse, insbesondere Motive, die unbefriedigt bleiben, können tödlich enden. Das zeigen die traurigen Schicksale von Kindern aus Heimen, die zwar versorgt wurden, aber keine affektive Bindung bekamen und letztlich daran starben, worauf als Erster Harlow aufmerksam gemacht und mit Experimenten mit kleinen Affen auch den empirischen Nachweis gebracht hat: Ohne Wärme und Nähe verkümmern und sterben unsere nächsten Verwandten (Harlow, 1958). Das Gleiche gilt für junge Ratten (Hofer, 1987; 1990). Primäre Bezugspersonen befriedigen bei vielen Säugetieren elementare, physiologische und soziale Bedürfnisse, wozu auch Körperkontakt und körperliche Wärme gehören, und unterstützen den Nachwuchs so in der Aufrechterhaltung der Homoöstase.
Dass auch ein unbefriedigtes Motiv nach Kontrolle tödlich enden kann, hat Seligman (1999) in seinem Lebenswerk empirisch demonstriert: Sein Konzept der erlernten Hilflosigkeit besagt, dass Lebewesen, wie z. B. Hunde, in einen letztlich tödlichen Zustand tiefer Depression verfallen können, wenn sie ihre Umwelt nicht mehr kontrollieren, weil sie keinerlei Kontingenz mehr zwischen eigenen Handlungen und Erfolgen erkennen können. Das Bedürfnis nach Kontrolle spielt sowohl beim Leistungs- als auch beim Machtmotiv eine Schlüsselrolle, da durch den Erwerb von Kompetenzen und den Einfluss auf Ressourcen das Überleben gesichert werden kann.
Es gibt klare empirische Hinweise, dass die Kontrollmotive (Leistungs- und Machtmotiv) sich erst dann voll entwickeln können, wenn zuvor das Bindungsmotiv befriedigt wurde (Ainsworth, 1979). Bleibt die Bindung unsicher, dann kann das Kind auch nicht so mutig explorieren, erweitert dadurch weniger seine Kompetenzen und kann dadurch auch nicht autonom werden (Bischof, 1985).
Nach Damasio, Tranel und Damasio (1991) helfen bei der Ausrichtung des Verhaltens somatische Marker bzw. Emotionen, die den Gesamtzustand der Homöostase des Körpers repräsentieren und darüber informieren, welche Bedürfnisse und Motive die größte Dringlichkeit haben. Wie McClelland (1987) erkannt hat, bedeutet Motivation daher die Allokation von Zeit und Energie zwischen verschiedenen Lebensbereichen. Eine sehr treffende Definition von Motivation in diesem Sinne findet sich bei Rheinberg und Vollmeyer (2012).
Rheinberg und Vollmeyer (2012, S. 15) definieren Motivation als »aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand.«
Der Begriff Motivation wird oft im Zusammenhang mit anderen Begriffen verwendet, die sich zum Teil nicht so einfach voneinander abgrenzen lassen. Bspw. prägten...