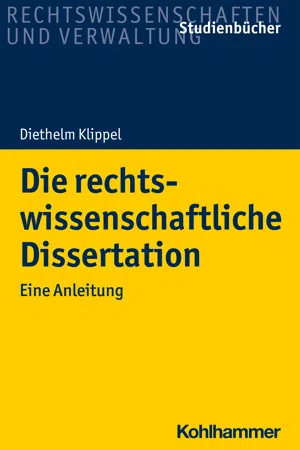
eBook - ePub
Die rechtswissenschaftliche Dissertation
Eine Anleitung
Diethelm Klippel
This is a test
Condividi libro
- 102 pagine
- German
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Die rechtswissenschaftliche Dissertation
Eine Anleitung
Diethelm Klippel
Dettagli del libro
Anteprima del libro
Indice dei contenuti
Citazioni
Informazioni sul libro
Das Buch behandelt Fragen und Probleme rund um die Arbeit an einer rechtswissenschaftlichen Dissertation, von der Themensuche über die Ausarbeitung bis hin zur mündlichen Prüfung und zur Publikation. Hinweise zum methodischen Vorgehen finden sich ebenso wie Ratschläge zur Gestaltung der Formalien der Dissertation und zum rechtswissenschaftlichen Schreiben. Zahlreiche Beispiele veranschaulichen häufig vorkommende Fehler und Ungeschicklichkeiten, und prägnant formulierte Empfehlungen fördern die erfolgreiche Arbeit an einer rechtswissenschaftlichen Dissertation.
Domande frequenti
Come faccio ad annullare l'abbonamento?
È semplicissimo: basta accedere alla sezione Account nelle Impostazioni e cliccare su "Annulla abbonamento". Dopo la cancellazione, l'abbonamento rimarrà attivo per il periodo rimanente già pagato. Per maggiori informazioni, clicca qui
È possibile scaricare libri? Se sì, come?
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui
Che differenza c'è tra i piani?
Entrambi i piani ti danno accesso illimitato alla libreria e a tutte le funzionalità di Perlego. Le uniche differenze sono il prezzo e il periodo di abbonamento: con il piano annuale risparmierai circa il 30% rispetto a 12 rate con quello mensile.
Cos'è Perlego?
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego supporta la sintesi vocale?
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Die rechtswissenschaftliche Dissertation è disponibile online in formato PDF/ePub?
Sì, puoi accedere a Die rechtswissenschaftliche Dissertation di Diethelm Klippel in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Law e Legal Education. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Kapitel 1:Das Thema der Dissertation
I.Themensuche
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, an ein geeignetes Dissertationsthema zu gelangen. Entweder der Betreuer bzw. die Betreuerin stellt das Thema, oder der Doktorand bzw. die Doktorandin sucht sich das Thema selbst aus. Die Vor- und Nachteile der beiden Wege liegen auf der Hand: Wird das Thema vorgegeben, so spricht einiges dafür, dass es als Dissertationsthema geeignet ist. Aber möglicherweise verspürt der Doktorand bzw. die Doktorandin keine große Lust, das Thema zu behandeln. Schlagen die Promovierenden selbst das Thema vor, so ist dies positiv zu sehen, da sie wahrscheinlich motiviert sind. Aber es bedarf der Überprüfung, ob es als Dissertationsthema geeignet ist, und häufig bedarf es der Umformulierung.
Allerdings gibt es Möglichkeiten zwischen diesen beiden Extremen. Bei einer guten Betreuung sollte kein bestimmtes Thema vorgegeben werden, sondern es sollte – vielleicht anhand einer Liste – besprochen werden, welches Rechtsgebiet den Interessen des Doktoranden bzw. der Doktorandin entspricht und welche geeigneten Themen vorhanden sind. Möglicherweise schlägt der Betreuer bzw. die Betreuerin einige Themen zur Auswahl vor. Dann sollte man allerdings nicht lange recherchieren, welches Thema am meisten zusagt, sondern schnell entscheiden. Wenn man ein eigenes Thema suchen will oder muss (einige Betreuer bzw. Betreuerinnen verlangen, dass ein Thema vorgeschlagen wird), bestehen mehrere Anknüpfungsmöglichkeiten. So kann das Thema einer bereits angefertigten Seminar- oder einer Abschlussarbeit erweitert und zu einer Dissertation ausgearbeitet werden. Ein Problem in der Rechtsprechung oder eine Gerichtsentscheidung kann der Auslöser für ein Dissertationsthema sein. Allerdings reicht die bloße ausführliche Analyse etwa eines BGH-Urteils nicht: Eine Urteilsanmerkung ist keine Dissertation. Als Anregung für eine Dissertation können ein Aufsatz oder mehrere Aufsätze dienen, da diese ein Thema nicht so ausführlich und vertieft behandeln können wie eine Dissertation. Schließlich kann man überlegen, ob aus eigenen Erfahrungen in der Praxis ein Dissertationsthema gewonnen werden kann. Aber Vorsicht: Ein langer Anwaltsschriftsatz ist keine Dissertation. Am Ende der Überlegungen steht die Formulierung eines Arbeitsthemas (dazu unten II.).
Häufig stellt sich die Frage, was zu tun ist, wenn die Literaturrecherche ergibt, dass zu dem gewählten Thema oder zu einem ähnlichen Thema bereits eine Dissertation vorliegt. Das bedeutet nicht in jedem Fall, dass das Dissertationsprojekt aufgegeben werden muss. Die bereits publizierte Arbeit kann veraltet sein, insbesondere dann, wenn sich die einschlägige Rechtslage verändert hat. Oder die Forschungsfrage ist bei näherem Zusehen anders gelagert. Oder die methodische Herangehensweise unterscheidet sich, z. B. weil in der geplanten Dissertation rechtshistorisch vorgegangen werden soll. Oder es sollen ökonomische Argumente eine Rolle spielen. Oder man will in der Dissertation mit neuen Argumenten zu einem anderen Ergebnis gelangen. Zunächst also ist zu prüfen, ob die bereits vorhandene Arbeit nicht eher eine Hilfestellung als ein Hindernis ist. Freilich ist die psychologische Barriere, eine Dissertation zu einem in einer anderen, vor kurzer Zeit erschienenen Dissertation schon behandelten Thema zu schreiben, gerade am Anfang der Bearbeitung hoch – wenn auch mit guten Gründen überwindbar. Es gibt Beispiele dafür, dass innerhalb eines Jahres mehrere Dissertationen zu demselben Themenbereich publiziert werden, die sich in der Machart und im Inhalt deutlich voneinander unterscheiden. Das kommt insbesondere bei aktuellen Rechtsproblemen vor.
Anders ist die Situation, wenn eine einschlägige Dissertation erscheint, nachdem schon längere Zeit an der eigenen Dissertation gearbeitet worden ist. Dann sollte sich keine Panik breitmachen, und das Thema sollte keinesfalls aufgegeben werden. Die oben aufgeführten Gründe dafür gelten hier umso mehr. Zwar ist die betreffende Dissertation dann einzuarbeiten, aber das ist eher positiv zu sehen: Nicht zuletzt kann man sich mit den darin vorhandenen Argumenten und Ergebnissen auseinandersetzen, und man kann überprüfen, ob man die relevante Literatur und Rechtsprechung erfasst hat.
Wenn die eigene Arbeit schon abgeschlossen oder abgegeben worden ist, gibt es zwei Möglichkeiten, mit einer kurz vor der Drucklegung erschienenen einschlägigen Arbeit umzugehen: In der Druckfassung der Dissertation erwähnt man entweder, dass diese Arbeit noch in den Fußnoten berücksichtigt worden ist, oder, dass sie nicht mehr eingearbeitet werden konnte. Dasselbe gilt, wenn einschlägige höchstrichterliche Entscheidungen noch vor der Drucklegung veröffentlicht werden. So kann z. B. im Vorwort darauf hingewiesen werden, dass Rechtsprechung und Literatur nur bis zu einem bestimmten Datum berücksichtigt worden sind.
II.Formulierung des Themas
Zunächst wird zusammen mit der Zustimmung des Betreuers bzw. der Betreuerin ein Arbeitstitel formuliert. Der Arbeitstitel ist, wie der Name impliziert, vorläufig: Er kann während der Arbeit an der Dissertation im Einvernehmen mit den Betreuenden verändert werden. Insbesondere kann er enger gefasst werden, wenn sich herausstellt, dass das Thema zu weit ist und in einer zumutbaren Zeitspanne nicht bewältigt werden kann. Oder der Titel kann ausgeweitet werden, wenn man bemerkt, dass die Fragestellung zu eng und daher wissenschaftlich kaum ergiebig ist. Die endgültige Festlegung auf einen Titel erfolgt sinnvollerweise, wiederum nach Absprache mit dem Betreuer bzw. der Betreuerin, am Ende der Arbeit an der Dissertation. Zweckmäßigerweise ist spätestens dann daran zu denken, einen Ober- und einen Untertitel zu formulieren. Der Untertitel dient dazu, das Thema zu präzisieren. So lassen sich Titelungetüme vermeiden, die z. B. durch die Formulierung „unter besonderer Berücksichtigung von“ entstehen.
III.Exposé
1.Zweck
Im Anfangsstadium der Arbeit an einer Dissertation wird häufig ein Exposé verlangt, z. B. als Voraussetzung für die Bewerbung um ein Stipendium, in der strukturierten Doktorandenausbildung (z. B. in Graduiertenkollegs) oder von den Betreuenden. Es dient der Darlegung, dass die Promovierenden sich einen vorläufigen Überblick über das Arbeitsthema verschafft bzw. sich so in die Fragestellung der Arbeit eingearbeitet haben, dass sie in der Lage sind, die zu behandelnden Probleme (zumindest bereits einige davon) zu benennen bzw. einschlägige Forschungsfragen zu stellen. Ergebnisse werden noch nicht erwartet. Aber es können neben Forschungsfragen bereits Hypothesen formuliert werden. Selbstverständlich kann auch dargelegt werden, dass man sich (z. B.) einen Überblick über (z. B.) einen technischen oder wirtschaftlichen Sachverhalt oder über die Verwendung eines Begriffs verschaffen will, wenn dies als Voraussetzung für die juristische Forschungsfrage erforderlich ist; auch dies kann Gegenstand einer wissenschaftlichen Fragestellung sein.
Die Erstellung eines Exposés ist keine überflüssige Schreibübung und sollte daher auch dann erfolgen, wenn dies nicht explizit gefordert wird: Das Exposé dient erstens als Nachweis der Geeignetheit des Themas, als Beleg für den Forschungsbedarf, als Hinweis auf den geplanten Aufbau der Arbeit und auf die Vorgehensweise (einschließlich Zeitplan), zweitens als Grundlage für die weitere Arbeit, drittens als Unterlage für die Beratung durch die Betreuenden, und viertens ist es eine Vorarbeit für die spätere Einleitung der fertigen Dissertation (siehe dazu unten Kapitel 5, II.). Auch in der Einleitung der Dissertation muss nämlich auf die Fragestellung (ggf. auch auf Methode und Quellen), auf den Forschungsbedarf und auf den Forschungs- bzw. Meinungsstand eingegangen werden, und es kann der Gang der Untersuchung skizziert werden.
Da das Exposé am Anfang der eingehenden Beschäftigung mit dem Thema steht, handelt es sich in der Regel um vorläufige Ausführungen. Vollständigkeit wird nicht erwartet, und es können im Laufe der Arbeit Änderungen eintreten. Freilich liegt es auf der Hand, dass die Erstellung eines Exposés voraussetzt, dass man sich in die Forschungsliteratur, die Rechtsprechung und ggf. die Quellen eingelesen, d. h. mit der Materialsuche, Materialsammlung und Materialauswertung (dazu unten Kapitel 3 und 4) begonnen hat. Erst einige Zeit nach Beginn dieser Arbeitsschritte sind sinnvolle Ausführungen zur Fragestellung und zum Forschungs- bzw. Meinungsstand und ist die Erstellung einer brauchbaren Arbeitsgliederung als Bestandteile des Exposés (dazu sogleich) möglich.
2.Gliederung
Aus dem Zweck des Exposés ergibt sich dessen Gliederung. Sie kann wie folgt aussehen:
Empfehlung zur Gliederung des Exposés
I. Fragestellung
II. Forschungsstand (oder: Meinungsstand)
III. Arbeitsgliederung
IV. Zeitplan
V. Literatur
Bei methodischen Besonderheiten ist ein Abschnitt zur Methode einzufügen, bei rechtshistorischen Arbeiten ein Abschnitt zu den Quellen (beides zwischen Fragestellung und Forschungsstand).
Statt Fragestellung kann selbstverständlich auch eine andere geeignete Formulierung gewählt werden, z. B. „Problemstellung“, „Ziel der Arbeit“ oder „Forschungsfrage“. Eine Untergliederung (mit Überschriften) in einzelne Aspekte davon (z. B. „Ausgangslage“, „Praktisches Problem“) ist nicht sinnvoll: Wenn entsprechende Ausführungen angebracht sind, bilden sie auch ohne eigene Überschrift einen Bestandteil des ersten Gliederungspunktes.
Die Formulierung Forschungsstand ist ggf. durch „Meinungsstand“ zu ersetzen, wenn nicht nur auf den Stand der Forschungsliteratur, sondern auch auf den Stand der Rechtsprechung eingegangen wird. Gerichte forschen nicht, sondern entscheiden in einem Einzelfall: Zu diesem vertreten sie eine Meinung, die freilich über den Einzelfall hinaus Gewicht erlangen kann. Das ändert selbstverständlich nichts daran, dass die Dissertation sich mit den Argumenten und Ergebnissen der Rechtsprechung auseinandersetzen muss.
Mit Arbeitsgliederung ist die geplante Gliederung der Dissertation gemeint. Stattdessen kann auch „Vorläufige Gliederung“, „Geplanter Aufbau der Dissertation“ o. ä. formuliert werden.
Der Zeitplan weist nach, dass man sich Gedanken über die für die Dissertation aufzuwendende Zeit und über die einzelnen Arbeitsschritte gemacht hat.
Unter Literatur ist in einem alphabetischen Verzeichnis zu dokumentieren, dass die Forschungsliteratur adäquat, d. h. in dem für die Erstellung des Exposés erforderlichen Umfang, recherchiert und ausgewertet worden ist. Vollständigkeit wird auch hier nicht verlangt – wohl aber, dass maßgebliche Titel gesehen und berücksichtigt worden sind.
Die genannten Gliederungspunkte können nach Bedarf durch weitere ergänzt werden, so z. B. zwischen „Fragestellung“ und „Forschungsstand“ durch „Methode“, wenn die Arbeit insofern von der üblichen rechtswissenschaftlichen Methode abweicht, z. B. wirtschaftswissenschaftliche oder rechtshistorische Kapitel enthalten soll. Bei einer rechtshistorischen Arbeit oder wenn rechtshistorische Kapitel vorgesehen sind, ist vor „Forschungsstand“ ein Gliederungspunkt „Quellen“ vorzusehen.
3.Inhalt
In den Ausführungen zur Fragestellung ist darzulegen, welche Forschungsfragen in der Arbeit behandelt werden sollen. Als „Aufhänger“ kann z. B. eingegangen werden auf:
• soziale oder wirtschaftliche Befunde;
• Aktualität des Themas;
• praktische Relevanz;
• eine Leitentscheidung eines Obergerichts, aus der sich juristische Probleme ergeben;
• die Feststellung eines Autors, dass Forschungsbedarf besteht;
• ein juristisches Problem, das in der eigenen Praxis immer wieder auftaucht;
• unbefriedigende Gesetzeslage oder -interpretation;
• eine Pressemeldung über ein juristisches Problem.
Generell geht es darum, ausführlich darzulegen, welches rechtswissenschaftliche Problem die Arbeit lösen will, welche Fragen im Einzelnen sich ergeben und behandelt werden sollen. Das kann gelegentlich in Frageform erfolgen („In welchem Verhältnis stehen Abs. 1 und Abs. 2 zueinander?“), sollte aber hauptsächlich in anderen Formulierungen erfolgen („Erstens ist daher zu untersuchen …“). Da die Fragestellung und ihre Bandbreite möglichst schlüssig darzulegen und zu entfalten sind, empfiehlt es sich, dies auch in den Formulierungen zu verdeutlichen: Statt wiederholt davon zu sprechen, was als Nächstes dargestellt oder gar betrachtet werden soll, ist etwas zu untersuchen, zu analysieren, darzulegen oder zumindest zu behandeln. Statt mit dem Verb „sollen“ Unverbindlichkeit zu suggerieren („Sodann soll gefragt werden, …“), wählt man besser Formulierungen, aus denen sich ergibt, dass die Reihenfolge der gestellten Fragen einer gewissen Logik unterliegt (Beispiele: „Daraus ergibt sich die weitere Frage …“; „Sodann ist deshalb zu analysieren, …“).
In den Ausführungen zur Methode ist darzulegen, welche methodischen Besonderheiten die geplante rechtswissenschaftliche Dissertation aufweisen wird. Das gilt sowohl für Arbeiten zum geltenden Recht als auch für solche zu einem der juristischen Grundlagenfächer. So ist bei Dissertationen zum geltenden Recht z. B. näher darauf einzugehen, wenn wirtschaftswissenschaftliche oder linguistische Erkenntnisse zur Lösung eines juristischen Problems herangezogen werden sollen und weshalb dies sinnvoll ist, desgleichen, wenn Kapitel oder Abschnitte zu einem der Grundlagenfächer geplant sind. Ausführungen zur Methode sind entbehrlich, wenn keine Besonderheiten vorliegen, wenn also z. B. in einer Arbeit zum geltenden Recht die Methode juristisch ist.
Unter Forschungs- bzw. Meinungsstand und ggf. unter Quellen ist zu dokumentieren, dass der Verfasser sich in die einschlägige Forschungsliteratur, in die Rechtsprechung und ggf. in die historischen Quellen8 eingelesen hat und Forschungsbedarf besteht, weil das Thema oder einzelne Aspekte davon bisher nicht überzeugend, nur unzureichend oder gar nicht untersucht worden sind. So kann z. B. mit entsprechenden Belegen ein „Negativergebnis“ festgestellt werden, nämlich dass die bisherige Forschungsliteratur ein bestimmtes Problem nicht erkannt und deshalb nicht oder nicht ausreichend behandelt hat. Die bisher vertretenen ggf. kontroversen Auffassungen sind überblicksartig wiederzugeben; in allen Einzelheiten erfolgt dies im weiteren Verlauf der Arbeit. Insbesondere wenn bereits eine Dissertation und/oder ein oder mehrere Aufsätze zum gewählten oder zu einem verwandten Thema vorliegen, ist darauf einzugehen, wie sich die geplante Arbeit inhaltlich davon abgrenzt und dass weiterhin Forschungsbedarf vorhanden ist. Es geht um einen vorläufigen Überbl...