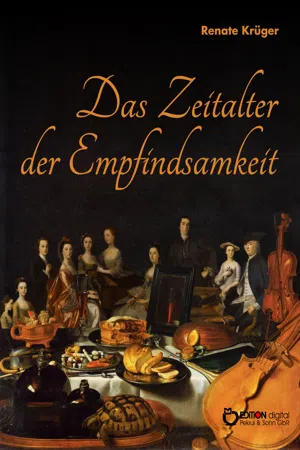![]()
Lebensgewohnheit und Kunsthandwerk
Das einfache Leben
Ein Charakteristikum des Zeitalters der Empfindsamkeit ist die enge Verquickung der Lebensgewohnheiten mit dem zeitgenössischen Kunsthandwerk, ihre wechselseitige Abhängigkeit und ein besonderer merkantiler Akzent, der zunächst dem lyrisch empfindsamen Ton der Zeit so gar nicht zu entsprechen scheint und sich erst bei näherer Analyse als polarer Bestandteil erweist.
Die Lebensgewohnheiten des späten 18. Jahrhunderts waren nach den zahlreich erhaltenen autobiografischen Berichten und Beschreibungen zwar differenziert, aber doch recht schlicht. Als eine Art von Modell kann die Struktur der Residenzstadt Weimar nach einer Beschreibung aus dem Jahre 1786 gelten. In diesem Jahr lebten in Weimar 6163 Einwohner und 102 Arme, die also offensichtlich nicht zu den gleichberechtigten Mitbürgern gezählt wurden. Weimar war der zentral gelegene Marktflecken für die agrarisch-ländliche Umgebung, es war auch der recht bescheidene Regierungssitz für die vereinigten Herzogtümer Weimar und Eisenach, mit dem ein unverhältnismäßig großer Beamtenapparat verbunden war. Die höheren und höchsten Beamten ließen sich nur selten auf der Straße sehen. Man sah sie langsam und gemessen einherschreiten und somit der eigenen Würde besondere Überzeugungskraft und Ausdruck verleihen. Diese Art, sich zu präsentieren, hatten sie von Jugend auf lernen müssen. Schon als Knaben waren sie von ihren Hauslehrern angehalten worden, nicht »wie Schneider« zu rennen, wie arbeitende Menschen also, die es eilig hatten, um alle Pflichten, die ihr Broterwerb mit sich brachte, gewissenhaft zu erfüllen. Der Hofbeamte demonstrierte, dass er Zeit hatte. Stets ließ er sich von einem Diener begleiten. Die vier Ärzte, die in Weimar lebten, besuchten einmal in der Woche die Familien, die sich ihnen anvertraut hatten, teils in prophylaktischer Absicht, in erster Linie aber, um Neuigkeiten auszutauschen. Über ein Drittel der Weimarer Einwohner waren als Dienstboten oder Gelegenheitsarbeiter tätig. Zwei Fünftel der Bevölkerung gehörten dem Kaufmanns- oder Handwerkerstand an, von ihnen war die größere Hälfte selbstständig. Das verbleibende Viertel setzte sich aus Staats- oder Stadtbeamten sowie Angehörigen akademischer Berufe zusammen. Einen Mittelstand, der in der Lage gewesen wäre, eigene bestimmende Maßstäbe zu setzen, gab es so gut wie gar nicht. Das gesamte gesellschaftliche Leben wurde geprägt von der strengen Unterscheidung zwischen den »Hoffähigen«, denjenigen also, die aufgrund ihrer Herkunft und ihres gesellschaftlichen Ansehens bei Hofe empfangen werden konnten, und der großen Masse der anderen, die vom Abglanz der »Hoffähigen« lebten. Erst nach und nach gewannen in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts unter Anna Amalia auch andere Maßstäbe an Bedeutung: das persönliche Können und Verdienst, besondere Fähigkeiten und Ruhm. Aber selbst ein Goethe sah sich noch 1782 genötigt, den Adelstitel als persönlichen Freibrief anzunehmen. Die Bauern, die zahlenmäßig die stärkste Bevölkerungsgruppe bildeten, lebten aufgrund von Leibeigenschaft und Erbuntertänigkeit in äußerst ärmlichen Verhältnissen. 1771 schrieb der Moralschriftsteller Johann Michael von Loen:
»Heute zutage ist der Landmann die armseligste unter allen Kreaturen: die Bauern sind Sklaven und ihre Knechte sind von dem Vieh, das sie hüten, kaum noch zu unterscheiden. Man kommt auf Dörfer, wo die Kinder halb nackend laufen und die Durchreisenden um ein Almosen anschreien. Die Eltern haben kaum noch einige Lumpen auf dem Leib, ihre Blöße zu decken. Man würde noch mehr Mitleid mit ihnen haben, wenn nicht ein wildes und viehisches Aussehen ein so hartes Schicksal zu rechtfertigen schiene. Der Bauer wird wie das stumme Vieh in aller Unwissenheit erzogen. Er wird unaufhörlich mit Frondiensten, Botenläufen, Treibjagden, Schanzen, Graben u. dgl. geängstigt. Er muss vom Morgen bis zum Abend die Äcker durchwühlen, es mag ihn die Hitze brennen oder die Kälte starr machen. Des Nachts liegt er im Feld und wird schier zum Wild, um das Wild zu scheuen, dass es nicht die Saaten plündere. Was dem Wildzahn entrissen wird, nimmt hernach ein rauer Beamter auf Abtrag der noch rückständigen Steuergelder hinweg.« (In: Entwurf einer Staatskunst, Anhang: Von der Verbesserung eines Staates (Von dem Bauernstand). Hier nach Siegfried Sieber, Johann Michael von Loen, Leipzig 1922, S. 208)
Treffender lässt sich die Lage der Bauern wohl kaum charakterisieren.
Im Bewusstsein der mittleren und unteren bürgerlichen Kreise lag das höchste Lebensglück in einer großen und gut geordneten Familie mit einer strengen, patriarchalischen Struktur. Die autobiografischen Quellen darüber sind sehr reich und vielfältig. Stets erscheint der Vater als letzte Autorität, dessen Wort unter allen Umständen gilt, dessen Ansehen bei Freunden und Feinden unantastbar ist. Die jüngere Generation der Stürmer und Dränger rebellierte nicht nur gegen die autoritäre Staatsdoktrin, sondern auch vor allem gegen die Vaterautorität, ja vielfach wurden diese beiden Begriffe gleichgesetzt. Goethe verurteilte anlässlich des Selbstmordes seines Freundes Karl Wilhelm Jerusalem, des literarischen Vorbildes des Werther, mit scharfen Worten den »Vaterton«; er bezeichnete die väterliche Autorität als die Ursache dieser Verzweiflungstat und galt somit als einer der Exponenten der Antivatergesinnung. Auch aus seinen eigenen autobiografischen Schriften wird deutlich, dass ihn mit seiner Mutter ein weitaus herzlicheres Verhältnis verband als mit seinem Vater.
Goethes Zeitgenosse Friedrich Karl von Strombeck berichtet über seine Lebensverhältnisse:
»Mein Vater, ein streng und altertümlich rechtschaffener und biederer Mann, war in hohem Grade ernst und eifersüchtig auf sein Ansehen. Ich erinnere mich nicht, dass er auch nur ein einzigesmal mit Zärtlichkeit meine Mutter oder uns Kinder angeredet oder mit recht innigem Wohlgefallen angeblickt hätte. Den tiefsten Respekt gegen ihn, die strengste Erfüllung der Pflichten verlangte er für beständig und nicht das Mindeste sah er in dieser Beziehung nach. Daher war denn in Beziehung gegen ihn die ganze Hausgemeinschaft, die Mutter mit eingeschlossen, in dem Zustand der größten Unterwürfigkeit ... Diese Art zu sein, war meinem Vater so zur zweiten andern Natur geworden, dass er sich nur unter den von ihm abhängigen Hausgenossen behaglich finden konnte und er hatte keinen Umgang, am wenigsten einen freundschaftlichen ...« (Nach Oeser, Menschen und Werke im Zeitalter Goethes, 1932)
![]()
Freundschaften
Auch als Reaktion auf solche Vaterautorität entwickelten sich während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zahlreiche sehr enge freundschaftliche Bindungen, in denen man nicht zuletzt die mangelnde Zärtlichkeit des Elternhauses zu kompensieren suchte. Gerade in diesen fein differenzierten zwischenmenschlichen Beziehungen feierte die Empfindsamkeit Triumphe. Im Verhältnis der Geschlechter zueinander trat das sinnliche Element zugunsten einer schwärmerischen, unkörperlichen Auffassung von der Liebe mehr und mehr zurück. Die Seelenfreundschaft trat an die Stelle der Liebe erotischer Prägung. Der oder die Geliebte verlor die als beschwerlich empfundene »Körperlichkeit« und wurde »ganz Seele«. Diese Seele musste wie ein »trauriger Fremdling« umherflattern, bis sie endlich das »seelenverwandte« geliebte Gegenüber gefunden hatte. Dann aber waren die Seelen vereint auf ewig, mochten sie auch räumlich getrennt sein. Tränenselige Vollmondnächte bildeten den angemessenen Hintergrund.
Ein Beispiel solcher Empfindsamkeit, das für viele stehen kann, ist der Briefwechsel zwischen Herder und seiner Braut Karoline Flachsland. Die empfindsamen Gefühle, die hier zum Ausdruck gebracht wurden, erwuchsen nicht aus natürlicher Unbefangenheit, sondern aus literarischen Quellen, wie den Tugendromanen Richardsons und Rousseaus sowie der Lyrik von Gellner, Kleist, Uz, Young und Klopstock.
»Eine Viertelstunde Mondscheinspaziergang Hand in Hand, Brust an Brust gelehnt - welche Wonne - und Himmel!« (Karoline Flachsland) Diese Stimmung entspricht völlig der Atmosphäre im Kreis der Darmstädter Empfindsamen, in dem Karoline Flachsland lebte. Derartige Freundeskreise gab es in vielen Städten, mitunter waren sie sogar als »Orden der Empfindsamkeit« gegründet worden, in denen man jede Gefühlsregung mit großer Reizbarkeit »genoss«, sogar auf organisierten Kongressen, wie etwa im Hause der Schriftstellerin Sophie von Laroche und ihrer »schönen Seelen«. Einen ähnlichen Freundeskreis versammelte auch das Weimarer Hoffräulein Luise von Göchhausen um sich. Jeden Sonnabend lud sie Gäste ein, die sie mit »Freundschaftsbrötchen« und starkem Kaffee erfreute. Die Gäste durften nicht mit leeren Händen kommen. Als »Dankopfer« auf dem Hausaltar des Genius Loci mussten sie ein Gedicht oder eine kleine Komposition zum besten geben, ein neues Buch mitbringen, eine Anekdote erzählen. Auch Goethe nahm bisweilen an diesen »Freundschaftstagen« teil.
In dieser Zeit nahm auch die Frauenemanzipation einen bedeutenden Aufschwung, das Ideal der Männer aber blieb weiterhin die einfache und »natürliche« Frau, nicht die intellektuell differenzierte.
Werthers Lotte ist das Mädchen, wie es sich der gebildete Mann wünscht: empfänglich für Natur und Kunst, dennoch mit einem nüchternen Blick für die Realitäten des Alltags ausgestattet, sparsam und wirtschaftlich. Diese Eigenschaften galten als Grundlage für eine glückliche Ehe. In einem Bericht von Ernestine Voß über ihren Mann heißt es, dass abends aus Sparsamkeitsgründen immer nur ein Licht angezündet wurde, auch als Voß schon Rektor in Eutin war. Bei dieser einen Kerze arbeitete Voß sehr fleißig, und die Gattin saß unmittelbar neben ihm. Ähnlich muss man sich auch das Leben im Wandsbecker Haus von Matthias Claudius vorstellen.
In scheinbarem Gegensatz zu diesem traulichen Familienglück stehen die zahlreichen Männerfreundschaften der Zeit. So schrieb Gleim an Johann Georg Jacobi: »Nach Ihrer Abreise, mein liebster Freund, war ich heute zum ersten Mal wieder in meinem Garten. Pomona winkte mich zu dem Baum mit den kleinen roten Äpfeln ... Ich konnt‘ ihrem Winke nicht folgen, es war mir zu traurig hinzugehen und meinen lieben Jacobi nicht zu finden ... Da gab ein Geist mir einen Kuss, der Genius meines Jacobi war es, oder er selbst ... Es war elf Minuten auf dreie; dachten Sie an mich, mein lieber Freund, so war es gewiss Ihr Geist, der mich küsste. Übermorgen um elf Minuten auf drei steh ich wieder unter dem Baum mit den roten Äpfeln, wenn Sie etwa nur auf dieser Stelle mich küssen wollen.« In Jacobis Antwortbrief wiederum heißt es: »O wenn Sie wüssten, was für mich Ihre Briefe sind! Jedes Mal möchte ich den Briefträger umarmen.«
Solche heftigen Gefühlsausbrüche waren nicht etwa Ausnahmen, sondern allgemein üblich, ja sie gehörten bald zum guten Ton, zur Konvention. Aus echter Empfindung wurde immer mehr Empfindelei. Umarmungen, Küsse, Tränenströme und gespielte oder echte Ohnmachten gehörten zu den Umgangsformen des Alltags. Das andauernde Schluchzen muss entsetzlich gewesen sein. Überschwänglich bedankte sich Gottfried August Bürger bei Miller für die »wollüstigen« Tränen, die er bei der Lektüre des »Siegwart« vergießen durfte. Selbst die sonst so zurückhaltenden und ihrer Würde bewussten Preußen wie Friedrich II., die Prinzen Ferdinand und Heinrich mitsamt ihren Generälen weinten bei jeder Gelegenheit. Besonders aktiv Empfindsame verbuchten sogar die vergossenen Zähren in ihrem Tagebuch, und selbstverständlich entspricht bei den jugendlichen Dichtern des Hainbundes die Zahl ihrer Tränen der Menge und Tiefe ihrer Gedichte.
![]()
Mode
Widersprüchlich wie der Mensch des späten 18. Jahrhunderts war auch die Mode. Man kleidete sich auffällig, in einer Mischung von Extravaganz und betontem Naturalismus. Besondere Auswüchse im wahrsten Sinne des Wortes zeigte die Frauenmode.
Die Frisuren der Damen waren zeitweise so hoch, dass die Polster aus den Wagen entfernt werden mussten. Die Kleider und Haartrachten wurden bis zur Französischen Revolution vom Pariser Hof diktiert und behielten noch die Tradition des Rokokos bei. Tonangebend war Marie Antoinette, die Gemahlin Ludwigs XVI. 1785 trug sie nach einem Augenzeugenbericht »à la jardiniére«, einen besonders interessanten Kopfputz, nämlich eine Artischocke, einen Kohlkopf und ein Bund Radieschen, sinnreiche Demonstration ländlicher Ungezwungenheit. Natürlich konnten sich nicht alle Damen der Gesellschaft eine solche originelle Kopfbedeckung leisten, sie begnügten sich mit kolossalen Hauben, den Dormeusen oder Baigneusen. Ursprünglich war die Dormeuse eine Schlafhaube zum Schutz der empfindlichen Frisur in der Nacht, sie wurde während des gesamten 18. Jahrhunderts von den Damen benutzt, seit etwa 1775 galt sie als besonders elegante Morgenhaube und wurde bis ins erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts allgemein getragen. Daniel Chodowiecki hat auf seinen Skizzen, Zeichnungen und Studien immer wieder diese typische Kopfbedeckung dargestellt. Sie bestand aus einem großen rundgeschnittenen Haubenboden, meist aus weißem Batist oder anderem feinem Leinen und war von einer gezogenen oder in Falten gelegten Rüsche aus Spitze oder in bunter oder weißer Stickerei umrandet. Dazu trug man im 18. Jahrhundert Reifrock und Schnürbrust in einer späten, sehr manierierten Form. Beim Reifrock wurde die Breitenausdehnung besonders betont. Die Haare der Damen waren meist weiß gepudert.
Diesen Rokokoreminiszenzen setzten deutsche Modejournalisten ein anderes Schönheitsideal entgegen. 1789 pries man im Weimarer »Journal des Luxus und der Moden« die rote Haarfarbe der Damen als besonders empfmdsamkeitsfördernd und edel an. Man unterbaute diese Theorie damit, dass auch bereits die alten Germanen rote Haare über alles geschätzt hätten. »Welche Reize können anziehender und einnehmender sein? ... und wie weich, wie sanft und empfindungsvoll muss erst das Herz eines solchen Mädchens seyn; wenn der Schluss von einem weichen und zarten Körper auf eine ebenso sanfte und zarte fühlende Seele, wie Ärzte und Philosophen glauben, richtig und erwiesen ist? ... Vermöge des feineren und zarteren Körperbaues empfinden solche Personen alles lebhafter und feiner; alles macht leichter Eindruck auf sie, sie sind voll zarten Gefühls und für alle angenehmen Empfindungen leicht empfänglich; sie sind daher zur Freude, zum sanften Vergnügen sehr gestimmt, und mehr als Brünetten - zärtlich!« Rothaarige Damen scheinen also sehr begehrt gewesen zu sein, sehr im Gegensatz zu rothaarigen Männern!
Nach der Französischen Revolution wurde die Frauenmode von griechischen Vorbildern bestimmt; der Wendepunkt liegt etwa um das Jahr 1794. Als erster kreierte der Maler Louis David in Paris die Kleidung à la grecque, das »Statuenkostüm« mit der betonten Vertikalrichtung. Die Taille saß zunächst hoch unter der Brust, später wurde sie gar nicht mehr berücksichtigt. Das hemdartige Gewand, die Tunika, wurde an den Achseln gehalten und fiel frei herab, es war aus sehr weichem Stoff, ließ Hals und Arme frei und schmiegte sich plastisch den Körperformen an. Der Prototyp dieser Mode war die Madame Tallien.
Stärker noch als bei den Damen manifestierte sich der Zeitgeist in der Männermode.
Der barocke Leibrock, wie ihn noch Bach und Händel getragen hatten, war schon während der Periode des Rokokos zum leicht kupierten Halbfrack verändert worden, um 1770 wurde er zum »Schwalbenschwanz«, zum Frack. Der Ursprung dieser Mode lag im rustikalen England, wo der Frack als Land- und Reitanzug diente. In diese Tracht nun kleidete Goethe seinen Werther und beschrieb sie so genau, dass sie Unzähligen als Vorbild diente: ein blauer Frack mit gelben Knöpfen und gelber Weste, Stiefel mit gelben Stulpen, dazu ein grauer runder Filzhut, der ebenso wie der Zylinderhut aus Amerika bekannt geworden war. Der Hals blieb frei. Auch scharlachrote und violette Fräcke mit goldenen oder kupfernen Knöpfen waren sehr beliebt. Dieser Tracht maß man einen demonstrativ revolutionären Charakter bei. Sie wurde von der älteren Generation als provokatorisch empfunden. Auch Goethe selbst trug die »Werthermontur«, in ihr reiste er nach Weimar und erregte ein nicht geringes Aufsehen. Ihre Träger empfanden diese Kleidung als Ausdruck der eigenen Unverfälschtheit und Natürlichkeit im Sinne Rousseaus und protestierten da mit gegen die feminine Männertracht des späten Rokokos. Selbstverständlich fiel in dieser modischen Demokratisierung der alte Rokokozopf, auch wurden die Haare nicht mehr gepudert. Man glaubte, dass damit die Zopfzeit ihr Ende gefunden habe. Es galt als besonders mutig, mit zerzausten, mähnenartig flatternden Haaren aufzutreten und insgesamt ein wenig ungepflegt zu erscheinen. Vorher hatten nur die Armen ihre Haare nicht gepudert, nur Fuhrknechte hatten Stiefel und nur Matrosen lange Beinkleider und runde Hüte getragen. Jetzt wurde diese Mode sogar hoffähig. Auch besonders emanzipierte Damen trugen Wertherhut, Weste und Frack. Gegen das Jahrhundertende hielten ...